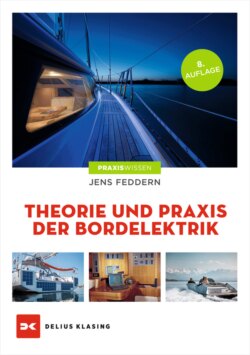Читать книгу Theorie und Praxis der Bordelektrik - Jens Feddern - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.7 Schaltpläne lesen und zeichnen
ОглавлениеSchaltpläne erläutern die Arbeitsweise, die Leitungsverbindung, die räumliche Anordnung der Betriebsmittel und deren Zusammenwirken.
Diese Formulierung aus der DIN 40719 trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels, alle interessierten Skipper zu vorbildlichen technischen Zeichnern auszubilden, sondern ein wenig Übersicht in die Elektrik zu bringen.
Fast jeder, der bereits im Bereich der Bordelektrik aktiv gewesen ist, hat auch schon den ein oder anderen Schaltplan angefertigt. Selbst die Skizze auf dem Schmierpapier kann man bereits als Plan ansehen, auch wenn der Kreis der Kenner, die diese Hieroglyphen entziffern können, klein ist.
Daher hat man sich auf eine Reihe von logischen Symbolen geeinigt, die für jeden (fast) unmissverständlich dieselbe Funktion ausdrücken. Dabei lassen diese Schaltzeichen nur die Wirkungsweise, nicht aber den konstruktiven Aufbau der einzelnen Komponenten (oder »Betriebsmittel«) erkennen. Für den Schaltplan ist es nahezu gleich, ob ein Schalter von Bosch oder ETA eingebaut wird, solange die Funktion die gleiche ist.
In diesem Bereich beschränke ich mich auf die einpolige Darstellung, angenähert an die DIN 40717.
Tabelle 1–4: Zulässiger Dauerstrom und Nennstromsicherung. (Germanischer Lloyd)
Der Vorteil an dieser Vereinbarung liegt darin, dass die Zeichnungen auch von anderen Fachleuten gelesen werden können und man sich selbst auch nach einiger Zeit noch zurechtfindet. Teilweise muss man die vorhandene Technik nach den Plänen anderer an neue Geräte anpassen. Für diesen Fall sollte man die gängigsten Schaltzeichen kennen.
Abbildung 1–14: Aufbau eines Schaltplans.
Abbildung 1–15: Schaltplansymbole.
Zusätzlich werden den Symbolen auch Buchstaben beigegeben. Diese verdeutlichen nochmals die Funktion und ermöglichen eine eindeutige Zuordnung. Jeder Schalter hat z. B. einen Buchstaben und eine Nummer, die sowohl im Schaltplan als auch am Schalter selbst auftaucht. Die Nummern für die einzelnen Komponenten werden in sinnvoller Reihenfolge vergeben, wobei eine Doppelvergabe innerhalb einer Schaltung nicht sinnvoll ist.
Tabelle 1–5: Kennbuchstaben für die Kennzeichnung der Art elektrischer Betriebsmittel (DIN 40719).
Ergänzt wird die Betriebsmittelkennzeichnung noch durch die vorangestellte Seitennummer, sodass man einen direkten Bezug zur Blattnummer des Schaltplans hat. Liest man z. B. am Scheibenwischermotor die Bezeichnung 61M2, so weiß man, dass dieser im Schaltplan Nr. 61 dokumentiert und dort der zweite Motor ist. Somit muss man sich bezüglich der Nummernvergabe nur auf ein Blatt konzentrieren, da ab dem nächsten Blatt diese wieder bei 1 startet. Ist dort auch ein Motor verschaltet, so würde dieser die Kennzeichnung 62M1 erhalten etc.
Abbildung 1–16: Klarsichtscheibe und Scheibenwischer der MS TÜMMLER zum Schaltplan Abb. 1–14.
Nachdem in der Vergangenheit eher große Pläne verwendet wurden, ist man heutzutage auf ein handlicheres Format – in der Regel A4 – umgestiegen. Dies setzt voraus, dass man eine funktionale Kapselung durchführt, d. h. einzelne Funktionen gruppiert und diese dann zusammen auf einen Plan bringt. In der oberen bzw. unteren Hälfte sammelt man in waagerechten Linien alle Signale, die für die Schaltung auf dem Blatt erforderlich sind. Dies können zum Beispiel +24 V aus dem Bordnetz, +24 V aus dem Maschinennetz, 0 V (Minuspol), aber auch Hilfssignale sein wie Lampentest oder gedimmter Minus für die Lampen. Die Erzeugung bzw. Einspeisung dieser Signale muss nicht auf diesem Blatt dokumentiert sein. Ein Querverweis reicht, um dieses Signal zu verfolgen.
Abbildung 1–17: Professionelle Stromlaufpläne lassen sich gut am Computer erstellen, z. B. mit dem Open-Source-Programm KiCAD.
Wie auf einer Wäscheleine zweigt man hier das erforderliche Signal mit einem dicken Punkt ab (die Verkabelung geht in der Realität leider nicht so einfach).
In dem skizzierten Beispiel ist die Ansteuerung einer Klarsichtscheibe und von zwei Scheibenwischern dargestellt. Die Klarsichtscheibe wird über den Schutzschalter 61F1 ein- und ausgeschaltet. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten, dreipoligen Wippschalter der Firma ETA.
In dem Wippschalter ist eine Leuchtdiode integriert, deren Funktion über die Diode 61D1 mit dem Lampentest geprüft werden kann. Ferner ist die Leuchtdiode mit dem Signal »0 V Lampen« verbunden. Dies ist ein spezielles Signal, welches das Dimmen der gesamten Instrumentenbeleuchtung ermöglicht.
Im unteren Drittel befinden sich die Klemmen, an denen das Kabel zur Klarsichtscheibe angeklemmt wird. Der Pluspol befindet sich an Klemme 60X13 und der Minuspol an Klemme 60X14. Alles ganz einfach, oder?
Bei den beiden Scheibenwischern erfolgt die Bedienung jeweils wieder über einen ETA-Wippschalter mit integrierter Leuchtdiode. Die Motoren verfügen über zwei Geschwindigkeitsstufen. Die Umschaltung übernimmt das Relais 61K1, das über vier Kontakte verfügt (zwei Öffner und zwei Schließer). Das Relais wird über den Schalter 61S1 angesteuert. Ist dieser eingeschaltet, so zieht das Relais an, und beide Wischer werden auf schnell geschaltet. Damit das Relais nicht eingeschaltet ist (und so unnötig Energie verbraucht), wenn keiner der Scheibenwischer eingeschaltet ist, wurde folgender Trick angewendet: Das Relais bezieht seine Energie über die Dioden 61D7 und 61D6, die wie ein Ventil wirken. Sobald einer der Wischer eingeschaltet ist, ist auch für das Relais Saft vorhanden. Über die Dioden ist aber sichergestellt, dass der andere Wischer nicht aus lauter Sympathie mitläuft.
Unterhalb des Relais sind seine Kontakte noch einmal abgebildet, und an der Seite ist vermerkt, wo welcher Kontakt verwendet wird. 61/4 besagt z. B., dass dieser Kontakt im Feld 4 auf Blatt 61 verwendet wird. Somit lassen sich auch komplexere Schaltungen über mehrere Blätter nachvollziehen.
Zusätzlich zu den Schaltplänen empfiehlt es sich, Klemmenpläne anzufertigen. In diesen Plänen werden in Tabellenform die einzelnen Klemmen und ihre angeschlossenen Verbraucher aufgeführt. So kann man direkt ersehen, welches Kabel wo angeklemmt wurde und an welchen Klemmen bei betätigten Schaltern Spannung anliegen muss. Dies ist zum Teil übersichtlicher, als einen gesamten Schaltplan nach den entsprechenden Klemmen zu untersuchen. Zusätzlich kann der Kommentar länger als im Schaltplan dargestellt werden, z. B.: »12X10 Bb. Navigationslicht über 12F3 und 12S3«.