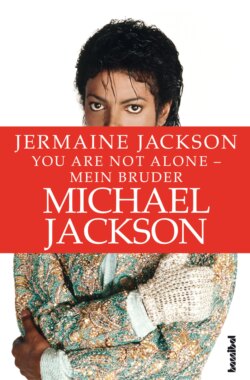Читать книгу You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson - Jermaine Jackson - Страница 11
ОглавлениеWenn ihr hier gut ankommt, dann werden sie euch überall lieben“, sagte Joseph im Bus auf dem Weg nach New York. Unser Ziel war das weltberühmte Apollo Theater in Harlem – ein magischer Ort, an dem „Stars gemacht wurden“.
Den ganzen Weg seit Indiana hatte er uns begeistert davon erzählt, was dieser Auftrittsort bedeutete und wer dort schon seine Triumphe gefeiert hatte: Ella Fitzgerald, Lena Horne, der Stepptänzer Bill „Bo Jangles“ Robinson … und James Brown. In einer Zeit, da schwarze Gesichter im Fernsehen noch die Ausnahme waren, entschieden Hallen wie das Apollo über den Erfolg afroamerikanischer Künstler. „Aber wenn ihr danebenhaut, wenn ihr Fehler macht, dann wird dieses Publikum euch niedermachen. Heute müsst ihr wirklich in Topform sein“, setzte er warnend hinzu.
Das alles machte uns keine Angst: Wir wussten, wenn wir dieses Publikum für uns gewinnen könnten, dann würden sich wichtige Türen für uns öffnen, durch die wir zu größeren Erfolgen schreiten würden – für Jungen mit einem großen Traum hätte es keine bessere Motivation geben können. Manchmal war es durchaus von Vorteil, dass wir so naiv waren, was die Unterhaltungsindustrie betraf; oft war uns gar nicht bewusst, welch große Bedeutung bestimmten Ereignissen eigentlich zukam. Unser Bus hielt unter der Leuchtreklame des Apollo, die hochkant und tief orangefarben wie ein Sonnenuntergang in die Nacht hinausleuchtete.
Das Erste, was uns drinnen auffiel, waren die vielen Fotos von Musikerlegenden, die hier die Wände schmückten. Wir gingen eine Reihe von Fluren entlang, und irgendwann fiel uns auch der schäbige Teppich auf. Joseph sagte daraufhin, wir sollten uns einmal vorstellen, wer alles schon über ihn hinweggeschritten sei und in wessen Fußstapfen wir damit traten. Wir hatten unsere eigene Garderobe, in der es einen von Glühbirnen eingefassten Spiegel und einen verchromten Kleiderständer auf Rollen gab. Und die Mikrofone kamen elektronisch gesteuert aus dem Bühnenboden – ganz die moderne Technik des Raumfahrtzeitalters.
In der Garderobe kletterte Michael mit Jackie auf einen Sitz und drückte das Fenster auf, um hinauszusehen. „Da unten ist ein Basketballplatz!“, rief Jackie. Das fanden wir alle sehr aufregend. Am liebsten wären wir sofort nach draußen gerannt, um ein paar Körbe zu werfen, aber nun kam Joseph herein, und wir alle nahmen wieder Haltung an und taten so, als seien wir ganz konzentriert. Dann wurde es ernst. Ich weiß nicht, ob Joseph jemals merkte, wie leicht wir die ganzen Shows innerlich nahmen. Ihm war natürlich bewusst, dass Harlem eine ganz andere Nummer war als Chicago. Das Publikum im Apollo verstand etwas von Musik und wusste, wie gute Unterhaltung auszusehen hatte. Wenn man da patzte, dann verwandelte sich unwilliges Raunen schnell in Buhrufe, gefolgt von Wurfgeschossen wie Getränkedosen, Obst und Popcorn. Wenn es hingegen gut lief, sprangen die Leute auf, sangen, klatschten und tanzten. Wenn im Apollo jemand von der Bühne ging, musste er anschließend niemanden fragen, ob er gut gewesen sei.
Bevor wir auf die Bühne kamen, spürten wir die Schwingungen, die von dem ausverkauften Saal ausgingen. Michael und Marlon stellten sich vor Tito, Jackie, Johnny und mir in den Schatten am Bühnenaufgang, und wer auch immer es war, der da vor uns spielte, er kam nicht gerade gut an. Die Buhrufe waren laut und gnadenlos. Dann landete die erste Dose auf der Bühne, ein Apfelbutzen flog hinterher. Marlon drehte sich erschrocken zu uns um. „Die schmeißen ja Sachen nach ihm!“
Joseph warf uns diesen Blick zu, in dem zu lesen stand: „Ich hab’s euch ja gesagt.“
Im Backstage-Bereich hinter dem Vorhang, vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, war ein Stück eines alten Baumstamms aufgestellt, ein Teil des berühmten „Tree Of Hope“, der einst am sogenannten Boulevard Of Dreams, der 7. Avenue, zwischen dem alten Lafayette Theater und Connie’s Inn gestanden hatte. Es war ein uralter Aberglaube schwarzer Musiker, dass es Glück brachte, diesen Baum zu berühren oder, bevor er gefällt wurde, unter seinem Blätterdach zu spielen. Für afroamerikanische Künstler war er inzwischen zum Symbol der Hoffnung geworden, ähnlich wie der Baum vor unserem Haus für uns unsere brüderliche Einheit versinnbildlichte. Und daher legten Michael und Marlon natürlich ihre Hände auf den Hoffnungsbaum, aber ich bezweifle, dass Fortuna bei dem Auftritt, den wir nun absolvierten, besonders stark gefordert war.
An jenem Abend ließen wir das Apollo erbeben, und es dauerte nicht lange, da sprangen die Zuschauer von ihren Sitzen. Ich glaube nicht, dass wir in der Zeit, bevor wir zu Motown wechselten, je eine bessere Show ablieferten, und am Ende gewannen wir die Endausscheidung des Superdog Amateurwettbewerbs. Offenbar hatten wir das Management beeindruckt, denn wir wurden erneut gebucht, dieses Mal für einen bezahlten Auftritt. Im Mai 1968 spielten wir im Apollo am selben Abend wie Etta James, die Coasters und die Vibrations. Wir wussten, dass wir auf höchster Ebene überzeugt hatten. Was wir jedoch noch nicht wussten, war, dass ein Fernsehproduzent im Publikum saß, der sich Notizen machte und sehr an uns interessiert war.
Nun kam ein kleiner jüdischer Anwalt ins Spiel. Offenbar hatte Richard Aarons in New York an Josephs Hoteltür geklopft und seine Dienste angeboten. Der elegante, lässige Richard, der immer korrekt im Anzug erschien, wurde uns vorgestellt als „der Mann, der uns dabei helfen wird, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“ Da Richards Vater der Vorsitzende einer Musikergewerkschaft in New York war, hatte er in der Tat blendende Kontakte.
Richard stellte sofort eine professionelle Pressemappe zusammen, die neben unseren Steeltown-Hits einige lobende Zeitungskritiken sowie Werbematerial enthielt und von einem Brief begleitet wurde, in dem er ausführlich darlegte, wieso die Jackson 5 eine Chance verdienten. Die Mappe verschickte er an Labels wie Atlantic, CBS, Warner und Capitol. Zusätzlich schickte Joseph persönlich ein solches Promotion-Päckchen an Motown Records in Detroit, an Mr. Berry Gordy höchstpersönlich adressiert; er hoffte, damit an Gladys Knights Empfehlung anzuknüpfen. Zu Mutter sagte er immer wieder: „Ich werde die Jungs bei Motown unterbringen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue!“
Viele Wochen später, als wir theoretisch immer noch bei Steeltown Records unter Vertrag standen, kam Joseph mit einem Umschlag herein, und als er ihn öffnete, rutschte unser Demoband auf den Tisch … abgelehnt und zurückgeschickt von Motown.
Das Beste an den Auftritten in den Clubs des sogenannten Chitlin’ Circuits war das aufregende Gefühl, dass wir ständig im Schatten der ganz Großen unterwegs waren. Wir hatten schon in der Garderobe von Gladys Knight gesessen und auf derselben Bühne gestanden wie die Delfonics, die Coasters, die Four Tops und die Impressions. Im Regal Theater in Chicago kam es dann zu zwei weiteren, sehr bewegenden Treffen.
So lernten wir zum Beispiel Smokey Robinson kennen. Heute weiß ich nicht mehr, ob wir darauf warteten, dass Smokey zum Soundcheck auf die Bühne kam, oder ob wir gerade selbst kurz vor unserem Auftritt standen – auf alle Fälle hatte Joseph uns versprochen, dass wir den größten Songwriter aller Zeiten kennenlernen würden, wenn wir eine Weile warteten und ganz brav seien. Das war wirklich einer der wenigen Augenblicke, in denen wir weiche Knie bekamen: Der Gedanke, gleich einem unserer großen Helden vorgestellt zu werden, machte uns nervöser als eine bevorstehende Bühnenshow.
Schließlich kam Smokey tatsächlich auf uns zu und blieb stehen, um sich mit uns zu unterhalten. Wir konnten kaum glauben, dass er sich wirklich Zeit für uns nahm. Aber da war er, in einem schwarzen Rollkragenpullover und schwarzen Hosen, er lächelte breit, schüttelte uns die Hände und fragte, wer wir seien und was wir machten. Michael war immer sehr daran interessiert, wie andere Künstler an ihre Musik herangingen, und er bestürmte Smokey mit Fragen. Wie schreiben Sie Ihre Songs? Wann fallen Ihnen denn all diese Melodien ein? An die Antworten kann ich mich heute nicht mehr erinnern, aber ich bin sicher, dass Michael sie sich genau einprägte. Smokey sprach gute fünf Minuten mit uns. Und worüber redeten wir, nachdem er sich verabschiedet hatte? Über seine Hände. „Habt ihr gemerkt, wie weich seine Hände waren?“, flüsterte Michael.
„Ist doch kein Wunder“, sagte ich. „Der hat doch nie was anderes getan, als Songs zu schreiben.“
„Sie waren weicher als Mutters Hände!“, staunte Michael.
Als wir wieder zu Hause in Gary waren, war das auch prompt das Erste, was wir Mutter berichteten. „Mutter! Wir haben Smokey Robinson getroffen, und du glaubst nicht, was der für weiche Hände hat!“
Als wir schließlich auch Jackie Wilson kennenlernen durften, erreichten wir damit die nächste VIP-Ebene: Er lud uns nämlich in seine heilige Garderobe ein. Sie war deswegen „heilig“, weil er für uns der schwarze Elvis war, bevor der weiße ins Rampenlicht getreten war – einer der großen Entertainer, wie es sie in jeder Generation nur einmal gibt. Jackie und seine Revue traten regelmäßig im Regal Theater auf, und den ganzen Tag über redeten wir von nichts anderem, als dass wir ihn abends zu Gesicht bekommen würden. Joseph sprach mit ein paar Leuten und setzte alle Hebel in Bewegung, damit es tatsächlich klappte: „Okay! Aber nur fünf Minuten!“ Dieses Privileg hatten wir sicherlich wie so oft dem Umstand zu verdanken, dass wir noch so jung und niedlich waren. Und das muss ich unserem Vater wirklich lassen: er wusste, wie man Türen öffnete.
Wie bei Jackie Wilson. Wir traten im Gänsemarsch aus dem dunklen Korridor in das helle Licht der Glühbirnen rund um den Garderobenspiegel, vor dem Jackie saß. Er hatte uns den Rücken zugewandt, um seinen Hals lag ein zusammengerolltes Handtuch, damit sein weißes Hemd keine Flecken von der Schminke und dem Eyeliner bekam, die er selbst auflegte.
Es war Michael, der zuerst den Mund aufmachte und sehr höflich darum bat, einige Fragen stellen zu dürfen.
„Sicher, Kleiner, immer raus damit“, sagte Jackie zu unseren Spiegelbildern, die er vor sich sah.
Und nun bombardierte Michael ihn mit Fragen. Wie fühlt sich das an, wenn Sie auf die Bühne gehen? Wie oft proben Sie? Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben? Mein Bruder war in seinem Wissensdurst nicht zu stoppen.
Aber es war Joseph, der anschließend mit der interessantesten Information dieses Abends aufwarten konnte: Er berichtete uns, dass einige von Jackie Wilsons Songs tatsächlich von niemand Geringerem als Mr. Gordy, dem Gründer des Motown-Labels, geschrieben worden seien. („Lonely Teardrops“ war Gordys erster Nummer-1-Hit gewesen.)
Nach diesen Treffen war für uns klar: Wir wollten die gleiche Stufe erreichen wie Smokey Robinson und Jackie Wilson. Vielleicht war es das, was Joseph insgeheim beabsichtigt hatte: Indem er uns den Königen vorstellte, bekamen wir selbst Lust zu herrschen. Es war beinahe, als wollte er uns sagen: „Hier könnt ihr auch stehen – aber ihr müsst daran arbeiten.“
Ich wünschte, ich könnte mich an die Showbiz-Weisheiten erinnern, die diese großen Männer mit uns teilten, denn jeder von ihnen hatte gute Ratschläge für uns parat, aber diese Worte sind in meiner Erinnerung längst verblasst. Michael hortete diese kleinen Perlen und prägte sich alle Einzelheiten genau ein. Er wollte stets wissen, wie unsere Vorbilder sprachen, sich bewegten, was sie sagten, ja sogar, wie sich ihre Haut anfühlte und wie sie aussah. Wenn die großen Stars auf der Bühne standen, beobachtete er sie mit dem Scharfblick eines jungen Regisseurs, ganz und gar auf Smokeys Texte oder auf Jackies Füße konzentriert. Später dann, wenn wir mit dem Bus nach Hause fuhren, war er stets von uns allen am muntersten und lautesten: „Habt ihr gehört, wie er gesagt hat …“ – „Ist euch aufgefallen, dass …“ – „Habt ihr gesehen, wie Jackie sich an dieser Stelle bewegt hat …“ Mein Bruder war ein Meister darin, andere zu studieren, und ihm entging nie etwas. Auch die kleinsten Details legte er in einem Ordner in seinem Kopf ab, auf dem vermutlich „Größte Einflüsse und Inspirationen“ stand.
Inzwischen verdienten wir um die 500 Dollar pro Show. Unser Vater drillte uns härter denn je und erwartete äußerste Präzision. „Wir haben das doch schon x-mal geprobt. Wieso vergesst ihr dauernd, was ihr tun müsst?“, brüllte er, wenn ein Song oder eine Tanzeinlage nicht klappen wollte. James Brown, so sagte er uns immer wieder, pflegte seinen Famous Flames ein Strafgeld aufzubrummen, wenn jemand patzte.
Joseph verhängte natürlich keine Strafgelder. Schläge waren eher sein Stil. Marlon traf es am härtesten, weil er als das schwächste Glied in unserer Kette galt. Es stimmt, dass seine Koordination nicht so gut war wie die von uns anderen, und er musste sich zehnmal mehr anstrengen, um alles richtig hinzubekommen, aber von uns war trotzdem niemand der Ansicht, dass er uns bei den Auftritten behinderte. Und dennoch, Joseph benutzte Marlon immer wieder als Sündenbock, um Extra-Proben anzusetzen oder uns noch länger im Haus zu halten. Die wahren Gründe dafür waren ganz andere, aber das dämmerte uns erst viel später.
Als es Marlon einmal wieder nicht gelang, sich einen Tanzschritt richtig einzuprägen, riss Joseph der Geduldsfaden. Er befahl Marlon, rauszugehen und eine „Rute“, einen dünnen Ast, vom Baum draußen abzuschneiden. Wir sahen zu, wie Marlon den Stecken aussuchte, mit dem ihn Joseph, wie wir wussten, verprügeln würde – ausgerechnet von jenem Baum, der ihm zufolge unsere Familie und unsere Einheit symbolisieren sollte. „Wenn du etwas vergisst“, brüllte Joseph, „dann hängt Sieg oder Niederlage davon ab!“ Damit zog er Marlon die Rute hinten über die Oberschenkel. Michael rannte weinend davon; er konnte das nicht mit ansehen.
Der Gedanke an die Rute ließ uns alle mit noch mehr Konzentration an die Proben herangehen, aber trotzdem patzte Marlon doch immer wieder einmal. „Junge! Geh raus und hol eine Rute!“ Marlon versuchte nun schlau zu sein, er ließ sich Zeit, um den dünnsten, schwächsten Zweig zu finden, damit es nicht so wehtat. „Nein! Du gehst wieder raus und holst einen dickeren!“, befahl Joseph. Bald lernte Marlon, lauter zu schreien, als die Schläge es eigentlich rechtfertigten, denn so war die Strafaktion schneller vorbei.
Marlon bekam allerdings nicht mit, dass Joseph ernsthaft darüber nachdachte, aus den Jackson 5 die Jackson 4 zu machen.
„Er schafft es nicht, er tanzt verkehrt und singt falsch, und er ruiniert unsere Chancen!“, versuchte er Mutter zu erklären. Aber sie wollte um keinen Preis zulassen, dass Marlon aus der Gruppe geworfen wurde und sein Leben lang unter dieser Demütigung litt. Sie wusste ihre Sache gut zu vertreten, und Marlon blieb Teil der Band.
Eins muss ohnehin über Marlon gesagt werden: Er ist der Hartnäckigste von uns allen. Er kannte seine Grenzen, und trotzdem versuchte er immer wieder, sie zu überwinden. Wenn wir eine Pause machten, arbeitete er weiter. Er nutzte sogar den Schulweg zum Üben. Wir Brüder gingen gemeinsam zur Schule, und immer wieder löste sich Marlon von uns, tanzte auf dem Bürgersteig, ging seine Schritte durch, steppte zur Seite.
Wenn wir schlafen gingen, hörten wir Michael, wie er Marlon immer wieder beruhigte: „Du machst das prima, du schaffst das schon, mach einfach nur weiter.“ In der Schule nutzte Michael die Pausen, um Marlon beizubringen, wie man sich auf der Stelle drehte oder bestimmte Bewegungen machte. Weil wir alle die Filme von Bruce Lee großartig fanden, hatte jeder von uns seinen eigenen Nunchaku, diese zwei mit einer Kette verbundenen Stöcke, die in einigen asiatischen Kampfsportarten verwendet werden. Michael nahm sie mit zur Schule (damals brachten Kinder noch keine Waffen mit zur Schule, um sich gegenseitig zu bedrohen, und daher war so etwas damals noch nicht verboten), und er und Marlon nutzten die Nunchaku-Techniken, um besonders geschmeidige, fließende, elegante Bewegungen zu trainieren. Ich denke, dass Marlon gerade deswegen später ein so herausragender Tänzer wurde, weil er so viel außer der Reihe übte. Für Michael war es allerdings besonders hart, dass es seine eigenen Fähigkeiten waren, die Joseph als Maßstab für das Können seines Bruders anlegte. Und vor allem hasste er es, dass dieser gnadenlose Blick unseres Zuchtmeisters stets Zweifel säte: „War das gut genug? War es das, was er wollte? Habe ich einen Fehler gemacht?“ Hier lag die Wurzel für die heftigen Selbstzweifel, die jeden von uns später quälten und uns dazu brachten, immer wieder genau zu hinterfragen, ob unser Bestes wirklich unser Bestes gewesen ist.
Vielleicht war es die Verbitterung über diese Härte, die Michael schließlich rebellieren ließ. Wenn Joseph ihm bei den Proben sagte, er solle einen bestimmten Schritt machen oder eine neue Bewegung ausprobieren, dann weigerte sich mein Bruder, der inzwischen ohnehin einen Improvisationsstil entwickelt hatte und ohne Anleitung zurechtkam. Mit neun Jahren hatte er sich von einem gehorsamen Kind, das bereitwillig alles tat, was man ihm auftrug, zu einem störrischen Jungen mit erstaunlichem Selbstbewusstsein entwickelt. „Jetzt mach schon, Michael“, sagte Joseph mit hartem Blick, „sonst gibt’s Ärger.“
„Nein!“
„Ich sag’s dir nicht noch einmal.“
„Nein – ich will nach draußen zum Spielen!“
Michael begehrte schließlich gegen jede Form von Befehl auf, und er reizte seinen Spielraum viel weiter aus, als wir anderen uns das getraut hätten. Das führte natürlich unweigerlich dazu, dass auch er die Rute zu spüren bekam. Immer wieder stand er unter dem Baum, weinte und suchte möglichst langsam einen geeigneten Zweig aus, um noch ein wenig Zeit zu schinden. Die Rute war auch mir nicht fremd; ich erinnere mich, dass ich einmal geschlagen wurde, weil ich irgendeine Hausarbeit nicht erledigt hatte. Aber Marlon und Michael bekamen sie am meisten zu spüren. Der eine, weil er Fehler machte, und der andere, weil er nicht gehorchen wollte.
Manchmal versuchte Mutter Joseph zu bremsen, weil er es ihrer Meinung nach mit den Strafen übertrieb. „Hör auf, Joseph, hör auf!“, flehte sie und versuchte ihn zur Vernunft zu bringen, wenn er wieder einmal rot sah.
Nach und nach erkannte Joseph jedoch selbst, dass dieses Züchtigungsinstrument kontraproduktiv war, weil es dazu führte, dass Michael sich verkroch. Er verbarrikadierte sich im Kinderzimmer oder versteckte sich unter dem Bett und weigerte sich, herauszukommen, und all das ging von unserer kostbaren Übungszeit ab. Einmal schrie er Joseph ins Gesicht, dass er nie wieder einen Ton singen werde, wenn er ihn noch einmal anfasse. Es war dann an uns, den älteren Brüdern, ihn zu beruhigen und ihn mit Süßigkeiten zu bestechen, doch weiterzumachen: Es war erstaunlich, was sich bei ihm erreichen ließ, wenn man ihm einen Jawbreaker in Aussicht stellte – eines dieser besonders harten Bonbons, das beim Lutschen verschiedenfarbige, manchmal auch verschieden schmeckende Schichten offenbarte.
Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Michael auch ein Junge war, der anderen gern Streiche spielte. Es gab also nicht nur Tränen und Theater in unserem Leben. Aus der Comedy-Sendung mit den drei Stooges hatte er sich abgeguckt, wie man herumblödelte und andere zum Lachen brachte. Das liebte er. Er schnitt gern Gesichter, riss die Augen groß auf, blies die Backen auf und schürzte die Lippen, vor allem dann, wenn jemand gerade ganz ernsthaft sprach. Einmal hielt mir Joseph einen Vortrag, weil ich irgendetwas nicht erledigt hatte. Es war nicht so schlimm, dass ich deswegen Prügel kassiert hätte, aber ich musste mir eine ziemlich Standpauke gefallen lassen. Während unser Vater mit zornesrotem Gesicht vor mir stand, entdeckte ich plötzlich Michael hinter ihm, wie er diese Grimasse zog. Ich versuchte mich auf Joseph zu konzentrieren, aber nun steckte sich Michael auch noch beide Finger in die Ohren, und damit hatte er mich. Unwillkürlich musste ich grinsen. „Junge!“, donnerte Joseph. „Lachst du etwa über mich?“ Michael war in diesem Augenblick natürlich schon wieder in unser Zimmer verschwunden.
Er und Marlon hatten sich sogar einen Spitznamen für Joseph einfallen lassen: Eimerkopf. So nannten sie ihn natürlich nur hinter seinem Rücken; wenn er dann gerade zufällig des Weges kam, brachen sie in lautes Kichern aus. Wir nannten ihn aber auch „der Falke“, weil er sich immer einbildete, dass er alles sah und wusste. Das war der einzige Spitzname, den wir ihm jemals verrieten. Der gefiel ihm – er hörte sich respektvoll an.
Josephs Jähzorn und sein harter Erziehungsstil werden heute sicherlich kaum noch Unterstützung finden, aber im Laufe meiner Jugend begann ich zu verstehen, welche Überlegung hinter den Schlägen steckte. Zunächst war uns überhaupt nicht bewusst, was für große Sorgen es unseren Eltern bereitete, dass der Einfluss gewalttätiger Banden Mitte der Sechzigerjahre enorm wuchs und sich in der Nähe viele Jugendgangs gründeten. Die Polizei im Bundesstaat Indiana richtete ein eigenes Dezernat für Bandenkriminalität ein; an der Schule kursierten Gerüchte, dass in unserem Viertel mit Automatikwaffen geschossen werde und das FBI die Nachbarschaft überwache. In Chicago wurden in einer Woche 16 Jugendliche von Kugeln getroffen, zwei davon tödlich.
Im Regal Theater ging das Management so weit, uniformierte Polizisten dazu anzuheuern, damit sie in der Lobby und vor den Ticketschaltern patrouillierten, weil Gangs die Gegend unsicher machten. Diese Geschichten kamen natürlich auch den Vätern im Stahlwerk zu Ohren. Joseph war nicht nur fest entschlossen, dass wir unser Leben nicht in der Fabrik vergeuden sollten, er wollte auch um jeden Preis verhindern, dass wir uns mit den Gangs einließen – und damit womöglich unseren (und seinen) Traum ruinierten. 1970 sagte er in einem Zeitungsinterview: „In unserem Viertel kamen viele Kids auf die schiefe Bahn, und wir waren der Ansicht, dass es für die Familie sehr wichtig sei, andere Beschäftigungen für unsere Kinder zu finden, um sie von der Straße und den Versuchungen der modernen Zeit fernzuhalten.“
Die Anwerber der Gangs stürzten sich vor allem auf Jugendliche, die leicht zu beeindrucken waren (und das waren wir alle). In einer Stadt mit hoher Scheidungsrate, in denen Kinder vielfach keinen Respekt vor ihren Vätern hatten, bot die Zugehörigkeit zu einer Gang eine Art Ersatzfamilie und die Möglichkeit, sich die Liebe seiner „Brüder“ zu verdienen. Genau davor hatte Joseph Angst, und natürlich auch davor, dass uns etwas Schlimmes zustoßen würde. Seine Sorgen bekamen neue Nahrung, als Tito auf dem Weg von der Schule abgepasst und mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, sein Essensgeld herauszugeben. Wir erfuhren davon, als er ins Haus gestürmt kam und schrie, ein anderer Junge habe versucht, ihn umzubringen.
Joseph traf nun seine eigenen Maßnahmen. Zum einen sorgte er dafür, dass wir eine Aufgabe hatten, nämlich die ständigen Proben. Dadurch waren wir gezwungen, sofort nach der Schule nach Hause zu kommen, und hatten keine Zeit, draußen zu spielen. Und zum anderen wurde Joseph zu einem Menschen, den wir mehr fürchteten als alles andere. Indem er sich zum Haustyrannen entwickelte, verhinderte er, dass wir uns von den Tyrannen der Straße einschüchtern ließen. Das funktionierte auch; wir hatten vor ihm wesentlich mehr Angst als vor irgendwelchen Gang-Mitgliedern. Michael hat einmal gesagt, dass Joseph am Anfang recht viel Geduld mit uns hatte, später dann aber immer strenger wurde, und das geschah just zu der Zeit, als die Gang-Kriminalität immer weiter anstieg. Während unserer Kindheit wurden wir dazu angehalten, mit unseren Geschwistern zu spielen; nie durften wir bei irgendwelchen Freunden übernachten. Außer Bernard Gross und Johnny Ray Nelson von nebenan kannten wir andere Kinder eigentlich nur aus der Schule.
„Die Außenwelt hereinlassen“, wie Mutter das nannte, brachte einige Gefahren mit sich, weil niemand wissen konnte, was ein Kind aus einer anderen Familie an schlechten Gedanken, schlechten Angewohnheiten und häuslichem Ärger mit sich bringen mochte. „Eure besten Freunde sind eure Brüder“, pflegte sie zu sagen.
Nach unserem Verständnis waren „Außenstehende“ allesamt Menschen, denen nicht recht zu trauen war, und wenn man so aufwächst, dann gibt es darauf nur zwei Reaktionsmöglichkeiten: Man wird entweder sehr vorsichtig und misstraut jedem, der nicht zur Familie gehört, oder man verfällt ins andere Extrem und lässt jeden an sich heran, um die Einschränkungen der Vergangenheit zu vergessen.
Nachdem die Bedrohung durch die Gangs immer mehr zum Problem wurde, hielten unsere Eltern uns noch mehr im Haus; wir wurden sogar für den letzten Tag im Schuljahr entschuldigt, weil das traditionell der Termin war, an dem unter den Kindern Rechnungen beglichen wurden. Joseph dachte darüber nach, mit uns nach Seattle zu ziehen, weil es dort angeblich sicherer war. Unter seinem Regime sahen wir zwar vielleicht manchmal Sterne, wenn er unsere Hinterteile mit einem Ledergürtel, der Rute oder manchmal auch dem kaputten Kabel des Bügeleisens verdrosch, aber Messer, Schusswaffen, Schlagringe, Polizeiwachen oder die Notaufnahmen der Krankenhäuser blieben uns erspart. Joseph tat vermutlich, was er im Licht der damaligen Zeit und der damaligen Umstände für das Beste hielt.
Tito und ich nahmen auf dem Weg zu unserer neuen Schule, der Beckman Middle, oft eine Abkürzung über ein Stück unbebautes Land, das sich zwischen unserem Haus und der Delaney-Siedlung befand, wo sich die Gangs zusammenrotteten. Eines Tages sahen wir einen Polizisten, der neben einem großen Blutfleck stand, der sich im Schnee ausgebreitet hatte. Wir fragten, was passiert sei, und bekamen zur Antwort, dass wir das wohl nicht wirklich wissen wollten. Aber wie Kinder nun einmal sind, ließen wir ihm keine Ruhe. Also bot er uns ein ungewöhnliches Wort an, um der Sache die Härte zu nehmen. Zu Hause fragten wir, was „enthauptet“ bedeutete. Jemand war „enthauptet“ worden. Mutter war völlig entsetzt, ebenso wie ein paar Wochen später, als ich ihr erklärte, dass mein neuer Schulweg gar nicht so übel sei; die Gang-Mitglieder waren wirklich freundlich und winkten, weil wir als Jackson 5 einigen Respekt genossen. „Diese Jungs sind nicht gut, Jermaine. Du hast gehört, was dein Vater gesagt hat – halte dich von ihnen fern.“ Also wurde der Weg zur Schule durch die Delaney-Siedlung mit ihren Wäscheleinen, den verstreut herumliegenden Spielsachen und ausgeweideten Autowracks ein Spießrutenlaufen mit gesenktem Kopf, bei dem wir versuchten, jeglichen Blickkontakt mit anderen zu vermeiden.
Aber dann rückten die Gangs und ihre Kämpfe immer weiter an unsere Straße heran. Von unserem Wohnzimmerfenster aus bekamen wir drei üble Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden mit. Als die Gangs sich näherten – eine kam die 23. Avenue herunter, die andere die Jackson Street –, schrie Mutter, wir sollten sofort alle ins Haus kommen und die Türen und Fenster schließen. Unsere fünf kleinen Köpfe sahen vermutlich aus wie Orgelpfeifen mit Afro, als wir aufgereiht am Fenster standen und das Geschehen zu beobachten versuchten.
Einmal liefen die Dinge völlig aus dem Ruder. Zwei Gangs hatten sich ausgerechnet an unserer Straßenecke zu einem Kampf verabredet, und in der Schule war schon viel über diesen Showdown geredet worden. An besagtem Tag wurden wir wieder im Haus eingeschlossen, und als wir lautes Geschrei hörten, wussten wir, dass die Kontrahenten ganz in der Nähe sein mussten. Und dann ertönte ein Knall, ein Schuss. Wir machten lange Hälse. „Runter! Alle runter!“, brüllte Joseph. Die ganze Familie warf sich auf den Boden. Rebbie, La Toya, Michael und Randy schrien und weinten, Joseph hatte die Wange auf den Teppich gepresst und die Augen weit aufgerissen. Es wurden wohl noch zwei weitere Schüsse abgefeuert, und wir blieben eine Viertelstunde regungslos liegen, bevor Joseph vorsichtig prüfte, ob die Luft rein war. „Versteht ihr jetzt, was ich euch immer gesagt habe?“, fragte er.
Diese Geschichte erklärt vielleicht die Inspiration zu Michaels Hit „Beat It“ von 1985 – und das Video, das damit beginnt, dass von zwei Seiten Gangs heranmarschieren, bis er in die Mitte springt und sie im Tanz vereint.
Oprah Winfrey fragte unseren Vater 2010, ob er es bedauere, wie er uns damals „behandelte“ – es hörte sich an, als habe er in Guantanamo Waterboarding praktiziert. So eine Frage lässt sich heute, in einer ganz anderen Zeit, leicht mit diesem verurteilenden Unterton stellen, aber hätte Oprah sich 1965 so geäußert, in einer schwarzen Community, die von Bandenkriegen erschüttert wurde, dann wäre sie es gewesen, die schief angesehen worden wäre, und nicht Joseph. Damals war es eben so. Joseph war ein harter Kerl, der mehr zum Manager taugte als zum Vater, mit einem stahlummantelten Herz, aber seine Entschlossenheit resultierte aus den besten Motiven. Der Einzige, der das je bedauerte, war Michael. Er hatte sich eher den Vater gewünscht, der jedoch vielfach durch Abwesenheit glänzte, als den stets präsenten Manager. Aber eine Sache lässt sich nicht bestreiten: Unser Vater hat neun Kinder in einem von Kriminalität, Drogenmissbrauch und Bandenkriegen geprägten Viertel großgezogen und sie zu erfolgreichen Künstlern gemacht, ohne dass eines von ihnen auf die schiefe Bahn geriet.
Bevor ich Recherchen für dieses Buch anstellte, hatte ich gar nicht richtig mitbekommen, wie viel Unsinn über Josephs Strenge geschrieben worden ist: Es hieß, er habe Michael einmal eine ungeladene Pistole an den Kopf gehalten, er habe ihn, obwohl er Angst hatte, in einem Wandschrank eingeschlossen, er sei ihm im Dunkeln, mit Küchenmessern bewaffnet, entgegengesprungen, weil er es angeblich liebte, seine Kinder zu erschrecken, er habe Michael brutal in einen Stapel Instrumente geschubst, und einmal habe Michael über La Toya hinwegsteigen müssen, als er sich die Zähne putzen sollte, weil sie von Joseph ausgeknockt auf dem Badezimmerfußboden lag. Es ist leider eine traurige Wahrheit, dass Geschichten über Prominente, wenn sie nicht offiziell bestritten oder gerichtlich verfolgt werden, von Außenstehenden immer weiter ausgeschmückt werden, bis aus einem Gerücht irgendwann ein Faktum geworden ist. Weil ich dafür eintrat, Josephs Verhalten im Kontext zu betrachten, warf man mir vor, mit seiner Haltung zu sympathisieren oder sie zu entschuldigen, aber ich war wirklich dabei und weiß die Sache einzuschätzen. Ich habe gesehen, was wirklich geschah, und das passt nicht zu der Darstellung meines Vaters als Monster.
Die Leute zitieren mir gegenüber gern Michaels Fernsehinterview mit Oprah Winfrey von 1993 oder die Dokumentation des Journalisten Martin Bashir von 2003. Sie haben gehört, dass Michael übel wurde oder er in Ohnmacht fiel, wenn er an Joseph dachte, dass Joseph mich fertigmachte und Michael regelrecht prügelte oder schlug, dass unser Vater grausam war oder gemein und dass es Michael zufolge „schlimm war … richtig schlimm“. Das alles stimmt. Man kann nicht leugnen, dass Michael höllische Angst vor unserem Vater hatte und dass diese Angst irgendwann in Abneigung umschlug. Es war 1984, glaube ich, als er mich eines Tages einmal ansah und mich fragte: „Würdest du weinen, wenn Joseph tot wäre?“
„Ja“, antwortete ich, und es schien ihn zu überraschen, wie sicher ich mir war.
„Ich weiß nicht, ob ich es täte“, sagte er.
Michael war der sensibelste von uns Brüdern, der zerbrechlichste, und ihm war Josephs Art am meisten fremd. Seinem jungen Verstand erschien Josephs Vorgehensweise nicht als streng, sondern als lieblos. Das verstärkte sich noch, als er nach dem Umzug nach Kalifornien seinen neuen Freunden (jungen wie alten) erzählte, was Joseph getan hatte, und die allesamt schockiert und entsetzt reagierten. „Das ist Kindesmisshandlung, Michael“, sagten sie. „Das darf er nicht mit dir machen. Du kannst ihn deswegen bei der Polizei anzeigen!“ Falls Michael es vorher nicht sowieso schon genauso gesehen hatte, dann tat er es spätestens ab jetzt. Joseph hatte ein enormes Problem damit, seinen Jähzorn in Schach zu halten, und niemand von uns würde seine Kinder heute noch auf diese Weise bestrafen. Aber wenn er uns wirklich misshandelt hätte, dann würde heute niemand von uns mehr mit ihm sprechen. Michael hatte über lange Jahre den Kontakt abgebrochen, aber das änderte sich während der Proben für das „This Is It“-Konzert 2009. Er hatte Joseph verziehen und hielt nicht mehr daran fest, dass wir von Joseph „misshandelt“ worden seien.
2001 hielt Michael vor Studenten der Universität Oxford eine Rede über Eltern und Kinder. Die Worte, die er damals fand, haben bis heute ihre Gültigkeit: „Heute betrachte ich die Härte meines Vaters als Liebe, eine unperfekte Liebe zwar, aber eben trotzdem Liebe. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, mich gesegnet zu fühlen. An die Stelle des Zorns ist bei mir nun Vergebung getreten … Versöhnung … und Vergebung. Vor fast zehn Jahren habe ich eine Stiftung namens Heal The World gegründet. Um die Welt zu heilen, müssen wir uns zuerst selbst heilen. Und um Kinder zu heilen, müssen wir zunächst das innere Kind in uns allen heilen. Deswegen möchte ich meinem Vater vergeben und aufhören, ihn zu verurteilen. Ich möchte frei sein, um für den Rest meines Lebens eine neue Beziehung zu meinem Vater aufzubauen, die nicht von den Kreaturen der Vergangenheit beherrscht wird …“
Auch wenn Michael später oft erzählte, wie viel Angst er vor Joseph gehabt habe – er trieb die Dinge gern auf die Spitze. Zwischen seinem sechsten und zehnten Lebensjahr trieb ihn sein Verlangen nach Süßigkeiten zu Taten, die in seiner Welt dem Versuch gleichkamen, in die Höhle des großen bösen schlafenden Bären zu schleichen. Jeden Morgen vor der Schule, wenn Joseph nach einer Wechselschicht noch schlief, schickten wir Michael ins Schlafzimmer, damit er in den Taschen von Josephs Hosen, die auf dem Boden lagen, nach Münzen angelte.
Jackie, Tito, Marlon und ich standen dicht an die Wand gedrückt da, ermahnten uns gegenseitig zum Stillsein und versuchten nicht zu lachen, wenn Michael langsam über den Boden durch die leicht geöffnete Tür in die Dunkelheit kroch. Ich hielt Wache und achtete darauf, ob sich der große Berg unter den Laken rührte. Und schnell war Michael wieder draußen, hielt triumphierend etwas Kleingeld hoch, und dann rannten wir aus dem Haus und kreischten vor Vergnügen, weil uns wieder einmal ein guter Coup geglückt war. Manchmal brachten unsere Raubzüge nur eine enttäuschende Sammlung von Cents zutage, aber manchmal war auch ein bisschen mehr zu holen, und es waren ein paar Vierteldollar dabei.
Während unserer Kindheit hielten wir uns für die mutigsten Kinder überhaupt, bis Mutter uns später einmal verriet, dass sie und Joseph im Bett lagen, sich mit offenen Augen ansahen, die Augenbrauen hoben und lächelten, wenn sie Michael hereinkriechen hörten …
Michaels Lust auf Süßes führte schließlich zu dem einen entsetzlichen Augenblick, von dem er später sagte, dass für ihn kurz die Welt stillstand. Es war Winter, und es lag dicker Schnee. Er hatte keine Lust gehabt, selbst in die Kälte hinauszugehen, und daher Marlon überredet, für ihn loszuziehen und Kaugummi zu kaufen.
Wenig später, als wir drinnen spielten und Mutter in der Küche war, trommelte ein Nachbarskind an die Tür und schrie: „Marlon ist tot!“ Er war von einem Auto erfasst worden.
Mutter rannte nach draußen und kreischte: „Wo?! Wo?!“
Ich stand auf dem Gartenweg und sah ihr nach, wie sie durch den Schnee die Straße entlanglief. Hinter mir stand Michael, der, von Schuldgefühlen überwältigt, wie angewurzelt an der Schwelle verharrte. „Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe ihn zum Kaugummikaufen geschickt … Erms, das alles ist meine Schuld.“
Ein Auto war auf der schneeglatten Straße ins Schleudern gekommen und hatte Marlon verletzt. Er lag noch unter der Stoßstange des Wagens auf der Straße, als Mutter ihn fand; einige Leute aus der Straße hatten sich bereits um ihn gekümmert. Er hatte Kopfverletzungen davongetragen und kam ins Krankenhaus, wo er einige Tage blieb. Als Mutter nach Hause kam und sagte, dass er wieder gesund werden würde, brach Michael vor Erleichterung in Tränen aus. Er war restlos überzeugt gewesen, dass sein Bruder tot sei, nur seinetwegen und dass er deswegen später als Strafe nicht in Gottes Paradies kommen werde.
Diese Überlegung wurzelte darin, dass bei uns zu Hause die Lehren des Königreichsaals ebenso viel Gewicht hatten wie die Lehren der Unterhaltungsbranche. Die Ironie dieser Kombination wurde uns gar nicht bewusst. Als Kinder stellten wir nichts in Frage: Ich glaube, das haben wir nie gelernt. Michael glaubte es, wenn die Ältesten predigten, dass nur 144 000 Menschen von Jehova gerettet und nach dem Armageddon in ein neues Paradies gebracht würden. Wieso nur 144 000 von den vier Millionen praktizierenden Zeugen Jehovas, die es in den USA gab? Wir fragten nie. Der Einfluss Jehovas war eine Konstante des Lebens in der Jackson Street 2300, der vielleicht nie genug Gewicht beigemessen worden ist: Es war eine Doktrin, die Michael konditionierte und die uns ebenso dazu brachte, uns sklavisch an Regeln zu halten, wie Josephs unnachgiebige Strenge.
Gott war stets in unserem Haus zugegen, aber Jehova zog richtig ein, als Michael zwei Jahre alt war, kurz bevor Mutter mit Randy schwanger wurde. Sie war als Christin erzogen worden und kam aus einer Familie, die den Baptisten eng verbunden war, aber 1960 ereigneten sich zwei entscheidende Ereignisse: Erst wurde ruchbar, dass ein Pastor der Lutherischen Kirche von Gary, den Mutter sehr respektierte, eine Affäre hatte und damit sein Versprechen an Gott gebrochen hatte, und während Mutter noch mit dieser schweren spirituellen Enttäuschung kämpfte, klopfte dann eine praktizierende Zeugin Jehovas, eine Freundin namens Beverly Brown, an unsere Tür. Und das war der Augenblick, da Weihnachten und Geburtstage aus unserem Haus verschwanden. Mutter sagt zwar, dass ich mich doch daran erinnern „muss“, dass wir einen Weihnachtsbaum hatten und ich Geschenke bekam, bevor ich sechs wurde, aber mir fällt nichts dazu ein.
Nach ihrer Konversion war der einzige „besondere Tag“ der obligatorische Besuch des örtlichen Königreichsaals an Mutters Seite. Es oblag ihrer Verantwortung, uns die Liebe Gottes aufzuzeigen. Joseph begleitete uns selten, wenn wir uns unsere gebrauchten „guten“ Hosen, Jacken und Schlipse anzogen, um brav auf den Stühlen zu sitzen und zum Stillsein ermahnt zu werden, wenn wir herumrutschten, maulten oder mit den Füßen wippten. Nur die Hymnen ließen die ganze Sache ein kleines Bisschen lebendig erscheinen.
Mutter sorgte dafür, dass wir uns Zeit zum Bibelstudium nahmen. Das Alte und das Neue Testament und die wichtigsten Schriften der Glaubensgemeinschaft wie der Wachtturm oder Vom verlorenen Paradies zum wiedererlangten Paradies lagen stets auf dem Wohnzimmertisch parat. Mutter bekam Gesellschaft von anderen Zeugen Jehovas, um aus den Schriften vorzulesen, während Jackie, Tito, Marlon, Michael und ich uns auf dem Sofa zusammenquetschten, die Mädchen zu unseren Füßen, mit je einer Bibel auf dem Schoß und einem Bleistift in der Hand, um Passagen zu unterstreichen, die bei der nächsten Predigt zur Sprache kommen sollten. Rebbie konnte es nicht erwarten, Mutter bei der Missionsarbeit zu helfen, also von Tür zu Tür zu gehen und Jehovas Botschaft zu verkünden. Wenn wir hinter Mutter herstiefelten, von einer Tür in der Nachbarschaft zur nächsten, lernten wir vor allem etwas über Entschlossenheit, wenn auch vielleicht sonst nicht viel.
Ich sah, wie die Vorhänge zuckten, und zählte dann die Sekunden, bis Mutter wieder einmal die Tür vor der Nase zugeknallt wurde. Derartige Ablehnung machte ihr jedoch nichts aus – sie diente Jehova. Heute noch ist sie mit missionarischem Eifer in seinem Namen unterwegs. Die einzige Lektion, die sich aus den Bibelstudien in unseren Köpfen einprägte, war, dass wir in die Hölle kommen würden, wenn wir nicht Jehova dienten und brav in den Königreichsaal gingen. Der Tag unseres Jüngsten Gerichts war Armageddon, an dem alles Böse zerstört und eine neue Welt für die 144 000 Auserwählten geschaffen werden würde. Ob wir dabei gerettet würden, hing von unserer Ergebenheit ab.
Für den Fall, dass unser junger Verstand nicht genug Phantasie für das Weltuntergangsszenario aufbrachte, war im Wachtturm anschaulich dargestellt, wie es an Armageddon aussehen würde. Ich erinnere mich daran, wie ich eines der Heftchen mit Michael durchblätterte und wir die drastischen Illustrationen implodierender Gebäude betrachteten, zwischen denen Menschen in die tiefen Risse stürzten, die sich im Boden auftaten, und dabei verzweifelt und um Errettung flehend die Arme ausstreckten. Unsere Ängste wurden immer größer, wenn wir über die Fragen nachdachten, von denen unser Schicksal abhing. Ehrten wir Jehova auch genug? Waren wir gut genug für das Ewige Leben? Würden wir Armageddon überleben? Und wenn wir Ärger mit Joseph bekamen, hieß das automatisch auch, dass uns Jehova strafen würde?
„Ich will ins Paradies kommen!“, erklärte ich, wobei Angst eine größere Triebfeder war als echte Begeisterung.
„Mutter, werden wir errettet?“, fragte Michael.
Mutter antwortete dann, dass es im Leben am allerwichtigsten sei, gut zu sein, auch zu anderen: Errettet würden jene, die den Glauben bewahrten, missionarisch tätig seien und nach dem Wort der Schriften lebten. Als Erwachsener betrachtete Michael die Illustrationen des Wachtturms lediglich als „symbolische Darstellungen“, aber in unserer Kindheit dachten wir voll Angst darüber nach, ob Jehova wohl merken würde, ob wir brav gewesen waren oder nicht. Wie entscheidend war es, dass Michael den Kindern aus der Nachbarschaft so oft Süßigkeiten abgegeben hatte und ich nicht? Mutter hatte dafür immer dieselbe Antwort: „Keine Sorge, Er sieht alles.“
Und dann war da der bevorstehende Weltuntergang. Wann würde es so weit sein? Nächste Woche? Wie viel Zeit hatten wir noch? Ein wissbegieriges Kind wie Michael dachte unaufhörlich darüber nach. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er zu einem der Ältesten aufsah und eine ernsthafte Frage stellte, und wie man ihm dann den Kopf tätschelte und ihn belächelte. Der erste Armageddon war von unserer Glaubensgemeinschaft für 1914 vorausgesagt worden, und als dann nichts passierte, für 1915 … und wie man sieht, warten wir bis heute.
Doch 1963 war wirklich die ganze Familie Jackson überzeugt, dass es nun endgültig so weit sei. Die Russen schienen fest entschlossen, die USA zu bombardieren, Kennedy war ermordet worden, und dann wurde auch noch der mutmaßliche Täter, Lee Harvey Oswald, erschossen – ein Ereignis, das wir auf unserem Schwarzweißfernseher genau verfolgten. Wir waren felsenfest der Überzeugung, dass all dies das Ende der Welt ankündigte, und wir Brüder waren plötzlich richtiggehend wild darauf, regelmäßig in den Königreichsaal zu gehen und Jehova zu ehren.
Michael sagte immer, er sei im Sinne der Bibel erzogen worden. Tatsächlich war er als Einziger der Jackson 5 getauft. Michael betete, ich nicht. Michael las in der Bibel, ich nicht. Ich wollte nicht, dass Jehova der Allvater war, weil man uns glauben ließ, dass er sich von uns abwenden werde, wenn wir uns nicht gut benähmen. Die Drohung des Verstoßenwerdens, des „Gemeinschaftsentzugs“, stand uns stets vor Augen. Michael sollte später erfahren, wie sich der Verstoß durch Jehova anfühlte, aber während seiner Kindheit war schon allein die Androhung einer solchen Ächtung erschreckend genug.
Mit dem wachsenden Erfolg der Jackson 5 wurde der Glaube für Michael immer mehr zum Fundament seines Lebens, zu einem Fels, an den er sich klammern, zu einem Ort, an den er sich zurückziehen konnte, denn hier wurde er nicht als berühmter Star, sondern als Gleicher unter Gleichen betrachtet. Die Zeugen Jehovas machten nie viel Aufhebens um Michael, schlicht und ergreifend, weil ihre Religion das nicht zuließ; für sie gab es nur Jehova. Der Königreichsaal brachte ihm die Normalität, die ihm in der Welt draußen zunehmend verlorenging. Michael war fest entschlossen, nach Höherem zu streben. Ich weiß, dass er sich Gott anvertraute und dass er Seine Gegenwart um sich spürte; dass er Ihn als eine Instanz anerkannte, vor der er nichts verbergen und die er nicht belügen konnte. In späteren Jahren gestand er mir, dass er sich immer noch ein klein wenig schuldig fühle, wenn er Geburtstage und Weihnachten feiere.
Der stets wachsame Jehova und die Entschlossenheit unserer Eltern, uns notfalls mit Gewalt vor der Bandenkriminalität vor unserer Haustür zu schützen, führten schließlich dazu, dass wir es nie lernten, soziale Kontakte zu anderen Menschen außer unseren Geschwistern aufzubauen. Selbst im familiären Rahmen gab es keine größeren Zusammenkünfte, weil festliche Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Thanksgiving fehlten. In unserer Kindheit wandelten wir auf einem schmalen Grat, um einerseits Josephs Erwartungen zu erfüllen und andererseits unsere Rettung durch Jehova nicht zu verspielen. Die Bühne war der einzige Ort, an dem es keine Regeln gab. Sie wurde zum einzigen Bereich in unserem Leben, in dem wir wirklich frei waren.
Damals glaubten wir, gar keine größere Bühne bekommen zu können als jene, die uns der Talkshowmaster David Frost dann unversehens anbot. Einer seiner Produzenten hatte bei unserem Auftritt im Apollo im Publikum gesessen und später Richard Aarons angerufen, um einen Gig in der David Frost Show zu vereinbaren, die in New York aufgezeichnet und in ganz Amerika ausgestrahlt wurde. Ein paar Nächte lang hüpften wir aufgeregt in unseren Etagenbetten herum und konnten vor Erwartung und Nervosität nicht einschlafen. In der Schule erzählten wir allen, dass wir im Fernsehen zu sehen sein würden, und auch die Lehrer gaben das in der Klasse bekannt.
David Frost war ein Talkmaster aus England, der im Zuge der „British Invasion“ in die USA gekommen war. Es gab die Beatles, die Rolling Stones und David Frost, und ausgerechnet dem waren wir tatsächlich aufgefallen.
Wir wussten damals nicht, dass Joseph damit vor einem ziemlichen Dilemma stand. Am 17. Juli 1968 waren wir wieder im Regal Theater aufgetreten, und am selben Abend hatten dort auch Bobby Taylor And The Vancouvers gespielt. Bobby war von uns so beeindruckt, dass er gleich eine Bekannte anrief, die kürzlich ins selbe Apartmenthaus in Detroit gezogen war wie er. Suzanne De Passe war zwar erst 19, hatte aber gerade angefangen, als Kreativ-Assistentin für Berry Gordy bei Motown zu arbeiten, und ehe wir wussten, wie uns geschah, standen wir in Bobbys Wohnzimmer und gaben ihr eine Kostprobe unseres Könnens. Suzanne rief daraufhin bei Mr. Gordy an und schwärmte ihm von den „großartigen Kids“ vor, aber der große Boss zeigte sich immer noch wenig beeindruckt.
„Kids? Ich will nicht schon wieder Kinder unter Vertrag nehmen! Mit Stevie Wonder habe ich schon alle Hände voll zu tun!“ Für ihn waren Minderjährige natürlich immer schwierig, weil so viel organisiert werden musste; das fing schon mit Hauslehrern an. Angeblich hatte er auch bei Diana Ross And The Supremes zunächst sehr verhalten reagiert und gesagt, sie seien zu jung.
Ganz offensichtlich musste Berry Gordy erst noch überzeugt werden – und Suzanne überzeugte ihn. Und deswegen hatte Joseph jetzt ein Problem: Unser Vorspieltermin bei Motown überschnitt sich mit dem Auftritt bei David Frost. Ein Traumauftritt in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehsendung stand der einen, einzigartigen Chance gegenüber. Michael und Marlon waren zunächst am Boden zerstört, als Joseph sich für den Vorspieltermin entschied. Anstatt in einem Fernsehstudio in New York vor Millionen von Fernsehzuschauern zu singen, standen wir im Motown-Hauptquartier, Hitsville USA, und unser Publikum bestand aus einer Handvoll Leuten, darunter Mr. Gordy persönlich. Joseph war klug, als er sich nicht für den schnellen Ruhm im Fernsehen entschied. David Frost konnte uns hinsichtlich eines Plattenvertrags nicht weiterbringen, unser Vorspieltermin hingegen schon.
Und so sangen wir am 23. Juli 1968 vor ausgewählten Motown-Mitarbeitern. Wir konnten sie nicht sehen, weil sie im Dunkeln auf der anderen Seite der Glasscheibe standen, die das Tonstudio vom Mischpultraum trennte; wir bekamen nur mit, dass eine Kamera auf einem Stativ unsere „Probeaufnahme“ aufzeichnete, wie das allgemein üblich war. Unser Programm bestand passenderweise aus „Ain’t Too Proud To Beg“ und „I Wish It Would Rain“ von den Temptations, den Abschluss bildete „Who’s Lovin’ You?“ von Smokey Robinson. Am eigentümlichsten an diesem ganzen Auftritt war die schicksalsschwere Pause, die unserem letzten Ton folgte: Niemand sprach ein Wort.
Michael hielt die Spannung nicht mehr aus. „Na? Wie war das?“, piepste er.
„Michael!“, zischte ich halblaut, weil mir seine unhöfliche Frage peinlich war.
„Das war großartig … sehr gut“, sagte eine Stimme. Aber das war alles, was wir hörten. Erst ein paar Jahre später erfuhren wir, welche Reaktion wir wirklich hervorgerufen hatten, als Mr. Gordy in seinem Vorwort zur Neuauflage von Michaels Autobiografie Moonwalk 2009 schrieb: „Michael sang ‚Who’s Lovin’ You‘ mit der Traurigkeit und Leidenschaft eines Mannes, der sein Leben lang den Blues gehabt und großen Herzschmerz ertragen hatte … So wundervoll Smokey diesen Titel darbot, Michael sang ihn besser. Smokey sagte ich irgendwann: ‚Hey, Mann, ich glaube, er hat dich echt in den Schatten gestellt!‘“
Zwei Tage später kam der Anruf aus Detroit. Motown wollte uns unter Vertrag nehmen.