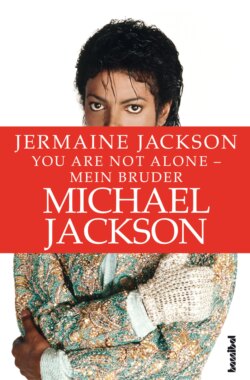Читать книгу You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson - Jermaine Jackson - Страница 8
ОглавлениеMichael saß auf dem Teppich und hatte sich zwei leere Frühstücksflocken-Trommeln zwischen die Knie geklemmt. Er hatte einen Bleistift durch den Verpackungskarton gebohrt, um beide miteinander zu verbinden, und nun erklärte er uns, das seien seine Bongos. Dabei saß er eigentlich ebenso wie Marlon nur als Zuschauer dabei und wartete gespannt darauf, dass wir mit der Probe anfingen, weil es hieß, er sei noch zu klein, um mitmachen zu dürfen. Aber er hatte beschlossen, dass er trotzdem etwas beitragen wollte, und so klopfte er mit vier Fingern jeder Hand die Rhythmen zu den Songs, die wir spielten und sangen. Er sah zu, wie Joseph mit dem Kopf voller Pläne Jackie, Tito und mich an den Schultern fasste und uns wie Schachfiguren hin und her schob, auf einer „Bühne“, die natürlich nur aus unserem Wohnzimmer bestand. Tito übernahm als Gitarrist die zentrale Position, ich stand rechts und Jackie links von ihm, und nun warteten wir auf die nächsten Anweisungen.
Mutter hielt sich mit Rebbie und La Toya in der Küche auf, damit wir uns austoben konnten. Sie wusste schon, was wir erst noch herausfinden sollten: dass es bei diesen Sessions nicht um irgendwelche Tagträumereien ging, in denen wir so taten, als ob – nein, für meinen Vater war das eine ernste Sache. Ein einziges Mikrofon stand mitten im Zimmer. Joseph Jacksons Söhne fingen nicht mit Haarbürsten oder Shampooflaschen an. Das Mikrofon stammte aus dem Fundus der Falcons und wurde nun wie ein Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben. „Ihr müsst lernen, wie ihr damit umzugehen habt. Fürchtet euch nicht davor, haltet es fest, spielt es“, sagte Joseph.
Wir sollen das Mikrofon spielen? Unsere Gesichter spiegelten vermutlich unsere Verwirrung wider.
Joseph legte eine LP von James Brown auf, drehte die Lautstärke hoch, packte das Mikrofon, schwenkte es nach links, dann nach rechts und gab ihm dann einen Schubs nach vorn, sodass es zurückfederte. So spielte man das Mikrofon. „Hörst du diese Stimme, Jermaine? So machst du das. Genau so machst du das.“ Er spielte uns viele große Hitsingles und LPs vor, damit wir sie genauestens studieren konnten, einen Song nach dem anderen, damit wir entdeckten, wie er gesungen wurde und wie man ihn am besten vortrug. Ich erinnere mich an die vielen Wiederholungen von „Green Onions“ von Booker T. & The MGs und an James Browns Version von „Night Train“. Joseph hielt uns dazu an, dass wir uns mehr bewegten, und so beugten wir uns zögernd vor, schnippten mit den Fingern und schlurften verlegen herum. Doch Joseph war nicht zufrieden. „Jungs, ihr könnt nicht einfach bloß singen und dazu ein bisschen hin- und herwippen. Ihr müsst euch bewegen – mehr Gefühl in die Sache legen! Passt auf, so …“
Nun begann er zu James Brown zu tanzen, der im Hintergrund lief, wobei er immer weiter mit dem Kopf nickte. Wir mussten unwillkürlich kichern, weil er so ungelenk wirkte. „Ich sehe sehr wohl, dass ihr lacht“, erklärte er daraufhin, „aber ich will nicht, dass ihr wie Amateure rüberkommt.“
Wir gingen also wieder auf unsere Positionen und arbeiteten weiter an einer Choreographie im Rahmen unseres Trainingskurses, bei dem eigentlich nur noch fehlte, dass ein Motto wie „Übung macht den Meister“ über der Tür prangte.
Stattdessen hatte Joseph ein Lehrbuch in seinem Kopf, dessen Inhalt er mündlich an uns weitergab und dessen Leitsätze sich tief in unsere Köpfe einbrannten. „Ihr wollt die Leute unterhalten. Seid voller Energie. Seid anders als die anderen. Das müsst ihr dem Publikum vermitteln!“ Wir studierten Songs ein und lernten Tanzschritte – zwei, drei, manchmal auch fünf Stunden am Tag. Wenn Joseph nicht arbeitete oder schlief, dann probten wir. „Übung sorgt nicht für Perfektion“, sagte er immer. „Aber für Zuverlässigkeit.“ Durch das viele Proben prägten wir uns jede Menge Dinge ein, aber trotzdem vergaßen wir immer wieder etwas. „Los, noch einmal … und noch einmal … und noch einmal, bis alles richtig sitzt“, meinte er dann.
Michael trommelte währenddessen unverwandt auf seine Frühstücksflocken-Trommeln. Ich weiß nicht mehr, wie viele Pappschachteln er sturmreif schlug, bis ihm Joseph endlich ein gebrauchtes Paar Bongos besorgte. Und wir lernten immer neue Lektionen. „Stellt euch das Publikum vor … haltet es euch vor Augen … seht es an … fühlt es … und lächelt!“
Wir guckten direkt aus dem Fenster auf die Jackson Street, weil wir uns immer so aufstellten, dass uns das Licht auf die Gesichter fiel, und sahen draußen andere Kinder auf der Straße beim Ballspielen oder Rollschuhlaufen. Sie hatten Spaß und lachten, das konnten wir hören. Wenn Schulfreunde bei uns klopften und fragten, ob wir zum Spielen kämen, dann sagte Joseph Nein. „Sie müssen proben“, erklärte er. Das wiederum machte die gesamte Nachbarschaft endlos neugierig auf alles, was in unserem Haus vor sich ging, und so blieb es bis Ende der Sechzigerjahre. Gelegentlich kamen Kinder bis ans Fenster und drückten sich die Nasen an der Scheibe platt. Wahrscheinlich nahm das Leben im Goldfischglas, wie wir es später führten, hier seinen Anfang. Manche Kids trommelten auch ans Fenster und machten sich über uns lustig.
„Ihr habt Hausarrest! Ihr habt Hausarrest!“, riefen sie und liefen dann lachend weg.
Joseph zog die Vorhänge zu. Auf der Straße zu spielen, das brachte einen im Leben nicht weiter. „Konzentriert euch“, sagte er. „Ihr werdet immer Ablenkungen haben, denen ihr euch stellen müsst, aber wichtig ist, dass ihr an nichts anderes denkt als an euren Job.“ Wenn er es schaffte, neben seinen Schichten in der Fabrik noch hart zu arbeiten, dann konnten wir das auch. Das war die unausgesprochene Botschaft, die dahinterstand.
Wir besaßen Talent, das hatte er bei der Arbeit mit uns gemerkt. Aber in der Unterhaltungsbranche ging es nicht nur um Talent, man musste auch ein Showman sein, wie er das formulierte. Wir mussten das „Jackson-Geheimnis“ erschaffen. Bei den Tanzschritten sollten wir auf keinen Fall zählen. „Das dürft ihr nicht. Eins, zwei, drei, kick – das geht nicht. Das ist Tanzen nach Zahlen. Ihr müsst wissen und fühlen, was als Nächstes geschieht. Weg mit dem Zählen, her mit dem Gefühl!“
Am Anfang war Joseph geduldig und nahm sich viel Zeit, um uns nach seinen Vorstellungen zu formen. Er wusste, dass wir noch feucht hinter den Ohren waren, und darum zeigte er sich nachsichtig. Als er dann merkte, dass wir nach und nach besser wurden, war er sehr zufrieden, und das wiederum stachelte uns zu neuen Höchstleistungen an. Es ging darum, ihn zu beeindrucken und seinen Respekt zu erlangen. Wenn Verwandte wie Onkel Luther und Mama Martha zu Besuch kamen, ließ Joseph uns vorsingen. Und auch, wenn sie begeistert waren, reichte ihm das nie. „Ihr könnt noch mehr geben. Ihr könnt noch besser sein!“ Zumindest trieb uns Joseph zu einer Sache an, die uns Spaß machte. Und er verbrachte Zeit mit uns, im Gegensatz zu vielen anderen Vätern aus der Nachbarschaft. Wir fühlten uns ermutigt, nicht gedrängt – als ob er uns in eine Richtung führte, in die wir selbst gehen wollten.
„Blut, Schweiß und Tränen, Jungs – wenn ihr die Besten werden wollt, dann geht es nur so“, sagte er.
Tito meisterte die Gitarre, ich war ein starker Sänger, und Jackie hatte sein Talent als Tänzer schon bei den vielen Wettbewerben mit Rebbie bewiesen. Er führte uns bei den Tanzeinlagen, die Joseph vorschwebten, und wir machten es ihm nach, bis wir uns einheitlich bewegten. Das fiel uns nicht wirklich schwer; wir waren alle leichtfüßig. Abseits unserer Sessions wurde ich dazu ermutigt, Balladen zu singen, wie Mutter sie gern hörte, „Danny Boy“ oder „Moon River“. Ich brachte sie mir bei, indem ich die LPs auflegte und die Texte mitschrieb. Am schwersten war es, die Töne mit meinen Kinderlungen so lange zu halten, wie die Originale es erforderten, aber Joseph merkte, dass ich mir Mühe gab.
„Du musst aus dem Bauch heraus singen“, erklärte mir unser Gesangslehrer, Choreograph und Manager in Personalunion. „Stell dir einen Ballon vor, der sich ausdehnt. So ist das beim Einatmen. Beim Ausatmen singst du, da hältst und kontrollierst du die Töne. Denk an einen Dudelsack.“ Noch viele Jahre verglich ich meine Lungen innerlich mit Ballons und Dudelsäcken, denn so – in den Bauch hinein atmend – habe ich singen gelernt.
„Bevor ihr euch mit dem Text beschäftigt, müsst ihr erst einmal die Melodie beherrschen. Ihr müsst wissen, wo die Akkordwechsel liegen, und die Intonation meistern.“ Das war die wichtigste Lektion, die wir in der Jackson Street 2300 bekamen: Die Melodie liegt darin, die eigene Stimme zu begreifen, und Melodie ist alles. „Ihr solltet in der Lage sein, auch ohne Begleitung ein Lied zu singen.“ Auch unser „Ohr“ wurde so trainiert.
Wir wussten, dass wir allmählich auf dem richtigen Weg waren, als wir nicht mehr auf Jackies Füße starrten oder im Kopf vorzählten. Irgendwann ging es wie von selbst. Auf der Bühne zu stehen fühlte sich an wie das Natürlichste der Welt.
Mama Martha war eine wichtige Konstante in unserer Kindheit. Sie wohnte etwa zwanzig Minuten entfernt in Hammond, East Chicago, und kam uns oft besuchen, stets mit einem Rührkuchen im Gepäck. Als Erstes bekamen wir alle einen dicken Schmatz aufgedrückt, die Art von Kuss, die auf der Wange dieses laute Lippengeräusch macht. Sie war eine Oma wie aus dem Bilderbuch.
Nach endlosen Proben als Trio war Joseph ganz wild darauf, seiner Schwiegermutter zu zeigen, was er in aller Bescheidenheit geschaffen hatte. Was wir jedoch nicht wussten, das war, dass auch Michael darauf brannte, bei dem ganzen Rummel mitzumachen. Vor den Augen unseres vorwiegend weiblichen Publikums – bestehend aus Mutter, Mama, Rebbie und La Toya mit dem zweijährigen Randy – stellten Jackie, Tito und ich uns also in Positur, bestrebt, unserem Vater Ehre zu machen.
Michael saß wie immer mit seinen Bongos auf dem Boden. Als wir das Intro des ersten Songs schmetterten – welcher das war, habe ich vergessen –, fingen die Frauen an, den Rhythmus mitzuklatschen, und Michael stand auf. Und als er dann merkte, wie der Song langsam Fahrt aufnahm, fing er spontan an mitzusingen und übernahm eine eigene Harmonie. Er lenkte mich ab, und deswegen gab ich ihm mit einer Handbewegung zu verstehen, er solle sich verkrümeln und die Klappe halten. Unserer Meinung nach machte er uns unseren großen Moment kaputt.
Tatsächlich schaltete Joseph den Plattenspieler ab.
„Er macht hier gar nicht mit!“, protestierte ich. Aber Mama Martha verteidigte ihn sofort: „Lass ihn in Ruhe. Soll der Junge doch singen, wenn er will! Willst du singen, Michael?“
Michaels Gesicht hellte sich auf. Wir machten ihm Platz, damit er sich ein wenig in Omas Lächeln sonnen konnte, und Joseph setzte die Nadel brummend wieder auf die Platte. Unser kleiner Bruder begann zu singen. Und was da aus seinem Mund kam, das war kein „Jingle Bells“ bei Weihnachtsbeleuchtung. Es war hundert Mal besser, weil er nun offiziell zum Singen aufgefordert worden war und nicht verstohlen und leise ein verbotenes Weihnachtslied summte. Michael trat vor, zwar ein bisschen schüchtern, aber doch selbstbewusst, und er wusste genau, was er tun musste: Er spielte das Mikrofon, federte über die Bühne und sang wunderschön, und wir standen ganz baff da: „Verdammt, das ist ja super!“
Ich hatte keine Ahnung, woher diese Stimme kam.
„Vom Himmel“, sagte Mutter.
Josephs völlig perplexes Gesicht war herrlich anzusehen.
Michael hatte sich, während er uns zusah, alles genauestens eingeprägt. Und nun kam sein bisher verborgenes Talent zum Vorschein.
Am Ende bekam er einen riesigen Applaus von allen und fühlte sich so groß wie seine Brüder, was den Kleineren ja bekanntermaßen immer besonders wichtig ist.
Mama Martha und Mutter nickten sich mit wissendem Blick zu, als wollten sie sagen: „Wir haben doch gewusst, dass so etwas in ihm steckt.“
Soweit ich mich erinnere, holte Joseph ihn trotzdem nicht sofort in unsere Gruppe, weil es wegen seines Alters Bedenken gab: Er war am 29. August 1963 gerade erst fünf geworden. Aber ein paar Wochen später spielte das keine Rolle mehr, denn Michael war der Erste von uns, der live vor Publikum auftrat, bei einer Gala der Eltern-Lehrer-Vereinigung in der Garnett-Vorschule, die er seit kurzer Zeit besuchte.
In der Turnhalle hatte man aus rechteckigen grauen Blöcken eine Bühne errichtet, und davor standen jede Menge Klappstühle aus Holz. Offenbar war die gesamte Gemeinde erschienen, um sich die Auftritte der Kinder aus dem Viertel anzusehen. Ich saß bei Mutter und Papa Samuel, und wir wussten, dass Michaels Klasse etwas vorsingen würde; Michael hatte erzählt, dass er dabei ein Solo sang. Es war uns auch klar, dass es für ihn eine ziemlich große Sache war, denn morgens war er in einem blauen, bis zum Kragen zugeknöpften Hemd und seinen guten Hosen aus dem Haus gegangen, nicht wie sonst in T-Shirt und Jeans. Er hatte sich für das Lied „Climb Ev’ry Mountain“ aus dem Musical The Sound Of Music von Rodgers und Hammerstein entschieden (dessen Kinoversion später zu seinen absoluten Lieblingsfilmen zählen sollte).
Insgesamt hatte Michael um sein Solo wenig Aufhebens gemacht, und ich hatte auch nicht gehört, dass er dafür übte, aber das zeugte vielleicht nur von dem großen Selbstbewusstsein, das er hier erstmals unter Beweis stellte: Er bereitete sich innerlich vor und trat erst, als alles saß, an die Öffentlichkeit. Dieser Maxime blieb er Zeit seines Lebens treu.
Als er an die Reihe kam, nickte die Lehrerin, die am Klavier saß, und Michael trat vor. Mutter umklammerte die Handtasche auf ihrem Schoß, und ich fragte mich, was jetzt kommen würde. Würde ich vor Peinlichkeit im Boden versinken oder damit angeben wollen, dass er mein Bruder war?
Die Antwort auf diese Frage stand nach kurzer Zeit fest.
Michael machte alles genau so, wie unser Vater es uns beigebracht hatte – und dann kam der unerwartete, große „Wow“-Moment, als er den hohen Ton am Schluss so hinausschmetterte, dass er durch die ganze Halle schallte. Es war, als sei Gott kurz zu ihm heruntergestiegen und habe gesagt: „Kleiner, ich werde dir eine Stimme geben, die nicht von dieser Welt ist. Und jetzt benutze sie!“
Michael stand richtig unter Strom und bewegte sich auf der Bühne mit großer Sicherheit. Er folgte nicht der Vorgabe der Lehrerin, so wie es die meisten Kinder taten: Sie folgte ihm. Am meisten überraschte uns alle jedoch, dass er so hoch sang. Beim letzten Ton standen alle auf und applaudierten. Sogar die Lehrerin erhob sich vom Klavierhocker, und sie klatschte so schnell in die Hände, wie ich es noch nie gesehen hatte.
Das ist mein Bruder!, dachte ich.
Mutter hatte Tränen in den Augen, und sogar Papa Samuel war gerührt.
Verdammt, Michael, du hast sogar Papa Samuel zum Weinen gebracht!
Vermutlich war das der entscheidende Moment, an dem sich Michaels Seele dafür entschied, andere unterhalten zu wollen, den Kitzel des Beifalls zu spüren und die Reaktion auf den Gesichtern zu sehen, die er hervorgerufen hatte. Und ich wusste, dass ich neben ihm stehen und genau das Gleiche fühlen wollte.
Nach diesem Tag wurde unsere Gruppe zum Quintett. Michael war mit an Bord. Marlon auch – nicht, weil er mit irgendwelchen besonderen Leistungen brilliert hatte, sondern weil Mutter dafür kämpfte, dass er nicht ausgeschlossen wurde. „Du machst ihn kaputt, wenn du ihn nicht mitmachen lässt, Joe“, sagte sie.
Später war gelegentlich zu lesen, dass ich verletzt oder eifersüchtig gewesen sei, als Michael zu uns stieß, aber das stimmt nicht: Es gab nichts, worauf ich hätte eifersüchtig sein können. Wir waren eine namenlose Gruppe, die noch keinen Schritt aus dem eigenen Wohnzimmer heraus gewagt hatte, insofern gab es gar kein Rampenlicht, das er mir hätte streitig machen können. Noch war es nichts anderes als enthusiastisches Singen unter Brüdern. Früher hatten wir in unseren Etagenbetten gelegen und davon geträumt, große Stars zu werden. Nun sangen wir morgens mit einem Ziel vor Augen. Wenn wir aus dem Bett kletterten, stimmte einer von uns ein Lied an, ein, zwei andere fielen mit ein, und ruck, zuck hatten wir eine schöne dreistimmige Harmonie.
Es gab hohe Noten, die ich nie erreichte, die Michael aber ganz leicht schaffte. Er sang wie ein Vogel, fand Oktaven, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gab, und unser Vater war sprachlos. Man merkte, dass er Michael nach kurzer Zeit als unerwartetes Plus in seinem großen Plan betrachtete. Das Einzige, was jetzt noch fehlte, war der richtige Name.
Oft habe ich mich gefragt, wie viele Namen meine Eltern sich für uns durch den Kopf gehen ließen, bis sie sich für die neun entschieden, die es dann schließlich wurden. Nicht, dass das wirklich eine Rolle gespielt hätte, denn aus Sigmund Esco für den Erstgeborenen wurde beispielsweise schnell „Jackie“, weil Papa Samuel sowieso immer von „Jackson Boy“ sprach und das dann aus Faulheit noch weiter verkürzte. Und aus Tariano Adaryl wurde der Einfachheit halber Tito, weil das für uns alle leichter war. Als Kind hat es mich immer fasziniert, wie zwei Leute einen so breitgefächerten Geschmack haben können, dass er vom exotischen Jermaine LaJuane bis hin zu Michael Joe reicht. Später, und vor allem nach seinem Tod, kamen Gerüchte auf, sein zweiter Name sei Joseph gewesen. Vielleicht klang das spannender, weil damit ein zusätzlicher Bezug zu dem komplizierten Vater-Sohn-Verhältnis gegeben war. Allerdings lautete sein zweiter Name laut Geburtsurkunde wirklich schlicht Joe. Beinahe wäre er auf Mama Marthas Wunsch hin Ronald getauft worden, aber Mutter wusste das gerade noch rechtzeitig zu verhindern. Im Hinblick auf die spätere Entwicklung hätte sich Ronald auch irgendwie nicht so gut angehört …
Michael war das siebte Kind, sein Vorname bestand aus sieben Buchstaben, und die Sieben war seine Lieblingszahl. Numerisch war sein Name damit 777. Das ist der Jackpot. Die Glücks-Sieben. Eine Zahl, die in der Bibel nur einmal vorkommt. In einen Namen kann man viel hineininterpretieren. Der Klang allein hat eine gewisse Kraft, ebenso wie die Geschichte, die er erzählt, und die Erinnerungen, die mit ihm verknüpft sind. Aber die Sieben war für Michaels Identität von zentraler Bedeutung. Sie war auf die Ärmel seiner Jacken gestickt. Wenn er auf Papier herumkritzelte, dann oft immer wieder die Sieben. Die Bleistiftskizzen, die er in späteren Jahren für seine eigene Möbelmarke anfertigte (und die nie in die Öffentlichkeit kamen), zeigten thronartige Polstersessel, in deren Eichenholzrahmen in der Mitte unter der Sitzfläche neben einem verschnörkelten Blumenmuster ebenfalls eine Sieben eingraviert war.
Wenn ich an all die Namen und Titel denke, die wir in all den Jahren in Erwägung zogen, ob als Songtitel, Albumtitel oder Namen für unsere eigenen Kinder, dann ging es immer darum, denjenigen zu finden, der richtig klang. Und deswegen hätte allen Biografen auch von Anfang an klar sein müssen, dass „The Ripples & The Waves“ nicht zu den Optionen zählte, die wir ernsthaft für unsere Gruppe in Erwägung gezogen hätten. Das Gerücht machte zu unserer Erheiterung zwar die Runde und wurde sogar irgendwo abgedruckt. Wahrscheinlich deswegen, weil bei Steeltown Records, die auch unsere ersten Platten veröffentlichten, ein Song namens „Let Me Carry Your Schoolbooks“ von The Ripples And The Waves & Michael erschien. Dass da ein „Michael“ sang, war vermutlich ein schlauer Marketing-Schachzug, um sich an unseren Erfolg dranzuhängen. Der besagte Michael hieß jedenfalls Michael Rogers, und bei The Ripples And The Waves handelte es sich um eine ganz andere Gruppe.
Unser erster Name hätte dabei noch deutlich schlimmer ausfallen können. Eine Lady meinte, wir brauchten etwas Ausgefallenes, so wie die „El Dorados“. Beinahe hätten wir also einen Namen erwischt, der wie irgendein Cadillac-Modell klang. Glücklicherweise fiel die Idee durch, als wir feststellten, dass es in Chicago schon eine Truppe gab, die so hieß. Joseph wollte, dass „Jackson“ im Namen vorkam, aber es musste gleichzeitig auch etwas Einprägsames sein. Unsere Eltern diskutierten „The Jackson Brothers 5“, und das war eine Weile die erste Wahl, bis Mutter mit einer Frau aus der Nachbarschaft darüber sprach, Evelyn Lahaie, die daraufhin meinte: „Das ist viel zu sperrig. Wieso nennt ihr sie nicht nur The Jackson 5?“ Mrs. Lahaie leitete „Evelyn’s School Of Charm“, ein Institut, das junge Mädchen darin unterrichtete, wie sie sich ansprechend präsentierten, und wusste desahlb in Imagefragen recht gut Bescheid. Und so waren The Jackson 5 geboren. Zumindest auf dem Papier.
Unser Nachbarsjunge Johnny Ray Nelson war immer gut für Unterhaltung, weil ihn sein Bruder Roy gern mit einer Brechstange zur Tür hinausjagte, und während Johnny lachend flüchtete, drohte Roy laut schimpfend, ihm eins überzuziehen – ruppige Spiele dieser Art waren in Gary an der Tagesordnung. Wenn Johnny gerade nicht auf der Flucht und der Friede wiederhergestellt war, dann hörte er uns durch die offenen Fenster unsere Stücke üben. Er sagte, ihn habe immer fasziniert, dass wir schon in so jungen Jahren so sicher mehrstimmig singen konnten.
Einmal spielte Michael draußen in der Sonne, und Johnny meinte: „Sing uns ein Lied, dann kriegst du ein paar Kekse.“ Wie aufs Stichwort stellte sich Michael hin und sang. Wir gingen natürlich auch sofort auf diese nachbarliche Aufforderung ein, und ruck,zuck standen fünf Brüder am Zaun und gaben Johnny Ray Nelson für einen Teller Kekse eine Privatvorstellung.
Von 1962 bis zum Sommer 1965 feilte Joseph immer weiter an unserem großen Auftritt, bis er endlich das Gefühl hatte, wir seien bereit. Wir hatten einen straffen Plan für die Proben: Montags, mittwochs und freitags ab halb fünf, sobald die Schule zu Ende war, nonstop bis sieben oder manchmal auch neun Uhr abends.
Anfang der Sechziger feierten die Temptations ihren großen Durchbruch, und sie wurden zu unseren neuen Vorbildern. Für Joseph waren Dave Ruffins sanfter, aber doch rauer Gesang ebenso wie seine Bühnenpräsenz die neue Messlatte für unsere eigene Leistung. Dabei erwartete er von uns nicht etwa, dass wir mit Ruffin gleichzogen, sondern dass wir ihn übertrafen. Die Temptations mochten ja eine ziemlich große Nummer sein, aber für unseren Vater waren sie gerade die unterste Stufe dessen, was er sich für uns vorstellte. Überall in Amerika gebe es Gruppen, die es darauf anlegten, die nächsten Temptations zu werden, sagte er. „Ihr werdet nicht die nächsten sein, sondern schlicht viel besser!“
Mit einer Handbewegung deutete er unsere Zielrichtung an. „Wir wollen euch nicht hier“, sagte er und hielt die Hand auf Hüfthöhe. „Wir wollen euch hier“, die Hand wanderte zu seinem Scheitel, „und wenn ihr da angekommen seid, dann hier!“ Nun schwebte sie ein gutes Stück über seinem Kopf. „Zielt ganz nach oben … immer höher und höher …“ Die Reaktion der Zuschauer sollte nicht etwa sein: „Für so kleine Kids waren die ziemlich gut.“ Joseph wollte etwas anderes hören: „Wow – wer sind denn die?“ Das würde uns gelingen, indem wir Auftritte ablieferten, die das Publikum emotional berührten, sagte er. „Wenn die Leute euch zusehen, dann kontrolliert ihr sie und zieht sie in eure Welt. Ihr müsst den Text richtig verkaufen. Bringt sie dazu, dass sie aufstehen und kreischen.“
Wir fünf Jungen, die noch nicht einmal das Teenageralter erreicht hatten, fragten uns insgeheim, wodurch man Leute zum Kreischen brachte.
Wenn Mama Martha beim Abwaschen das Geschirrtuch auswrang, dann quetschte sie dabei auch noch den letzten Wassertropfen heraus. Joseph machte es mit uns genauso. Und als wir allmählich ein Gefühl dafür bekamen, wie sich unser Auftritt entwickelte, verstanden wir auch besser, in welche Richtung es gehen sollte, und wir schmückten unsere Show entsprechend aus, allen voran Michael. Wenn Joseph uns sagte, wir sollten ein wenig zur Seite rutschen oder auf die Knie fallen oder einen bestimmten Gesichtsausdruck aufsetzen, dann legten wir noch eine Schippe drauf. Wir sahen uns Dave Ruffins emotionale Performance und James Browns Seelenpein an und lernten davon.
Als die Jackson 5 dann schließlich erste Auftritte absolvierten, sagten viele Leute, dass Michael über eine Körpersprache verfüge und Gefühle zeige, die seine jungen Jahre Lügen straften. Damals wie heute erzählte man sich, dass er eine alte Seele war, die auf Emotionen zurückgriff, von denen er als Kind noch gar nichts wissen, geschweige denn sie begreifen konnte. Es wurde oft gesagt, dass sich daran ablesen lasse, wie schnell er habe erwachsen werden müssen. Die Wahrheit ist dabei viel einfacher: Er war einfach ein Kind, das Erwachsene imitierte. Michael war ein Meister der Nachahmung, und Joseph, unser Schauspiellehrer, betreute ihn meisterhaft. Wenn ein Lied Herzschmerz oder Leid erforderte, dann sagte er immer: „Zeigt das auf euren Gesichtern, ich will es fühlen …“ Michael fiel dann auf die Knie, schlug die Hände gegen die Brust und sah … gequält aus. „Nein. NEIN!“, rief unser härtester Kritiker. „Es sieht nicht echt aus! Ich fühle es nicht.“
Michael studierte menschliche Gefühle, indem er die Gesichter anderer auf genau dieselbe mikroskopische Weise untersuchte, mit der er sich auch den Themen Gesang und Tanz widmete. Wenn man ihn gefragt hätte, was er tue, hätte er unseren Vater zitiert: „Ich verkaufe nur den Text …“ Er begann sich immer mehr auf die Performance zu konzentrieren, auf die Show, und nun hörte er sich James Browns Platten an und zerlegte die Musik in einzelne Schritte und Tanzfiguren. Oder er lag auf dem Teppich im Wohnzimmer, das Kinn in die Hände gestützt, und sah sich Filme mit Fred Astaire an. Er machte sich keine Notizen; er war einfach wie vom Donner gerührt und saugte alles auf wie ein Schwamm. Wenn er schon im Bett lag und Joseph zur Arbeit war, kam Mutter leise in unser Zimmer, wenn Shows mit James Brown oder Fred Astaire liefen und flüsterte: „Michael! James Brown ist im Fernsehen!“
Für Michael hörte die Welt auf, sich zu drehen, wenn es um James Brown oder Fred Astaire ging. Er betete den Boden an, auf dem sie tanzten.
Wir hatten einen Schwarzweißfernseher der Marke Zenith, dessen Empfang davon abhing, ob der Kleiderbügel aus Metall, der als Antenne diente, gerade in die richtige Richtung wies. Um ein farbiges Bild zu bekommen, klebten wir eine dieser durchsichtigen Plastikfolien vor den Bildschirm, wie sie damals recht beliebt waren. Sie war oben blau eingefärbt für den Himmel, hatte in der Mitte einen gelblichen, bronzefarbenen Ton, um dem Gesicht und der Haut der Schauspieler Farbe zu verleihen, und war unten grün wie Gras. Selbst, wenn es ums Fernsehen ging, mussten wir unsere Phantasie bemühen.
Michael nutzte es als Werkzeug, um sich alles einzuprägen. Wenn er sah, wie jemand eine bestimmte Tanzbewegung oder Schrittfolge machte, dann internalisierte er das, als hätte sein Hirn ein Signal an seinen Körper geschickt. Wenn er sich James Brown ansah, wurde er James Brown Junior. Von Anfang an bewegte er sich mit einer enormen Finesse und Geschmeidigkeit. Und es war ein Mann, der in einem Kinderkörper tanzte. Das war ihm einfach angeboren. Er kannte immer genau seinen Part, und er fragte niemals, auf welche Position er sich stellen sollte.
Sein Selbstvertrauen färbte auf uns ab. Joseph hatte seine alte Gitarre neu bespannt und ernannte mich zum Bassisten. Zwar hatte ich genau wie Tito nicht die geringste Ahnung, wie man Noten las, aber ich hörte mir die Songs an, spielte drauflos und fand heraus, wie es ging. Keiner von uns kannte sich mit der Theorie rund um Noten, Akkorde und den ganzen Kram aus. Ich könnte heute noch nichts vom Blatt spielen. Noten auf Papier, also geschriebene Instruktionen, übertragen keine Gefühle. Wenn man musikalisch ist, dann liegt es einem im Blut. Das sieht man ja an Stevie Wonder, der als blinder Musiker völlig ohne Noten auskommt und beweist, dass es beim Spiel nur ums Gefühl geht.
Michael und ich teilten uns zwar oft den Leadgesang und wechselten uns bei den Strophen ab, aber im Grunde war er der Frontmann unserer Gruppe, wenn er am Mikrofon stand. Wir stellten uns im Wohnzimmer so auf, wie wir uns auch auf einer Bühne präsentieren wollten. Ich stand, wenn man in Richtung Publikum blickte, ganz links am Bass, Michael rechts neben mir, dann folgten Jackie und Marlon, der etwa genauso groß wie Michael war, und schließlich Tito ganz rechts außen an der Gitarre. Tito und ich waren gewissermaßen wie Buchstützen, die unsere Gruppe zusammenhielten, und Jackie als der Größte dominierte in der Mitte, was optisch eine gewisse Symmetrie erzeugte.
Aber wir waren nicht die einzige Gruppe, die in dieser Zeit in Gary entstand. Auch in anderen Häusern versuchten die Menschen, ihre Träume zu leben, denn der Markt für Soul Music im nahegelegenen Chicago boomte. Es gab einige Barbershop-Quartette, die auch sehr stark mit Choreographie arbeiteten. Aber wir spürten von Anfang an, dass wir etwas Einzigartiges besaßen, und zwar nicht nur in Josephs Kopf. Dass wir Brüder waren, sorgte für einen ganz speziellen Gleichklang und eine Verbundenheit, die andere Gruppen nicht hatten. Diese Einheit war unser Trumpf, und ich glaube nicht, dass irgendeine andere Gruppe irgendwo in Amerika auf einen Coach zurückgreifen konnte, der auch nur annähernd so viel Leidenschaft und Entschlossenheit mitbrachte wie Joseph. Die Leute fragen immer nach dem Druck und der Belastung, die all das für uns bedeutet haben müsss, aber wir empfanden das nicht so. Wir hatten keine Angst vor dem Scheitern, weil Joseph uns dazu brachte, uns den Erfolg vorzustellen und an ihn zu glauben: einen Gedanken in Worte fassen, daran glauben, ihn umsetzen. Michael formulierte es in einem Interview mit dem Magazin Ebony 2007 einmal so: „Mein Vater war in einer Hinsicht ein Genie: Er brachte uns bei, wie man die Bühne beherrscht, das Publikum für sich gewinnt und instinktiv weiß, was man als Nächstes tun muss. Wir lernten auch, dass man die Zuschauer niemals spüren lässt, dass es einem nicht gut geht oder etwas nicht stimmt. Er war in dieser Hinsicht phänomenal.“
Eines Tages befahl Joseph, wir sollten uns ein Stück von der Wand entfernt aufstellen und die Hände ausstrecken. Wir taten wie geheißen, und unsere Finger waren einige Zentimeter von der Wand entfernt. „Ihr könnt sie berühren“, sagte Joseph.
„Wie das denn? Unsere Finger sind nicht lang genug … das ist unmöglich“, maulten wir.
„Seid fest davon überzeugt, dass ihr die Wand berühren könnt!“, wiederholte er.
Und hier bekamen wir eine weitere Lektion in mentaler Stärke: Der Geist ist stärker als der Körper. „Glaubt daran, dass ihr diese Wand berühren könnt“, sagte Joseph. „Wenn ihr glaubt, ihr seid am Ende eurer Reichweite, dann probiert es weiter. Stellt euch vor, wie ihr sie erreicht. Macht euch ein Bild davon, wie ihr die Wand anfasst.“ Michael stand auf Zehenspitzen und machte sich so lang, wie es irgendwie ging, um weiter zu kommen als wir anderen. Wir mussten lachen. Er war der Kleinste, aber trotzdem wollte er immer der Erste und der Schnellste sein.
Ich weiß nicht, ob Joseph je daran gezweifelt hat, welch großen Einfluss er auf Michaels Karriere hatte. Spätestens nach 1981 hätte es ihm allerdings unmissverständlich klar sein müssen, nachdem Michael das Haus in Hayvenhurst nach seinen Vorstellungen umbauen ließ. An der Außenwand seines alten Studios dort hängt heute noch ein Schild mit hellblauem Hintergrund, das in Großbuchstaben die Aufschrift trägt: „Wer sich streckt, berührt die Sterne.“
So wie wir es nicht abwarten konnten, dass Mutter von der Arbeit nach Hause kam, so sehr freuten wir uns darauf, dass Joseph zur Arbeit ging: Wenn er nicht da war, konnten wir herumrennen, albern sein, rausgehen und spielen. Vor allem Rebbie war immer sehr erpicht auf die Nächte, in denen er Schicht hatte, weil sie dann mit Mutter in einem richtigen Bett schlafen konnte, anstatt wie sonst auf dem Sofa. In dem Bild, das von unserer Jugend gezeichnet wurde, dominierte stets Josephs Gürtel und der strenge Zeitplan unserer Proben, und es stimmt, dass er den potenziellen Künstlern in uns mehr Aufmerksamkeit schenkte als den ganz normalen Jungen. Aber so sehr ich mich auch an Disziplin und Befehle erinnere, es gab in unserer Jugend doch auch sehr viel Spaß, Gelächter und Spiel. Wir waren Brüder, und das bedeutete, dass wir immer jemanden an unserer Seite hatten – gerade das sind Erinnerungen, denen in der Öffentlichkeit nie genug Bedeutung beigemessen wurde. Andererseits weiß man, wenn man wie wir aus einer großen Familie kommt, dass jeder Mensch Erlebnisse anders wahrnimmt und bewertet.
Wenn Joseph zur Arbeit war, achtete Mutter darauf, dass wir trotzdem all das übten, was er uns aufgetragen hatte. „Habt ihr den Song gelernt, den ihr vorbereiten sollt? Und auch die Schritte dazu?“ Sie war die Augen und Ohren unseres Vaters, aber sie achtete darauf, dass uns trotzdem Zeit zum Spielen blieb. Wir fuhren nicht nur Go-Karts, Einkaufswagen-Eisenbahn oder Karussell, sondern auch Fahrrad (Teile, die Tito uns ebenfalls aus Rahmen und Reifen vom Schrottplatz zusammenbaute), und wir gingen Rollschuh laufen, noch mit diesen Vorrichtungen, bei denen die Rollen mit Spannbacken an die Schuhsohlen montiert wurden, natürlich auch gebraucht gekauft. Nur zu gern spielten wir draußen auf der Jackson Street, mit Mutters Ermahnung im Ohr: „Aber ihr geht nicht weiter als bis zu Mr. Pinsens Haus!“ Mr. Pinsen war unser Baseballtrainer und wohnte zehn Hausnummern weiter.
Viel Spaß machte es auch, mit der Familie zum Camping in die Wisconsin Dells zu fahren, wo wir dann mit Joseph angeln gingen und er Jackie, Tito und mir zeigte, wie man Köder am Haken befestigte. Wir übernachteten immer in der Nähe alter Indianerstädte und wanderten auf den traditionellen Pfaden, um unserer Vorfahren zu gedenken. Wir waren in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass in unseren Adern das Blut der Choctaw und Schwarzfußindianer floss; ein Umstand, der unter anderem Körpermerkmale wie unsere hohen Wangenknochen, die vergleichsweise helle Haut und die haarlosen Oberkörper erklärte.
Zu Hause sahen wir viel fern, und natürlich gab es immer Streit zwischen Jackie, der Sport gucken wollte, Michael und Marlon, die für Trickfilme mit Micky Maus und Bugs Bunny waren, und mir, der ein großer Fan von Maverick mit James Garner war. Die einzigen Sendungen, auf die wir uns alle einigen konnten, waren die Comedy-Shows der drei Stooges, Flash Gordon und Western, in denen Randolph Scott mitspielte. Den drei Stooges haben wir es zu verdanken, dass wir die Liebe zum mehrstimmigen Gesang entdeckten, denn das Intro ihrer Sendung, das in Dreier-Harmonie gesungene „Hello … Hello … Hello …“ war das Erste, was wir gemeinsam ausprobierten, wenn wir mit Mutter am Spülbecken standen.
Zum Fernsehen kuschelten wir uns alle neben Mutter aufs Sofa. Es steht mir heute noch lebendig vor Augen, wie sie in der Mitte Platz nahm und Michael quer auf ihrem Schoß lag, das Gesicht dem Bildschirm zugewandt, ich daneben, während sich La Toya auf dem Fußboden auf der einen Seite an Mutters Beine schmiegte und Marlon (später auch Janet) auf der anderen Seite ans Sofa gelehnt dasaß. Tito und Randy lagen auf dem Fußboden, und Rebbie und Jackie saßen auf dem Sessel oder einem Küchenstuhl. In den heißen Sommern klemmten wir einen Ventilator in das offene Fenster, der kühle Luft in den Raum blies. Michael hielt gern sein Gesicht davor, wenn das Gerät auf höchster Stufe lief, und summte vor sich hin, ganz fasziniert davon, wie der Luftstrom seine Stimme schwanken ließ.
Im Winter war allerdings kein Mangel an kalter Luft, die durch alle Ritzen unseres schlecht isolierten Hauses in die Zimmer pfiff. Die harten Winter in Indiana drangen durch die papierdünnen Wände, und der Schulweg fühlte sich manchmal wie eine Expedition zum Südpol an. Bevor wir vom Basislager aus in den tiefen Schnee hinaustraten, sorgte Joseph dafür, dass Mutter einen Topf Kartoffeln kochte. Handschuhe konnten wir uns nicht leisten, und Mützen trugen wir nicht wegen unserer dichten Afro-Locken, deswegen steckten wir uns eine heiße Kartoffel in jede Manteltasche, um die Hände warm zu halten. Mutter rieb unsere Gesichter mit Vaseline ein, die sie wie Sonnenmilch einmassierte, vom Haaransatz bis hinunter zum Kinn und von einem Ohr zum anderen. Daher trocknete unsere Haut auch in den schlimmen Kälteperioden nicht aus, und die Sache hatte für sie noch einen weiteren Vorteil: „Damit seht ihr richtig glänzend, frisch, neu und sauber aus.“ Sie tat so, als sei die fettige Vaselineschicht gerade richtig in Mode. Wir maulten hingegen, dass andere Kinder keine Vaseline im Gesicht hatten, aber darauf pflegte sie zu erwidern, dass andere Kinder eben auch nicht so sauber aussähen wie wir.
Mutter wünschte sich immer noch sehr, dass Joseph ihr endlich ein zusätzliches Zimmer anbauen würde, und solange sich immer noch die Steine in unserem Garten stapelten, verlor sie diesen Plan auch nicht aus den Augen. Wir waren nun, nach Randys Geburt, acht Kinder (Janet war noch nicht auf der Welt), aber wenn es einen Satz gab, der in unserem Haus immer wieder zu hören war – abgesehen von „Los, probiert es noch einmal“ –, dann Mutters Stoßseufzer: „Dieses Haus platzt aus allen Nähten.“ Sie hatte seit Titos Geburt ungefähr dreihundert Dollar angespart, und niemand traute sich vorzuschlagen, dass man dieses Geld gut für die geflickte Wasserleitung hätte verwenden können oder für einen neuen Fernseher: Es war Mutters wachsender Grundstock für ein weiteres Zimmer und daher unantastbar.
Bis Joseph zum Segen unserer Gruppe eine einsame Entscheidung fällte. Eines Tages kam er mit dem VW-Kleinbus, der inzwischen seinen alten Buick ersetzt hatte, die Auffahrt zu unserem Haus hochgefahren und fing an auszupacken: Mikrofone, Ständer, Verstärker, Tamburine, ein Keyboard, Schlagzeug und Lautsprecher. Es war wie das Weihnachten, das wir nie feiern durften. Mutter war sprachlos vor Wut. „Joseph!“, rief sie und rannte nach draußen, während er immer noch mehr Instrumente zutage förderte. „Was hast du getan? Was sind das für Sachen?“ Wir waren so aufgeregt, dass wir gar nicht wussten, welches „Spielzeug“ wir zuerst ausprobieren sollten. Mutter rannte hinter Joseph her, der die Sachen ins Wohnzimmer schleppte. „Ich glaube das nicht! Wir können unseren Kindern nicht einmal neue Kleider kaufen, Jackie hat Löcher in den Schuhen, dieses Haus platzt aus allen Nähten, und du ziehst los und kaufst Instrumente?“
Wie immer in unserer Familie hatte Joseph das letzte Wort. Er sagte, es sei eine notwendige Investition, um die Jungs zu unterstützen.
Noch nie zuvor hatte ich erlebt, dass sich unsere Eltern stritten, weil Mutter normalerweise immer sofort nachgab, aber dieses Mal war Joseph zu weit gegangen. Zum einen hatte er sie nicht gefragt, zum anderen war er an ihre geheiligten Ersparnisse gegangen. „Du kriegst dein Zimmer, Katie“, versuchte er sie zu beschwichtigen. „Wir werden nach Kalifornien ziehen, und dann kaufe ich dir ein größeres Haus, aber unsere Jungs können ohne Instrumente nun mal nicht auftreten!“ In den nächsten Tagen hörten wir nachts immer wieder laute Stimmen aus dem Schlafzimmer. Mutter machte sich Sorgen, dass er Luftschlösser baute und uns Hoffnungen machte, die sich nie erfüllen würden. Joseph hingegen hielt daran fest, dass er das Richtige getan hatte, und bat um ihre Unterstützung. Das war seine Art, seine Liebe zu uns auszudrücken – er glaubte an unser Talent. Während Mutter uns mit ihrer Zuneigung und Zärtlichkeit überschüttete, steuerte Joseph das bei, was sie nicht vermitteln konnte: Selbstvertrauen und Überzeugung. Es waren Gegensätze, die uns aber mit all dem versorgten, was man von seinen beiden Eltern mitbekommen sollte. Mutter war jemand, der das Leben pragmatisch betrachtete, während Joseph eher bereit war, Risiken einzugehen und hoch zu pokern. Seine ruppige Liebe zu uns zeigte sich nicht in Streicheleinheiten, sondern in der Konzentration und Disziplin, die er in uns weckte, und in dem Respekt, den er einforderte. Es war eine Liebe, wie ein Football-Coach sie für sein Team empfindet, wenn er immer wieder das Motto ausgibt, dass es nur ums Gewinnen des nächsten Spiels geht. Er drückte seine Zuneigung anders aus, mit einem Schulterklopfen, einem Lächeln oder vielleicht einmal einem aufgeregten Händeklatschen. Anders wusste er uns nicht zu vermitteln, dass er uns liebte.
Ein paar Wochen lang herrschte bei uns zu Hause dicke Luft, aber irgendwann beruhigte Mutter sich und beschloss, Joseph zu vertrauen, dass die Investition sich tatsächlich auszahlen würde. Wir bekamen allerdings überhaupt nicht mit, dass jetzt die Chips in unserem Namen aufs rote Feld geschoben wurden.
Das Radio knisterte und knackte bei der Übertragung in jener Nacht im Jahr 1964, und das Haus war so still wie noch nie zuvor. „Guten Abend, liebe Sportfreunde im ganzen Land“, meldete sich der Box-Kommentator, „bald werden eure Fragen beantwortet. Liston in weißen Hosen mit schwarzen Streifen. Clay, eineinhalb Zentimeter größer, in weißen Hosen mit roten Streifen …“ Es faszinierte mich, dass uns dieser Mann so mitten ins Geschehen versetzen konnte und ein so lebendiges Bild von der Szene malte, dass wir sie selbst zu sehen glaubten. Josephs Spannung verstärkte sich, er saß vornübergebeugt auf dem Küchenstuhl direkt neben dem Radio, das auf einer kleinen Anrichte stand. „Der Schwergewichts-Weltmeister“, fuhr die Stimme fort. „Wenn dieser Kampf über die erste Runde hinausgeht, wäre das bereits eine Überraschung …“
Wir hörten den Rundengong. Die Menge brüllte. Wir stellten uns vor, wie der Herausforderer – Cassius Clay, der Mann aus Louisville in Kentucky – mit einem Satz aus seiner Ecke sprang, um den amtierenden Weltmeister Sonny Liston anzugreifen. „Und nun geht es los!“
Lange bevor der damals 22-jährige Cassius Clay als Muhammad Ali, „der Größte“, bekannt wurde, hielten wir ihm die Daumen, weil Joseph seine Art zu Boxen liebte und außerdem meinte, wir sollten den Underdog unterstützen, der mutig genug war, den Besten herauszufordern. Joseph hatte selbst als Jugendlicher in Oakland an Boxwettkämpfen teilgenommen; er forderte Tito, Jackie und mich auf dem Rasen vor dem Haus immer wieder heraus, wenn wir unsere roten Handschuhe trugen, und er brachte uns bei, „nie und vor niemandem Angst zu haben“. Er spielte den Schiedsrichter bei Kämpfen mit anderen Kindern aus der Straße, und Michael saß dann auf der Eingangstreppe und rief: „Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn!“
Joseph brachte uns die richtige Technik bei und zeigte uns, wie man auf seine Deckung achtete. „Niemand schlägt einen Jackson“, pflegte er zu sagen, und tatsächlich gelang das auch niemandem. Joseph sagte, er habe früher mit einer der soliden Eichentüren von Papa Samuel trainiert, nicht mit einem Sandsack – das stärke die Hornhaut und härte den Geist ab. Er war der stärkste, härteste und zäheste Mann, den wir kannten, und ich bin mir sicher: Als wir dem Kampf im Radio lauschten, stellte er sich vor, selbst im Ring zu stehen.
Auch in diesen Momenten konnte er es sich nicht verkneifen, einen Zusammenhang mit dem Entertainment auf der Bühne herzustellen. „Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene – so müsst ihr bei euren Auftritten sein“, erklärte er in Anlehnung an einen Ausspruch Clays auf der Pressekonferenz in der Vorwoche. Joseph fand überall nützliche Assoziationen und verpackte sie als kleine Lektionen. Genauso war es mit Jim Brown von den Cleveland Bears, wenn wir vom Football schwärmten. Die Nummer 32, der größte Runningback aller Zeiten, war ein Beispiel für Entschlossenheit und harte Arbeit: „In den letzten neun Jahren hat er nie ein Spiel oder ein Training ausgelassen, weil er weiß, dass man sich immer wieder anstrengen muss, wenn man der Beste bleiben will.“
Sogar in die Aufgaben, die er uns übertrug, verpackte Joseph nützliche Lehren. Der Stapel Steine, der sich noch immer hinter dem Haus befand – jene Steine, von denen Mutter inzwischen wusste, dass aus ihnen nun doch kein Anbau mehr werden würde –, erfüllten immer noch einen Zweck. Es waren sicher um die hundert richtig schwere Betonsteine, die links vom Haus aufgeschichtet waren, und uns wurde aufgetragen, sie einen nach dem anderen auf die andere Seite zu schleppen. Eine völlig sinnlose Übung, aber wir hinterfragten sie nicht, wir taten, wie uns geheißen wurde. Wenn Joseph nach Hause kam, nahm er unsere Arbeit in Augenschein. Alle Steine hatten genau bündig auf den anderen zu liegen, so dass die Kanten eine gerade Linie bis zum Boden bildeten. „Nein … das macht ihr noch mal. Ich möchte, dass sie ordentlich aufgestapelt sind.“ Also schleppten wir sie von rechts zurück nach links, bis sie eben ordentlich lagen. Blasen, Schürfwunden und kleine Schnitte lehrten uns Disziplin, Perfektion und Teamgeist. Wie man alles richtig macht. Keine Fehler zulässt. Wenn einer aus der Gruppe patzt, dann kommen auch alle anderen aus dem Tritt, und es sieht nicht mehr gut aus. Wie sich zum Beispiel auch bei der Choreographie zeigte.
All das erklärt vielleicht, wieso einige von uns als Erwachsene Zwangsstörungen entwickelten. Wenn Michael in ein Zimmer kam und sah, dass ein Kissen „falsch lag“, dann rückte er es zurecht. „Das kann ich nicht mit ansehen“, sagte er dann lächelnd. Mir ging es genauso, und Rebbie auch. „Erinnert ihr euch an die Betonsteine?“, fragten wir uns dann und lachten uns kaputt.
Als dann Cassius Clay in der Boxszene von sich reden machte, diente er Joseph als hervorragendes neues Beispiel für seine Lektionen. Denn hier war ein neues Gesicht, ein Mann, dem keiner der Experten etwas zutraute, aber der dennoch ein unerschütterliches Selbstbewusstsein besaß. Während wir dem Kampf lauschten und der Kommentator uns die erste Runde schilderte, lieferten sich Michael und Marlon einen Schattenboxkampf. Sonny Liston schlug öfter daneben, als dass er traf. „Die Beinarbeit ist das Wichtigste“, erklärte Joseph. Mutter brummte leise vor sich hin, dass sie von einem so gewalttätigen Sport prinzipiell nichts halte, aber Joseph hörte nicht zu – er war viel zu sehr damit beschäftigt, den Radiobericht mit Blick auf unsere Ziele für uns zu übersetzen. „Sonny Liston ist wie euer Publikum – ihr müsst raus auf die Bühne, richtig explodieren und die Leute umhauen!“
An jenem Abend gewann Cassius Clay, und er war der jüngste Boxer, der je einem Schwergewichts-Champion den Titel abluchste. „Ich habe die Welt erschüttert“, erklärte er den Medien. Das traf wohl zu – auf seinen Auftritt im Ring, aber auch auf die Wirkung, die er auf ein paar Kinder in Gary, Indiana, hatte, von denen er gar nicht wusste, dass sie ihm die Daumen drückten.
Auf dem Rasen zwischen unserem Kinderzimmerfenster und der 23. Avenue stand ein Baum. Wenn Stürme oder sogar Tornados über Indiana hinwegfegten, dann saßen Michael und ich oft am Fenster und staunten, wie viel Kraft tatsächlich in ihnen steckte. Wir waren fasziniert davon, den Kampf zwischen Mutter Natur und den Muskeln unseres Baumes zu beobachten. Er bog und neigte sich, zuckte und duckte sich wie Ali, aber nie brach er auseinander oder kippte entwurzelt um. Für mich stehen diese starken Bäume für den Familienverband, und die Äste sind wie Kinder, die mit ihrem Leben in alle möglichen Richtungen wachsen. Aber sie alle gehören zum selben Baum und stammen aus derselben Saat, und sie stehen stets fest verwurzelt da, ganz gleich, bei welchem Wetter.
Irgendwann erzählte ich Michael von dieser Analogie, und er ließ sie auf eine Plakette schreiben, die er in Neverland aufhängte. Inspiriert war der Gedanke sicherlich davon, dass Joseph uns als Kindern gesagt hatte, dass die Wurzeln unserer Familie so tief und so verzweigt seien wie die eines Baumes. Eine intakte Familie war unseren Eltern, die beide aus schwierigen Verhältnissen stammten, sehr wichtig. Das endlose Tauziehen zwischen Josephs Vater und Mutter, das er so intensiv miterlebt hatte, wollte er auf keinen Fall selbst wiederholen. Mutters Eltern wiederum hatten sich scheiden lassen, nachdem sie von Alabama nach Indiana gezogen waren, und Mutter war bei ihrem Vater, Papa Prince, geblieben, während ihre Schwester Hattie mit Mama Martha ging. Mutter und Joseph hatten sich geschworen, die Familie stets zusammenzuhalten, und uns immer wieder gepredigt, dass wir uns von nichts und niemandem auseinanderbringen lassen dürften.
Bevor die Jackson 5 erstmals öffentlich auftraten, führte uns Joseph eines Tages im Herbst nach draußen, um uns eine letzte Lektion fürs Leben zu geben. Wir gingen zu unserem Baum. Rings um den Stamm lagen abgebrochene, kleine Zweige, und er bückte sich, um sechs davon aufzuheben, die alle ungefähr dieselbe Länge hatten. Dann befahl er uns, um ihn herum Aufstellung zu nehmen und gut aufzupassen.
Er erinnerte uns daran, wie wichtig der Zusammenhalt war und dass wir stets aufeinander Acht geben sollten. Dann löste er einen Zweig von den anderen und brach ihn in der Mitte durch. „Wenn ihr getrennt seid, dann kann man euch einzeln brechen“, sagte er und hob die fünf anderen Zweige, die er noch in der Hand hielt, hoch. Er fasste sie eng zusammen und versuchte, sie erst mit den Händen und dann übers Knie zu brechen. Doch so sehr er das mit der ganzen Kraft eines Fabrikarbeiters auch versuchte, es gelang ihm nicht. „Wenn ihr aber zusammenhaltet, kann euch niemand etwas anhaben.“