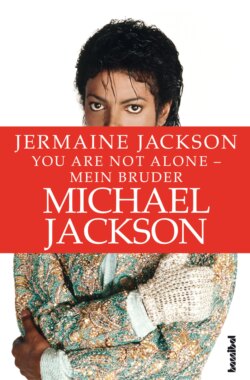Читать книгу You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson - Jermaine Jackson - Страница 6
ОглавлениеMichael stand neben mir. Ich war ungefähr acht und er gerade mal vier Jahre alt, und er stützte die Ellenbogen auf das Fensterbrett und das Kinn in die Hände. Wir beide sahen im Dunkeln aus unserem Zimmerfenster ehrfürchtig zu, wie an Heiligabend der Schnee fiel. Die Flocken wirbelten so dicht und heftig zur Erde, als ob über unserem ganzen Viertel eine himmlische Kissenschlacht tobte, und jede herabfallende Feder wurde vom klaren Licht einer Straßenlaterne angestrahlt. Die drei Häuser auf der anderen Straßenseite waren mit bunten Lichterketten geschmückt, während sich die Whites von schräg gegenüber für normale Glühbirnen entschieden hatten; dafür hatten sie im Garten noch dazu einen Weihnachtsmann und Rentiere mit leuchtenden Nasen aufgestellt. Weiße Lichter fassten das Dach ein, beleuchteten die Auffahrt und schimmerten blinkend in den Fenstern, die einen Blick auf den üppigsten Weihnachtsbaum boten, den wir je gesehen hatten.
All das betrachteten wir von einem Haus aus, in dem es keinen Baum, keine Lichter, kein Garnichts gab. Unser kleines Häuschen in der Jackson Street, Ecke 23. Avenue, war das einzige nicht geschmückte weit und breit. Uns kam es so vor, als sei es das einzige in der ganzen Stadt, aber Mutter versicherte uns, nein, es gebe andere Häuser und andere Zeugen Jehovas, die auch nicht Weihnachten feierten, so wie Mrs. Macons Familie zwei Straßen weiter. Aber dieses Wissen half uns nicht dabei, die ganze Sache zu begreifen: Vor unseren Augen fand so etwas Schönes statt, etwas, das uns ein wunderbares Gefühl vermittelte, aber ständig bekamen wir eingebläut, es sei nicht gut für uns. Weihnachten, so hörten wir, war nicht Gottes Wille, es war reiner Kommerz. Wenn es auf den 25. Dezember zuging, dann hatten wir den Eindruck, als ob wir Zeugen eines Festes würden, zu dem wir nicht eingeladen waren, aber dessen verbotener Geist uns trotzdem umfing.
Wir saßen da an unserem Fenster und blickten wie aus einer kalten, grauen Welt auf einen Spielzeugladen, in dem alles lebendig war und in buntesten Farben schimmerte, wo Kinder mit ihren neuen Schätzen auf die Straße hinausliefen, ihre neuen Fahrräder ausprobierten oder neue Schlitten durch den Schnee zogen. Wie sich die Freude anfühlte, die wir auf ihren Gesichtern ablesen konnten, das vermochten wir uns nur vorzustellen. Michael und ich spielten unser eigenes Spiel am Fenster: Wir wählten eine Schneeflocke im Laternenlicht, verfolgten ihren Fall und guckten, welche als erste „auftupfte“. Wir sahen den Flocken zu, wie sie in der Luft einzeln herumwirbelten und sich am Boden dann mit den anderen verbanden, zu einer wurden. An jenem Abend verfolgten wir vermutlich ein paar Dutzend und zählten laut mit, bevor wir irgendwann verstummten.
Michael sah traurig aus. Wenn ich mich heute an diesen Moment erinnere, dann sehe ich mich als großer Bruder mit meinen acht Jahren neben ihm stehen und auf ihn hinunterblicken, während ich die gleiche Traurigkeit empfand. Dann begann er zu singen:
„Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun it is to ride,
On a one-horse open sleigh …“
Das war das erste Mal, dass ich seine Stimme mit ihrem engelsgleichen Klang bewusst wahrnahm. Er sang leise, damit Mutter es nicht hörte. Ich fiel ein, und wir sangen zweistimmig, ein paar Strophen von „Silent Night“ und „Little Drummer Boy“. Zwei kleine Jungen, die an der Schwelle ihres ausgegrenzten Daseins Weihnachtslieder sangen, die wir in der Schule aufgeschnappt hatten, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, dass die Musik eines Tages unser Beruf sein würde.
Während wir sangen, lag ein breites Lächeln auf Michaels Gesicht, denn wir hatten uns ein kleines Stück Magie stibitzt. Für einen kurzen Augenblick waren wir glücklich. Aber dann hörten wir auf, weil dieses kurzlebige Gefühl uns umso stärker verdeutlichte, dass wir ja nur so taten, als ob wir an dem Fest teilnähmen. Der nächste Tag würde bei uns so sein wie jeder andere. Ich habe oft gelesen, Michael habe Weihnachten nicht gemocht, weil es in unserer Familie nie gefeiert wurde. Das stimmt nicht. Spätestens seit dem Augenblick nicht, an dem er mit vier Jahren zum Haus der Whites hinübersah und sagte: „Wenn ich mal groß bin, will ich Lichter haben. Jede Menge. Dann ist jeden Tag Weihnachten.“
„Schneller! Schneller!“, kreischte Michael mit seiner glockenhellen Stimme. Er saß vorn in einem Einkaufswagen, die Knie bis zum Kinn hochgezogen, während Tito, Marlon und ich das Gefährt im vollen Lauf die 23. Avenue hinunterrattern ließen, ich hinter der Stange, meine beiden Brüder links und rechts des Wagens, weil sich die Räder auf dem Straßenbelag wild drehten und sprangen. Wir nahmen noch einmal richtig Fahrt auf und rasten los wie ein Schlittenbob-Team. In unserer Phantasie fuhren wir allerdings einen Zug, den wir uns gern auch mit zwei oder drei aneinandergereihten Einkaufswagen zusammenstellten. Sie stammten aus dem Giants-Supermarkt drei Straßen weiter, auf der anderen Seite des Sportplatzes, der hinten an unser Grundstück grenzte, aber die Wagen wurden oft irgendwo im Viertel stehen gelassen und waren deshalb leicht aufzutreiben. Michael war der „Lokführer“.
Er war ganz verrückt nach den Spielzeugeisenbahnen der Firma Lionel – kleine, solide Dampfmaschinen oder Lokomotiven, die in orangefarbenen Schachteln verpackt waren. Wenn wir mit Mutter zum Geschäft der Heilsarmee gingen, um Kleidung zu kaufen, rannte er immer sofort nach oben in die Spielzeugabteilung und sah nach, ob jemand vielleicht gerade eine gebrauchte Lionel-Bahn abgegeben hatte. In seiner Phantasie wurden unsere Einkaufswagen jedenfalls zu einem Zug mit zwei oder drei Waggons und die 23. Avenue zu einem schönen, geraden Gleis. Der Zug war zu schnell, um weitere Passagiere zusteigen zu lassen, und donnerte die Strecke entlang, während Michael die entsprechenden Geräusche machte. Dort, wo die 23. Avenue in einer Sackgasse endete, etwa fünfzig Meter von unserem Garten entfernt, kam unser Zug dann an einem imaginären Prellbock zum Stehen.
Wenn Michael nicht gerade auf der Straße Eisenbahn spielte, lag er mit seiner geliebten Lionel-Lok auf dem Teppich in unserem gemeinsamen Kinderzimmer. Unsere Eltern hatten ihm kein neues Modell kaufen können, und eine elektrische Eisenbahn mit Gleisen, Bahnhof und Signalen konnten sie sich schon gar nicht leisten. Der Traum von einer Spielzeugeisenbahn war jedenfalls weitaus früher in seinem Kopf verankert als der Traum, eines Tages auf der Bühne zu stehen.
Geschwindigkeit. Alles, was uns Kindern besonders aufregend erschien, hatte irgendwie mit dem Speed-Kick zu tun. Egal, was wir machten, es ging immer darum, schneller zu sein, uns gegenseitig zu überholen. Hätte unser Vater um diesen Hunger nach Tempo gewusst, hätte er es uns sicherlich verboten: Die Gefahr von Verletzungen betrachtete er stets als großes Karriere-Risiko.
Als uns die Einkaufswagen-Zugfahrten irgendwann langweilig wurden, bauten wir uns „Go-Karts“ aus Kisten, Kinderwagenrädern und Brettern, die wir auf einem Schrottplatz in der Nähe besorgten. Tito war der „Ingenieur“ unter uns Brüdern und für die Konstruktion zuständig. Er bastelte auch ständig an Uhren und Radios herum, nahm sie auf dem Küchentisch auseinander und setzte sie wieder zusammen, und er sah Joseph gern dabei zu, wenn der an seinem Buick herumschraubte, der neben dem Haus geparkt war. Dadurch wusste er natürlich auch, wo der Werkzeugkasten unseres Vaters stand. Wir nagelten drei Bretter zusammen, um ein Fahrgestell in I-Form mit Achsen zu bekommen, befestigten darauf eine Holzkiste als offenes Cockpit und zogen ein Stück Wäscheleine als eine Art Zügel vorn um die Räder, um den fahrbaren Untersatz lenken zu können. Angesichts ihrer Bauweise hatten die Karts natürlich ungefähr den Wendekreis eines Öltankers, und so fuhren wir die meiste Zeit geradeaus.
Der breite Weg hinter unserem Haus, der zwischen grasbewachsenen Gärten auf der einen und einem Maschendrahtzaun auf der anderen Seite verlief, war unsere „Rennstrecke“, und nur darum ging es, um das „Rennen“. Oft ließen wir zwei Go-Karts nebeneinander laufen: Tito schob Marlon, und ich schob Michael die fünfzig Meter lange Bahn entlang. Wichtig war der Wettstreit zwischen uns, wer schneller fuhr und wer gewinnen würde.
„Los, los, LOS!“, kreischte Michael und beugte sich vor, damit wir in Führung gingen. Marlon verlor auch nicht gern, und deshalb hatte Michael einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Marlon war jemand, der nie verstand, wieso er nicht endlich seinen eigenen Schatten überholen konnte. Ich sehe ihn heute noch vor mir, wie er über die Straße rannte und dauernd zur Seite sah, erst voll wilder Entschlossenheit und schließlich ganz frustriert, weil ihm sein Schatten unüberwindlich auf den Fersen blieb.
Wir schoben die Go-Karts über die Piste, bis die Metallkrampen über den Asphalt kratzten und die Räder blockierten oder abfielen, so dass Michael in seinem Gefährt auf die Seite kippte und ich so lachen musste, dass ich kaum noch stehen konnte.
Auf einem Spielplatz nahe der Schule gab es ein kleines Karussell, auf dem wir unsere Lust am Geschwindigkeitsrausch ebenfalls auslebten. Man kauerte sich ziemlich in der Mitte hin, hielt sich an den Eisenstangen fest und brachte seine Brüder dazu, das Ding so schnell zu drehen, wie es irgend ging. „Schneller! Schneller! Schneller!“, rief Michael, die Augen fest geschlossen und vor Begeisterung lachend. Er setzte sich meist rittlings auf die Haltestangen und ließ sich dann herumwirbeln. Die Augen zugekniffen. Den Wind im Gesicht.
Wir alle träumten davon, eines Tages einmal mit einem richtigen Zug zu fahren, ein echtes Go-Kart-Rennen zu bestreiten und bei Disney in einem großen Karussell zu sitzen.
Noch bevor wir je etwas von Roald Dahl und seiner Geschichte von Willy Wonkas Schokoladenfabrik hörten, kannten wir schon dessen afro-amerikanische Version, Mr. Long. Er war wie ein Zauberer, mit weißem Haar, runzligen Gesichtszügen und lederartiger dunkler Haut, der in der nächsten Straße, der 22. Avenue, Süßigkeiten verkaufte. Sein Haus lag auf dem Weg zu unserer Grundschule am anderen Ende der Jackson Street.
Viele Kinder machten sich wie wir regelmäßig auf zu Mr. Longs Haus, weil sein jüngerer Bruder auf unsere Schule ging. Weil wir Timothy kannten, bekamen wir immer einen guten Preis; für zwei oder fünf Cent gab es eine kleine Papiertüte voller Lakritz, Karamellbänder, Zitronendrops oder Kaubonbons mit Bananengeschmack – Mr. Long hatte einfach alles, ordentlich auf einem Bettgestell im Vorderzimmer ausgelegt. Er sagte nicht viel und lächelte auch nicht, aber wir freuten uns trotzdem jedes Mal darauf, ihn morgens vor der Schule zu besuchen; wir zeigten auf das, was wir haben wollten, und er packte es in unsere Tüte. Michael war verrückt nach Süßigkeiten, und dieses morgendliche Ritual ließ den Tag immer gleich viel freundlicher erscheinen. Wie wir an das nötige Kleingeld dafür kamen, ist eine andere Geschichte, die ich später erzählen will.
Wir alle bewachten unsere Papiertüten mit den Süßigkeiten wie einen Goldschatz, und zu Hause, in unserem Zimmer, hatten wir alle unsere eigenen Verstecke, die natürlich die anderen Brüder aufspüren wollten. Ich bunkerte meine Sachen unter dem Bett oder unter der Matratze, und man kam mir immer auf die Schliche, aber Michael war wie ein Eichhörnchen und fand sehr clevere Verstecke, die nie einer von uns entdeckte. Wenn ich ihn später, als wir erwachsen waren, daran erinnerte, grinste er nur. So lachte Michael zeitlebens: eine Mischung aus Kichern, Glucksen und Grinsen, immer ein wenig schüchtern und meist auch ein bisschen verlegen. Michael spielte gern Einkaufsladen: Er bastelte sich einen Ladentisch, indem er ein Brett über ein paar aufgestapelte Bücher legte, darüber breitete er ein Tischtuch, und dann packte er seine Süßigkeiten aus. Der „Laden“ befand sich entweder in der Tür zu unserem Kinderzimmer oder auf dem untersten Etagenbett, und er kniete dann immer dahinter und wartete auf Kundschaft. Wir handelten und tauschten viel miteinander, dazu nahmen wir entweder das Wechselgeld, das wir von Mr. Long bekommen hatten, oder kleine Münzen, die wir auf der Straße gefunden hatten.
Aber Michael war zum Entertainer geboren, nicht zum gewieften Geschäftsmann. So viel wurde klar, als unser Vater ihn eines Tages fragte, wieso er so spät von der Schule nach Hause komme. „Wo warst du?“
„Ich habe Süßigkeiten gekauft“, antwortete Michael.
„Wie viel hast du dafür bezahlt?“
„Fünf Cent.“
„Und für wie viel willst du sie jetzt verkaufen?“
„Für fünf Cent.“
Joseph gab ihm einen harten Klaps auf den Hinterkopf. „Man verlangt doch nicht nur denselben Preis, den man selbst bezahlt hat!“
Das war typisch Michael: Immer viel zu fair, nie gerissen genug. „Wieso kann ich die Sachen nicht für fünf Cent weggeben?“, fragte er später im Kinderzimmer. Die Logik dahinter blieb ihm verschlossen, und der unverdiente Klaps hatte ihn verletzt. Ich ließ ihn auf dem Bett sitzen, wo er vor sich hin murmelte, während er seine Süßigkeiten sortierte und offenbar immer noch im Kopf Einkaufsladen spielte.
Ein paar Tage später erwischte ihn Joseph hinten im Garten, wo er anderen Kindern aus der Straße Süßigkeiten durch den Zaun reichte. Kindern, die es nicht so gut hatten wie wir. Natürlich war er umlagert. „Für wie viel hast du ihnen den Kram verkauft?“, fragte Joseph.
„Ich habe nichts verkauft. Ich habe es ihnen so gegeben.“
Knappe dreitausend Kilometer entfernt vom Ort unserer Kindheit besuchte ich Michael mehr als zwanzig Jahre später auf seiner Ranch, Neverland Valley, bei Santa Ynez in Kalifornien. Er hatte viel Zeit und Geld darauf verwandt, das riesige Grundstück in einen richtigen Freizeitpark zu verwandeln, und die Familie war nun eingeladen, sich die fertige Märchenwelt anzuschauen. Neverland wurde in den Medien stets als verrücktes Produkt einer überbordenden Phantasie beschrieben, das sich stark an Disneyworld orientierte. Teilweise mag das stimmen, aber die Wahrheit liegt wesentlich tiefer, und das erkannte ich sofort, als ich mit eigenen Augen sah, was er hier geschaffen hatte.
Es war eine Reise zurück in meine Kinderzeit: Weiße Weihnachtslichterketten säumten den Bürgersteig und die Pfade, beleuchteten die Bäume, das Dach und die Regenrinnen des im Tudorstil erbauten Hauses. Sie blieben das ganze Jahr über angeschaltet, damit es tatsächlich „jeden Tag Weihnachten“ war. Eine riesige Dampflok mit mehreren Wagen verkehrte zwischen den Läden und dem Kino, und ein Miniaturzug umrundete das ganze Anwesen und den Zoo. Wenn man im Haupthaus an der Tür am lebensgroßen Modell eines Butlers vorbeigekommen war, die breite Treppe nach oben nahm und dann einen langen Flur entlangging, kam man ins Spielzimmer. In diesem Raum, dessen Tür von lebensgroßen Superman- und Darth-Vader-Figuren bewacht wurde, befand sich ein enorm großer Tisch, auf dem eine alte Lionel-Eisenbahnlandschaft aufgebaut war. Zwei oder drei Züge drehten voll beleuchtet ihre Runden durch eine Miniaturwelt aus Hügeln, Tälern, Städten und Wasserfällen. Drinnen wie draußen hatte sich Michael die größten Spielzeugeisenbahnen gegönnt, die man sich vorstellen konnte.
Auf dem Außengelände hatte er eine professionelle Go-Kart-Bahn mit allen Schikanen und engen Kurven konstruieren lassen und ein hübsches Karussell mit prachtvoll ausstaffierten Pferdchen aufgestellt, die sich zur Musik drehten. Es gab einen Süßigkeiten-Laden, in dem die Leckereien nichts kosteten, und einen Weihnachtsbaum, der das ganze Jahr über geschmückt blieb. 2003 sagte Michael, er habe sich die Ranch so eingerichtet, um alles zu haben, was er als Kind nie besaß. Aber er baute sich auch die Sachen nach, die ihm kurzzeitig durchaus viel Spaß gemacht hatten, nun jedoch in einer viel größeren, überdimensionierten Version. Er selbst bezeichnete sich als „Phantasie-Fanatiker“, und Neverland war seine ewige Phantasie.
Neverland brachte uns die verlorenen Kindertage zurück, denn so stufte er seine frühen Jahre ein – als Verlust. Er, das ewige innere Kind, das durch seine Vergangenheit streifte und versuchte, sich irgendwie zukünftig mit seiner Vergangenheit zu versöhnen. Es war dabei nicht die Weigerung, erwachsen zu werden, denn wenn man ihn fragte, dann sagte er, dass er sich niemals wie ein kleiner Junge gefühlt habe. Von Michael war stets erwartet worden, dass er sich auch schon als Kind erwachsen verhielt, und daher verwandelte er sich in ein Kind, als er eigentlich ein Erwachsener hätte sein sollen. Er war eher Benjamin Button als Peter Pan, auch wenn er letzteren Vergleich selbst gern heranzog.
Während ich mich durchaus daran erinnere, dass wir in unserer Kindheit viel lachten, empfand er diese Zeit völlig anders, was höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass ich vier Jahre älter war als er.
Mit einem Freund und einem unserer Neffen nahm ich mir ein Quad, um die Ranch zu erkunden, die uns mit ihren über tausend Hektar Fläche riesig erschien. Grüne Hügel, mit Eichen bestanden, erstreckten sich bis weit in die Ferne. Eine staubige Schotterstraße führte uns abseits der bebauten Fläche auf ein Plateau, den höchsten Punkt des Geländes, der uns einen Rundumblick auf das ganze Anwesen bot. Meine Augen fingen alles ein – das Haus, den Freizeitpark, den See, das Riesenrad, die Züge, die Bepflanzung –, und Stolz und Ehrfurcht überwältigten mich. Sieh dir an, was du geschaffen hast, sagte ich zu meinem Bruder, erst im Geiste und dann, als ich zurück war, auch direkt.
„Einen Ort völligen Glücks“, erwiderte er.
Die verzerrte Darstellung von Neverland zeigt vor allem, dass Michael in den Medien nach dem äußeren Schein seiner Welt beurteilt wurde, und nach Hörensagen. Stets schien man ein grelles, oberflächliches Bild seiner Person und seiner Ranch zu zeichnen, ohne sich je die Mühe zu machen, nach dem komplexeren „Warum?“ zu fragen. Wie jeder andere Mensch war er durch seine Herkunft geprägt. Aber der Ruhm – und vor allem der Ikonenstatus, der meinem Bruder aufgedrückt wurde – errichte eine Barriere des öffentlichen Interesses um ihn und wirkte seinem Bedürfnis, verstanden zu werden, entgegen. Aber um ihn zu verstehen, müssen wir uns in ihn hineinversetzen und das Leben aus seinem Blickwinkel betrachten. Wie sagte Michael 2003 in einer Botschaft an seine Fans, die er von Ed Bradley von CBS übermitteln ließ: „Wenn man wirklich etwas über mich wissen will, dann sollte man sich einen meiner Songs anhören. Er heißt ‚Childhood‘ …“
Michael offenbarte in diesem Text, dass er sich durchaus bewusst war, ein erwachsener Mann mit der Wahrnehmung eines Kindes zu sein: „People say I’m strange that way because I love such elementary things … but have you seen my childhood?“ Damit wollte er sagen: So wurde ich geprägt. So bin ich.
Viele Menschen haben versucht, durch das Fenster unserer Kindheit zu spähen, hinter die Fassade der übermächtigen Pop-Ikone zu schauen und die Berichte verleumderischer Medien kritisch zu überprüfen. Aber ich habe das Gefühl, man muss es wirklich erlebt haben, um es zu begreifen und zu verstehen. Denn unsere Welt, wie wir in unserer großen Familie als Brüder und Schwestern unter einem Dach aufwuchsen, war einzigartig. Wir hatten ein kleines Haus in der Jackson Street – die nach dem Präsidenten Andrew Jackson benannt worden war, nicht nach uns –, und wir teilten Erinnerungen, Musik und einen Traum. Hier ist der Ausgangspunkt unserer Geschichten und seiner Texte, und hier, hoffe ich, kann man dem wahren Michael Jackson zumindest ein wenig auf die Spur kommen.