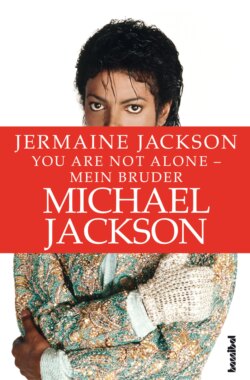Читать книгу You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson - Jermaine Jackson - Страница 9
ОглавлениеWenn ich mich recht erinnere, fand unser erster echter öffentlicher Auftritt als The Jackson 5 am 29. August 1965 statt, an dem Tag, als Michael sieben Jahre alt wurde. Das fiel allerdings niemandem auf, denn mit den Geburtstagen war es wie mit Weihnachten, sie wurden im Hause Jehovas nicht gefeiert. Aber Michaels siebter Geburtstag war insofern anders, als es eben doch kein ganz normaler Tag wie alle anderen war.
Evelyn Lahaie, die Frau aus der Nachbarschaft, die unseren Gruppennamen vorgeschlagen hatte, eröffnete uns die Chance, bei einer Modeveranstaltung für Kinder aufzutreten, die sie im Big-Top-Einkaufszentrum an der Kreuzung von Broadway und 53. Avenue veranstaltete. Sie war die Moderatorin des „Tiny Tots Jamboree“, einer Fete für die Kleinen, und wir wurden angekündigt als „The Jackson Five Musical Group: eine neue, spektakuläre Band der kleinen Leute“. Ich erinnere mich nur noch daran, dass eine ganz ordentliche Zahl junger Mädchen da war und Joseph uns nach dem Auftritt sagte, wir sollten „runter zum Publikum und unsere Fotos verkaufen“.
Für uns war diese Fete in erster Linie eine gute Möglichkeit, uns für die richtig große Sache aufzuwärmen, die einige Monate später, Anfang 1966, an der Schule von Jackie und Rebbie stattfinden sollte, der Theodore Roosevelt High. Bei dem Auftritt im Einkaufszentrum hatte uns Mutter schon gesagt, dass wir bald auf besseren Bühnen stehen würden. Die Schule veranstaltete einmal im Jahr einen Talentwettbewerb, bei dem die verschiedensten Bands aus der Stadt gegeneinander antraten – Garys Version der Ed Sullivan Show sozusagen. Wir waren bei weitem die Jüngsten, und wir konnten es nicht erwarten, neben den anderen zu bestehen.
Hinter der Bühne trommelte Michael auf den Bongos, die er noch immer spielte. Jackie schüttelte seine Maracas, und noch zwei weitere Bandmitglieder stießen zu uns: Jungs aus der Gegend, Earl Gault, unser erster Schlagzeuger, und Raynard Jones, der bei ein paar Gelegenheiten Bass spielte. Die Turnhalle der Schule war gerammelt voll. Dieses Mal handelte es sich um zahlendes Publikum; ein Ticket kostete 25 Cent. Wir wussten außerdem, dass ein paar vertraute Gesichter darunter sein würden, zum Beispiel einige von denjenigen, die sich schon zuvor die Nasen an unserem Fenster plattgedrückt hatten und die nur darauf warteten, dass wir uns blamierten.
Als Tito unsere Gitarren holen wollte, die abseits der Bühne an einer Wand lehnten, stellte er fest, dass jemand versucht hatte, uns zu sabotieren, indem er an den Wirbeln der Instrumente herumgefummelt hatte. Josephs guter Rat – „Überprüft immer, ob die Gitarren richtig gestimmt sind“ – rettete uns gerade noch rechtzeitig den Hals. „Da will jemand nicht, dass ihr gewinnt“, sagte unser Vater, „also geht jetzt da raus und zeigt’s ihnen!“
Er stand neben uns am Bühneneingang, und er sah nicht halb so zuversichtlich aus, wie wir uns fühlten. Vor unseren Auftritten war er immer nervös – in unseren Anfangstagen, als wir in Talentshows spielten, aber auch später noch, als wir schon einen Plattenvertrag hatten. Während wir auf der Bühne standen, besaß er keine Möglichkeit mehr, auf uns einzuwirken, und keine Kontrolle. Aber wir waren bereit. Wir traten vors Publikum, höflicher Applaus schallte uns entgegen, und wir schalteten auf den Autopiloten unserer Proben. Den Anfang machten wir mit „My Girl“ von den Temptations. In dem kurzen Augenblick, als der Applaus verhallte und die Musik noch nicht eingesetzt hatte, sah ich kurz zu Tito hinüber, und hinter ihm im Schatten sah ich Joseph. Immer noch angespannt. Raynard am Bass legte mit dem pulsierenden Anfang los … dann folgte Tito mit dem Melodiebogen auf der Gitarre … Jackie mit seinen Maracas, Michael mit seinen Bongos … und dann fing ich an zu singen.
Wir kamen richtig in Schwung, als ich eine weitere Temptations-Nummer anstimmte, das etwas schnellere „Get Ready“. Und Jackie, Marlon und Michael ließen die Bühne erbeben, als sie auf Michaels Gesangsfinale hinarbeiteten – James Browns „I Got You (I Feel Good)“. Schon bei der ersten Strophe sprangen die Leute von den Sitzen. Ich guckte nach rechts, dorthin, wo Joseph stand, um zu sehen, ob er es gut fand. Er war noch immer angespannt, hielt die Arme seitlich am Körper. Nur seine Lippen bewegten sich, als er tonlos den Text mitsprach, die Augen starr auf Michael gerichtet. „Eeeeoooowwww!“, schrie Michael. „I FEEEEL good …“ Bei seinem hohen, hyänenartigen Schrei blieb den Zuschauern der Mund offen stehen, dann kreischten sie vor Begeisterung. Und bei „I Got The Feeling“, unserem letzten Song, brachte er das Feeling wirklich rüber. Er sprang vor die Bühne und fing an zu tanzen, ein perfekt choreographierter Derwisch. Ein siebenjähriger Derwisch.
Niemand hatte erwartet, dass wir so gut sein würden, aber Michael riss die Leute mit. Uns war egal, dass es nur die örtliche Schule war. Für Kinder ist eine jubelnde Menge eine jubelnde Menge.
Nach dem Konzert sprangen wir hinter der Bühne wild herum und durchlebten den ganzen Auftritt noch einmal. Es war ein bisschen so, als hätte man einen Homerun geschafft oder ein entscheidendes Tor geschossen. Joseph war … zufrieden. „Im Großen und Ganzen wart ihr recht gut“, erklärte er, „aber es liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“
Das Nächste, woran ich mich erinnere, war der Moderator, der uns zu den Gewinnern erklärte. Wir rannten zurück auf die Bühne. Noch mehr Kreischen. Lustigerweise war unter den anderen Künstlern, gegen die wir uns durchgesetzt hatten, auch Deniece Williams, die einige Jahre später mit „Let’s Hear It For The Boy“ einen Riesenhit landete. Josephs Anerkennung brauchten wir an diesem Abend nicht: Wir hatten bei unserem ersten großen Auftritt richtig abgeräumt, und das reichte uns erst einmal.
Wir fuhren nach Hause und feierten mit reichlich Eiscreme. Joseph deutete in die Ecke unseres Wohnzimmers, in dem unsere stolze kleine Auswahl von Baseball-Pokalen stand, die von der anderen großen Begeisterung kündete, die wir alle teilten. Die Pokale standen da, als wollten sie unabsichtlich die These untermauern, die er immer wieder aufstellte: Bei Wettbewerben geht es nur darum, der Beste zu sein!
Aus unserem Zimmerfenster hatten wir einen freien Blick auf das Baseballfeld neben der Theodore Roosevelt High, auf dem wir spielten. Wenn man uns damals gefragt hätte, ob wir lieber als Musiker oder als Sportler Erfolg haben wollten, hätten wir uns sicherlich für Baseball entschieden. Vor allem Jackie, die Sportskanone unserer Familie. Wenn er Ärger mit Joseph hatte und für kurze Zeit abhaute, dann wussten wir, wo er zu finden war – er hockte auf dem Feld vor der Tribüne, warf den Ball mit einer Hand und fing ihn immer wieder mit seinem Fängerhandschuh.
Wahrscheinlich hätten wir vor allem eher deswegen Ja zum Baseball gesagt, weil uns dieser Traum realistischer erschien und sich drei von uns als Spieler bereits hervorgetan hatten. Die winzigen goldenen Figuren, die oben auf den Pokalen ihre Schläger schwangen, waren Beweis für den Ruhm und die gewonnenen Wettbewerbe mit den Katz Kittens, unserem Team aus der Baseball-Kinderliga von Gary. In unserer Jugend sahen wir uns viele Spiele der Chicago Cubs an und wollten unbedingt ihren Stars Ernie Banks und Ron Santo nacheifern.
Jackie war so gut, dass sich bereits die ersten Talentsucher um ihn bemühten, und er war sich sicher, dass er schon bald einen richtigen Vertrag bekommen würde. Er war ein großartiger Pitcher und Batsman und holte einen Homerun nach dem anderen für unser Team. Sein Herz gehörte dem Baseball, das war bei ihm noch ausgeprägter als bei uns anderen. Bei den Spielen war Michael unser Mini-Maskottchen und saß mit Marlon und Joseph in einem kleinen grünweißen Trikot, das ihm über der Jeans bis zu den Knien hing, auf der Tribüne, futterte rote Zuckerschnüre und jubelte begeistert, sobald einer von uns den Ball bekam. Eines Abends fand unter der Woche einmal ein großes Spiel gegen einen Konkurrenten aus der Gegend statt, ein Playoff oder dergleichen. Ich spielte im Outfield, Tito stand am zweiten Base, und Jackie war Pitcher. Wir drei hatten inzwischen schon einen recht guten Ruf, vor allem aufgrund von Jackies hervorragenden Würfen.
Während der Aufwärmphase schlug der Trainer immer wieder Bälle in die Luft, damit wir uns beim Fangen locker machten. Einer der Bälle flog so hoch, dass er beinahe die Wolken kratzte, bevor er wieder zur Erde fiel. Wir wussten, dass wir laut rufen sollten, wenn wir einen Ball für uns beanspruchten, also rannte ich los, die Augen auf den Ball gerichtet, und brüllte: „Den hab ich! Das ist meiner!“ Wesley, unser Fänger, der sich schon die Maske heruntergerissen hatte, lief ebenfalls los, aber er forderte den Ball nicht für sich und hatte mich offensichtlich nicht gehört. Auch er hatte nur Augen für den Ball. Und dann – KRACH! – stießen wir zusammen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich Sterne, ohne dass ich Josephs Gürtel auf meinem Hintern fühlte. Wesleys Stirn prallte gegen meine rechte Augenbraue und verursachte dabei eine große Platzwunde. Wesley selbst kippte bewusstlos um, und überall war Blut. Dann erschienen viele besorgte Gesichter über mir, aber sie verschwanden wieder und machen Platz für Joseph, und allmählich klärte sich mein Blick. Seine entsetzte, gequälte Miene stand mir vor Augen, während man mich ins Krankenhaus brachte, wo ich dann mit 14 Stichen genäht wurde. Ich war ziemlich mitgenommen, mein Gesicht war geschwollen und sah übel aus – und damit war mein „Image“ als Entertainer in Gefahr. Während Mutter Gott dafür dankte, dass mein Augenlicht keinen Schaden genommen hatte, ärgerte sich Joseph darüber, dass er nicht von vornherein verhindert hatte, dass ich mich derart verletzte. „Für dich ist Schluss mit Baseball, Jermaine“, erklärte er. „Und für euch anderen auch. Kein Baseball mehr! Das ist zu gefährlich.“
An viel mehr kann ich mich nicht erinnern, was diesen Tag angeht, außer dass Jackie ungeheuer traurig war, weil sein Traum damit gestorben war – und das nur, weil ein Junge nicht auf meinen Ruf geachtet hatte. „Eines Tages wirst du mir danken“, erklärte ihm Joseph mitleidslos. „Du bist noch zu jung, um das zu verstehen.“
Da wir den Talentwettbewerb der Roosevelt High gewonnen hatten, nahmen wir automatisch an einer weiteren Veranstaltung teil, bei der wir gegen die Sieger anderer Schulen aus der Gegend antraten. Auch dort gewannen wir, und das Blitzlicht der Gary Post-Tribune hielt unseren Triumph für die Nachwelt in Schwarzweiß fest. Ich erinnere mich deswegen noch so gut an das grobkörnige Foto, weil immer noch ein dicker Verband über meiner rechten Braue klebte. Wie wichtig uns der erste Platz tatsächlich war, mitsamt dem dazugehörigen Prestige und der Auszeichnung, wurde uns klar, als wir einmal nicht gewannen. Das geschah an der Horace Mann High School, und es ist mir vor allem wegen des Preises für den zweiten Platz noch so gut in Erinnerung: Es gab einen nagelneuen Farbfernseher.
Das Problem war, dass Joseph mit dem Verlieren nicht gut zurechtkam, und deshalb wusste niemand von uns so genau, wie wir reagieren sollten. Sicher, eine Niederlage war natürlich nicht toll, aber für uns gab es trotzdem keinen Grund, übermäßig enttäuscht zu sein. Schließlich brach Marlon das Eis, als wir unsere Sachen einpackten und die Schule verließen. „Wenigstens haben wir einen Farbfernseher bekommen!“ Damit sprach er aus, was wir alle dachten: Die Zeiten, in denen wir Filme durch den Schleier der eingefärbten Plastikfolie gucken mussten, näherten sich offenbar ihrem Ende.
Nur für Joseph lag in einem solchen Trostpreis nichts Tröstliches. „Es gibt nur einen Gewinner, und es geht immer um den ersten Platz, nicht um den zweiten!“, grollte er und warf uns allen böse Blicke zu. Wir holten den Fernseher an diesem Tag dann nicht ab: Joseph sagte, dass wir ihn nicht verdient hätten. Für den zweiten Platz gab es eben keine Auszeichnung.
Ich wünschte, ich hätte in diesen aufregenden Zeiten Tagebuch geführt oder mir zumindest die Berichte über uns ausgeschnitten, um meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen – vor allem jetzt, da Michael nicht mehr unter uns ist. Bei einem schweren Verlust klammert man sich an Erinnerungen, man möchte sich jede kleinste Einzelheit wieder ins Gedächtnis rufen, die einem einst so völlig selbstverständlich erschien. Damals entwickelte sich alles so schnell, dass die Auftritte und die Jahre regelrecht ineinander übergingen. Heute erscheinen mir die frühen Jahre der Jackson 5 wie eine Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug: Die Orte, an denen wir vorüberkamen, verschwammen, und nur die Abfahrt, das Ziel und einige denkwürdige Haltepunkte auf der Strecke stehen mir noch lebhaft vor Augen. Zwischen 1966 und 1968 waren wir an den meisten Wochenenden unterwegs und bastelten an unserer Karriere. Wir spielten vor ganz unterschiedlichem Publikum: vor uns freundlich gesinnten, begeisterten, betrunkenen oder gleichgültigen Leuten. Normalerweise war die Aufmerksamkeit der Zuschauer schon geweckt, wenn fünf Kinder auf die Bühne kamen, und der Niedlichkeitsfaktor war klar auf unserer Seite, vor allem dank Michael und Marlon. Am großartigsten fühlten wir uns immer, wenn es uns gelungen war, eine zunächst recht reservierte Menge richtig aufzutauen.
Unter der Woche traten wir häufig im „Mr. Lucky’s“ auf, dem größten Lokal in ganz Gary, das uns auch unsere erste Gage zahlte: elf Dollar, die wir unter uns aufteilten. Michael kaufte sich Süßigkeiten für das Geld und gab den anderen Kindern aus der Nachbarschaft davon ab. „Er hat seine erste Gage für Bonbons ausgegeben, die er dann an andere Kinder verteilt hat?“, fragte Joseph kopfschüttelnd. Aber wenn es um „Geben ist seliger als nehmen“ ging, dann trug Michael wahrlich einen Heiligenschein; Mutter hielt uns immer dazu an, an andere zu denken und Gutes zu tun.
Nachdem wir allmählich gute Fortschritte machten, entschlossen sich unsere Eltern schließlich dazu, in Bühnenkleidung für uns zu investieren. Sie bestand aus einem weißen Hemd, einer schwarzen Schlaghose und einer roten Schärpe, oder aber einem waldgrünen Anzug aus glänzendem Stoff, kombiniert mit einem gestärkten weißen Hemd. Mutter änderte unsere Kleidung mit der Nähmaschine selbst, und eine Frau namens Mrs. Roach nähte das „J5“ auf die Brusttaschen der Jacken. Daran erinnere ich mich deswegen noch so gut, weil die Buchstaben und Zahlen ein wenig schief gerieten und damit tatsächlich einmal etwas nicht ganz hundertprozentig in Ordnung war, sich aber auch nicht mehr korrigieren ließ.
Wenn wir nicht im Mr. Lucky’s auftraten, spielten wir im „Guys And Gals“, einem Restaurant, das auch Abendunterhaltung bot, oder im „High Chaparral“ auf der Southside von Chicago. Oft gingen wir erst um halb zwölf Uhr abends auf die Bühne und waren dementsprechend nicht vor zwei zu Hause, auch wenn wir am nächsten Morgen Schule hatten; wenn wir wieder auf die Auffahrt der Jackson Street 2300 fuhren, schliefen wir meist schon alle.
Bei einem Auftritt in einem Hotel merkten wir gleich, dass unsere Heimatstadt nicht zu Unrecht in dem Ruf stand, ein hartes Pflaster zu sein. Gerüchte besagten, dass man, wenn man in Gary tief genug buddelte, auf die Wurzeln der O.G.-Bruderschaft stieß, der Original Gangsters, und sich die Gang-Kultur erst später nach Osten Richtung New York ausbreitete. Ob das stimmt, weiß ich nicht. An diesem Abend stellten wir jedenfalls fest, dass es keinen Schutz vor Überfällen bot, wenn man zufällig aus derselben Stadt stammte. Es war schon dämmrig, und wir trugen gerade unser Equipment aus dem Auto zum Hintereingang, als Joseph von fünf grobschlächtigen Typen um die zwanzig angehalten wurde. „Sollen wir vielleicht mal mit anfassen?“, fragte einer und griff nach einem Mikrofonständer.
Joseph dachte gleich, dass es sich um einen Überfall handelte, und er weigerte sich, den Ständer loszulassen. Er schubste den Mann beiseite. Dann ging alles sehr schnell: Alle fünf fielen über ihn her, und er ging in einem Hagel von Faustschlägen zu Boden. Michael und Marlon schrien: „Joseph! Joseph! Nein! Nein! Nein!“ Die Gang benutzte nun unsere Schlagzeugstöcke und Mikrofonständer als Waffen. Joseph rollte sich zusammen, versuchte das Gesicht mit den Unterarmen zu schützen und die Schläge abzuwehren.
Michael war währenddessen zur nächsten Telefonzelle gerannt, die sich am Ende der Straße befand, und hatte die Polizei alarmiert. „Ich kam nicht richtig dran, ich musste hochspringen, damit ich die Münze in den Schlitz werfen konnte!“, berichtete er später. Als er zurückgelaufen kam, waren die Gangster abgehauen, und die Hotelarbeiter halfen Joseph wieder auf die Beine. Er war wirklich übel zugerichtet worden, sein Gesicht war zerschlagen und schwoll bereits an. Jemand lief ins Haus und holte Eis, um seine gebrochene Hand zu kühlen. Die Kerle hatten ihm außerdem den Kiefer gebrochen. Er setzte sich auf die Ladefläche des Busses und versuchte sich zu sammeln. Dann sah er uns mit einem halb zugeschwollenen Auge an und erklärte: „Ich bin okay.“ Michael und Marlon sollten sich die Tränen abwischen: „So könnt ihr nicht raus auf die Bühne.“
„Wir sollen auftreten?“, fragte Jackie ungläubig.
„Die Leute sind gekommen, um euch zu sehen – sie erwarten euch da draußen“, sagte Joseph und stand mit einer demonstrativ federnden Bewegung wieder auf. „Ich gehe morgen früh zum Arzt.“ An jenem Abend mussten wir uns wirklich zusammenreißen, um uns auf unsere Show zu konzentrieren. Joseph sah uns zu, genau wie immer, kühlte seine Hand und hatte das Gesicht voller Pflaster. Damit vermittelte er uns, wenn auch unbeabsichtigt, noch eine wichtige Lektion: Ganz egal, was passiert – the show must go on.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir nach der Schule Hausaufgaben machten. Wir aßen zu Abend, und dann bereiteten wir uns auf unsere Auftritte vor. Hausaufgaben wurden am Wochenende erledigt oder morgens im Bett hingekritzelt. Zu dieser Zeit wurde unsere Kindheit allmählich von Erwachsenenpflichten überschattet. Es gab immer eine neue Show, auf die wir uns vorbreiten, eine neue Choreographie, die wir einstudieren, oder eine neue Stadt, die wir erobern mussten.
Michael, inzwischen neun Jahre alt, musste schnell erwachsen werden. Genau wie wir alle. Wir hatten einen Beruf, während andere Kinder nichts anderes taten, als den ganzen Tag zu spielen. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, hätten die Jackson 5 vielleicht nie den großen Durchbruch geschafft, und die Welt hätte niemals die Musik von Michael Jackson gehört. Es sollte nun einmal so sein. Und wir hatten Spaß bei unseren Auftritten: Wir freuten uns genauso darauf wie andere Kinder auf ihre Hobbys und Spiele.
Nachdem wir im Mr. Lucky’s und im Guys And Gals regelmäßige Auftritte absolvierten, kündigte Joseph seinen Job in der Konservenfabrik und übernahm im Stahlwerk nur noch Halbtagsschichten. Zwar waren unsere Gagen sicher noch nicht so üppig, aber er setzte weiterhin alles auf eine Karte. Er vertraute auf unsere Zukunft. Mutter machte sich natürlich große Sorgen, aber Joseph beruhigte sie immer wieder und versicherte, dass wir wirklich auf einem guten Weg seien. Sie nickte dann schweigend, und wie ich Mutter kenne, hatte sie viele schlaflose Nächte, in denen sie unablässig zu Jehova betete.
Was sie zumindest nicht von Anfang an mitbekam, war die Tatsache, dass in einigen der Läden, in denen wir spielten, auch Stripperinnen auftraten. Damals boten die Bars ein sehr vielseitiges Programm, und oft, wenn wir von der Bühne gingen, warteten schon ein paar halbnackte Ladys in Netzstrümpfen und Strapsen am Aufgang. Nun waren schon Weihnachten und Geburtstage in Jehovas Augen eine Sünde, aber wenn man sich die Bühne mit Nummerngirls teilte, dann kam es einer Verabredung mit dem Teufel gleich, und deshalb kann man es Joseph nicht verübeln, dass er Mutter über die Shows der anderen Künstler ein wenig im Unklaren ließ. Eines Tages aber war das Spiel aus, als Mutter nämlich ein verirrtes Strip-Accessoire in einer unserer Taschen fand. Sie marschierte aus unserem Zimmer und hielt eine hübsche Nippelquaste zwischen den Fingern. „Wo kommt das her, bitteschön?“ Joseph war tatsächlich einmal sprachlos. „Du lässt die Kinder die ganze Nacht lang aufbleiben, obwohl sie morgens Schule haben, und dann lässt du sie auch noch nackte Frauen anschauen? Mit was für Leuten bringst du unsere Söhne zusammen! Du zeigst ihnen ja genau das richtige Leben, Joseph!“
Wir Brüder bewerteten diese Umstände recht unterschiedlich. Für mich ist der Körper einer Frau faszinierend und wunderschön, aber Michael dachte, dass diese Frauen sich erniedrigten, um Männer aufzugeilen, während sie selbst für die Männer lediglich Sexobjekte waren. Ihm blieb vor allem eine der Stripperinnen im Gedächtnis, der wir regelmäßig begegneten und die Rosie hieß. Sie warf ihre Höschen in die Menge und ließ ihre Rundungen wackeln, während die Männer sie anzugrapschen versuchten. Michael wandte dann stets den Blick ab. „Oh Mann! Das ist doch grässlich. Wieso macht sie sowas?“
Mutter sagte später, sie habe von den Stripperinnen erst aus Michaels Autobiografie erfahren. Das war vermutlich die „offizielle Version“ für die Zeugen Jehovas. Wobei sie sicherlich nicht allein deswegen gegen unsere Auftritte in einem solchen Umfeld war, weil sie eine Zeugin Jehovas war – sie betonte stets, dass vermutlich jede Mutter, egal welchen Glaubens, etwas dagegen gehabt hätte, dass ihre jungen Söhne spät nachts noch unterwegs waren und in solche Kreise gerieten. Das war wohl der entscheidende Unterschied zwischen ihr und Joseph: Sie sah uns vor allem als ihre Söhne und machte sich oft Sorgen darüber, wie sich die ganzen Auftritte und die langen Fahrten auf unsere Entwicklung auswirken würden, während wir für Joseph in erster Linie Künstler und erst in zweiter Linie seine Kinder waren. Für ihn ging es nur darum, dass all unsere Schritte in die richtige Richtung führten.
Joseph reichte es nicht, dass wir unter der Woche auftraten. An den Wochenenden buchte er uns überall Konzerte, wo es irgend ging, unterstützt von zwei DJs aus Chicago, Pervis Spann und E. Rodney Jones. Sie agierten als unsere Promoter, arbeiteten aber auch für B.B. King und Curtis Mayfield; hauptberuflich waren sie bei WVON Radio angestellt, einem Chicagoer Sender, der in Gary so viel gehört wurde wie kein anderer. Die beiden hatten sich der Aufgabe verschrieben, den Soul in ihrem Sendegebiet populär zu machen – Purvis während der Nachtschichten und E. Rodney tagsüber –, daher war unsere Promotion bei ihnen in guten Händen: Die schwarzen Radiosender waren gerade erst im Aufwind begriffen und setzten sich immer stärker durch. Wenn man bei WVON „angesagt“ war, dann geriet man automatisch ins Blickfeld der örtlichen Plattenfirmen.
Pervis, der stets einen grauschwarzen Filzhut im Stil der Dreißiger trug, sah ein wenig wie Otis Redding aus. Er machte die Leute auf uns neugierig, indem er immer wieder erzählte: „Wartet nur ab, bis ihr diese Kids einmal live gesehen habt!“ Joseph schimpfte zwar gelegentlich über ihn, wenn wieder einmal einer seiner Schecks geplatzt war, aber was Pervis an finanzieller Verlässlichkeit abging, glich er damit wieder aus, dass er für uns enorm die Werbetrommel rührte. Er und E. Rodney Jones setzten sich für uns ein wie niemand sonst.
So kam es, dass wir fünf uns mitsamt unseren Instrumenten in Josephs VW-Bus stapelten, während Mutter und Rebbie mit La Toya, Randy und der kleinen Janet zu Hause blieben. Eine Zeitlang sahen wir mehr von der Schule und den Bühnen irgendwelcher Clubs als von den heimischen vier Wänden. Unser VW-„Tourbus“ hatte vorn zwei Sitze, während die Bank in der Mitte ausgebaut worden war, damit Platz für die Verstärker, Gitarren, das Schlagzeug und alle anderen Instrumente blieb. Hinten gab es noch einen Rücksitz, aber wir rollten uns meist irgendwo zusammen, wo gerade Platz war, und schliefen notfalls auch mal mit dem Kopf auf der Trommel ein. Und obwohl es so fürchterlich eng war, wurde auf den Fahrten trotzdem viel gelacht, gewitzelt und gesungen. Während Joseph fuhr, gingen wir Brüder unaufgefordert die ganze Show wieder und wieder durch.
„Hier, an dieser Stelle, nicht vergessen, dass wir uns bei diesem Wort umdrehen“, sagte Jackie dann zum Beispiel.
Oder Tito: „Am Anfang des Mittelteils, denkt dran, da streckt ihr die Hände in die Luft.“
Oder Michael: „Jackie, du gehst auf die eine Seite der Bühne, ich bleibe in der Mitte, und Marlon, du gehst auf die andere Seite …“
So bereiteten wir uns während der Fahrt vor und gingen alle Tanzfiguren und Bewegungen noch einmal durch. Dabei spielte es keine Rolle, dass wir zwischen sieben und 17 Jahre alt waren: Niemand stand über dem anderen.
Wir alle brachten uns als gleichwertige Partner ein, und Michael, unser Jüngster, war dabei vermutlich der Engagierteste und Kreativste. Er wirkte weitaus älter als sieben, nicht nur aufgrund seiner Bewegungen und seiner Haltung beim Gehen, sondern auch aufgrund seiner Art zu reden. Joseph hatte uns darauf gedrillt, dass wir stets konzentriert und einsatzbereit waren, aber selbst als kleiner Junge hatte Michael noch zusätzlich das gewisse Etwas. Er brachte eine Dynamik in unsere Choreographien, die für genau den richtigen Schwung sorgte, und mitten im Auftritt bot er stets noch Improvisationen, die uns auf eine ganz andere Ebene führten, bevor er sich wieder zurücknahm und mühelos in die Show integrierte. Ich merkte immer, wenn er kurz davor stand, so etwas auszuprobieren, denn bevor die Musik einsetzte, wandte er sich um und zwinkerte mir zu.
Zu gern spielte Michael uns Streiche. Wenn einer von uns beispielsweise mit offenem Mund einschlief, dann schnappte er sich ein kleines Stück Papier, schrieb irgendetwas Albernes darauf – „Ich rieche aus dem Mund“ oder dergleichen – und pappte es dem Schläfer, nachdem er es ein wenig mit dem Finger nass gemacht hatte, an die Unterlippe. Ebenso gern krümelte er Juckpulver in unsere Unterhosen oder platzierte Furzkissen auf einem Stuhl. Michael wurde jedenfalls schnell der Scherzbold unserer kleinen Truppe.
Im Sommer 1966 fuhren wir fast zweieinhalbtausend Kilometer nach Arizona, um in der Old Arcadia Hall von Winslow bei Phoenix aufzutreten, weil Papa Samuel in der Nähe wohnte und vor den Leuten in seiner Nachbarschaft mit uns angeben wollte. Wir waren die ganze Freitagnacht bis in den Samstag hinein unterwegs und hielten zwischendurch nur kurz, um zu tanken, dann gingen wir am Samstagabend auf die Bühne und fuhren sofort zurück, damit wir vor Mitternacht am Sonntag wieder zu Hause waren und Montagfrüh wieder in der Schule sitzen konnten. Auf dieser quälend langen Fahrt lachte Michael nicht so viel. Lebhaft erinnere ich mich noch daran, dass ich vorn bei Joseph saß, und er irgendwann einmal anhielt, das Gesicht in den Händen verbarg und sich die Wangen massierte. Seine Augen tränten. Dann merkte er, dass ich ihn ansah. „Bin nur ein bisschen müde“, sagte er. Nach fünf Minuten Pause fuhr er weiter.
Inzwischen hatten wir einen neuen Schlagzeuger, Johnny Jackson, der im Gegensatz zu dem, was später aus marketingstrategischen Gründen in der Presse gern behauptet wurde, kein Cousin und auch kein entfernter Verwandter von uns war. Sein Nachname war nichts weiter als ein glücklicher Zufall, den sich die Publizisten gern zunutze machten. Wir wurden auf ihn aufmerksam, weil er wie Jackie auf die Theodore Roosevelt High ging und uns von einem Musiklehrer empfohlen worden war. Er war ein lebhafter, gut gelaunter kleiner Kerl mit einem frechen Grinsen, etwa 14 Jahre alt und vermutlich der beste junge Schlagzeuger der ganzen Umgebung, der von seinen Fähigkeiten ebenso überzeugt war wie Michael von seinem Tanz. Johnny spielte einen tollen Backbeat und verfügte vor allem über ein exquisites Timing. Er schlug so heftig auf seine Drums ein, dass wir den Rhythmus meist über die Bühnenbretter in unseren Füßen spüren konnten. Johnny Jackson prägte unseren Sound entscheidend.
Und noch jemand stieß in dieser Zeit zur Familie: Jack Richardson, ein Freund von Joseph und ein unglaublich netter Kerl. Er sprang als Fahrer ein, weil unser Vater die langen Touren nicht mehr allein bewältigen konnte. Jack blieb jahrelang bei uns und wurde ein fester Bestandteil unseres Teams. Die vielen Stunden am Steuer, die er ohne zu klagen hinter sich brachte, verrieten uns, wie sehr er an uns glaubte. Wo auch immer ein Auftritt für uns gebucht worden war – Kansas City, Missouri, Ohio –, Jack war sofort voller Begeisterung mit dabei.
Unsere Marathontrips quer durchs Land seien wichtig, sagte Joseph, weil wir „ein weißes wie auch ein schwarzes Publikum ansprechen“ sollten. Er war fest entschlossen, uns eine gemischtrassige Fangemeinde zu schaffen, und das zu einer Zeit, da die Bürgerrechtsbewegung in vollem Gange war. Wir waren Kinder, wir verstanden die Bedeutung der Rassenfrage ohnehin nicht. Uns war es egal, ob die Gesichter in der Menge schwarz oder weiß waren, und es wirkte sich schon gar nicht auf unsere Show aus. Die Reaktion des Publikums war ohnehin immer die gleiche – die Leute liebten uns.
Auch von den ganzen geschäftlichen Abmachungen verstanden wir nichts: Wir sprangen einfach in den Bus, fuhren zum Club, der uns gebucht hatte, und gingen auf die Bühne. Mehr interessierte uns auch nicht. Während wir nach den Auftritten noch backstage oder im Hotel herumsaßen, war Joseph für uns unterwegs, schüttelte Hände und knüpfte Verbindungen. Wir wollten eigentlich immer nur nach Hause, aber oft genug kreuzte er noch mit einem neuen „Kontakt“ auf, und wir wussten, dass wir nun wieder engagiert dreinschauen und unser Bühnenlächeln aufsetzen mussten. Während wir an unserem Durchbruch arbeiteten, musste sich Joseph immer wieder mit dem Vorurteil herumschlagen, dass ein Haufen „Milchbubis“ gar nicht richtig gut sein könne. Aber er ließ sich niemals beirren und hielt daran fest: Wenn Stevie Wonder es schaffen konnte, dann auch seine Söhne.
Und dann zeigte sich ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont, in Gestalt eines Gitarristen namens Phil Upchurch, den wir nach einem Konzert in Chicago kennenlernten. Joseph erzählte uns ganz begeistert, dass Phil bereits mit Künstlern wie Woody Herman, Curtis Mayfield und Dee Clark gearbeitet habe. 1961 hatte er mit „You Can’t Sit Down“ eine Single veröffentlicht, die sich über eine Million Mal verkaufte. „Und er wird jetzt mit euch ein Demoband aufnehmen“, erklärte uns Joseph. Das war eine große Sache, denn Phil hatte eine Menge Einfluss in der Szene von Detroit, und wir sprangen herum, als ob Jackie gerade einen verbotenen Homerun geschafft hätte.
Michael löste sich aus unserer euphorischen Umarmung und umklammerte Phils Beine. „Könnte ich bitte ein Autogramm von Ihnen bekommen?“ Phil, der selbst gerade erst 25 war, zog ein Stück Papier aus seiner Jackentasche und kritzelte schnell seine Unterschrift darauf. Michael umklammerte seine Beute den ganzen Weg nach Hause wie einen kostbaren Schatz. An dieser Geschichte gefällt mir vor allem der Nachsatz: Mehr als zehn Jahre später schrieb Phil an Michael und bat ihn um sein Autogramm. Aber er bekam weit mehr als das – er wurde eingeladen, bei „Working Day & Night“ von Michaels erstem Soloalbum Off The Wall Gitarre zu spielen.
Doch damals, in Gary im Jahr 1967, machte sich Mutter vor allem darüber Sorgen, wer für das Studio und die Bandkopien zahlen würde. „Ich“, erklärte Joseph. „Die Sache kommt gerade in Schwung“, versicherte er ihr erneut.
Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, in welcher Reihenfolge nun alles Weitere geschah, aber es verhielt sich so: Phil Upchurch hatte denselben Manager wie die R&B-Musikerin Jan Bradley. Diese hatte 1963 mit „Mama Didn’t Lie“ einen Hit gelandet, und der Mann hinter dem Arrangement dieses Songs war der Saxophonist und Songwriter Eddie Silvers, der früher bei Fats Domino gespielt hatte und jetzt als musikalischer Leiter bei dem aufstrebenden Label One-derful Records arbeitete. Und so kam es, dass wir über Phil und Jan schließlich Kontakt zu Eddie bekamen, der dann den Song für unser Demo schrieb, „Big Boy“.
Ich vermute, dass Pervis Spann ebenfalls seine Finger im Spiel hatte, aber leider spielt mein Gedächtnis hier nicht mit. Ich weiß nicht mehr, wieso sich das Label One-derful letztlich dann doch nicht für uns interessierte, aber kurz darauf klopften Steeltown Records bei uns an, in Gestalt des Songwriters und Label-Mitbegründers Gordon Keith. Joseph war nicht einmal besonders begeistert, weil Keith ebenso wie er Stahlwerker von Beruf war und das Mini-Label erst ein Jahr zuvor gemeinsam mit dem Geschäftsmann Ben Brown aus der Taufe gehoben hatte. Der große Wurf schien das gerade nicht zu sein. Aber Keith wollte uns wirklich gern unter Vertrag nehmen. Mutter schildert die Geschichte so: „Er wollte euch langfristig an sich binden, aber Joseph sagte immer wieder: ‚Nein, wir haben so viele Angebote, das mache ich nicht.‘ Keith wollte euch aber so unbedingt auf seinem Label haben, dass er der kürzesten Vertragsdauer zustimmte – sechs Monate.“
Joseph betrachtete Steeltown zwar nie als Label, das wirklich etwas im Musikgeschäft bewegen konnte, aber er wusste, dass ein Plattenvertrag an sich erst einmal einige Vorteile mit sich brachte: Vor allem würden wir von den Lokalradios gespielt werden, wenn es erst einmal eine richtige Platte gab. „Big Boy“, unsere erste Single, erschien also 1967. Keith zufolge verkaufte sie sich im amerikanischen Mittelwesten und in New York um die 50 000 Mal. Wir wurden sogar unter den Top 20 der Musikzeitschrift Jet geführt. Aber der größte Augenblick kam für uns, als WVON Radio die Single zum ersten Mal spielte. Wir saßen alle um unser kleines Empfangsgerät herum und konnten es kaum glauben, dass das unsere Stimmen waren, die aus dem Kasten drangen. Es war ein bisschen so, als ob man ein Gruppenfoto in die Hände bekäme und zuerst das eigene Gesicht suchte und guckte, wie man aussieht. Genauso war das jetzt am Radio – wir lauschten unseren eigenen Stimmen in den Harmonien und den Oohs und Aahs des Begleitgesangs. Hier, in diesem Wohnzimmer, hatten wir die ersten Schritte unternommen, wir hatten verdammt hart gearbeitet, und nun erfüllte unsere Musik die Wohnzimmer von Gary und Chicago. Wir waren überwältigt.
Da wir uns fast nur noch auf die Shows konzentrierten, trat unsere Schulausbildung immer mehr in den Hintergrund. Es war nicht so einfach, sich den Anforderungen des Unterrichts weiter zu fügen, wo wir doch längst wussten, dass die Bühne einmal unsere Lebensgrundlage sein würde – was Joseph längst ganz genauso sah.
In der Schule war ich ohnehin oft traurig, weil wir da voneinander getrennt waren. Wir mussten in verschiedene Klassenzimmer, Jackie und Tito sogar auf ganz andere Schulen. Ohne meine Brüder in meiner Nähe fühlte ich mich angespannt und verletzlich. Und wenn ich Brüder sage, meine ich das auch im übertragenen Sinn – wir waren mehr als nur Geschwister, wir waren ein Team. Immer wieder guckte ich auf die Uhr und freute mich auf die Pause, wenn ich wieder mit Marlon und Michael zusammenkam. Die Lehrer hielten meine Niedergeschlagenheit fälschlicherweise für gutes Benehmen, und so wurde ich aus ganz verkehrten Gründen zum Liebling vieler Lehrer. Auch gehörte ich zu den Glücklichen, die sich nicht besonders anstrengen mussten, um einigermaßen gute Zensuren zu bekommen. Daher wurde ich oft ausgewählt, um Besorgungen zu erledigen, Sachen zu holen oder irgendwohin zu bringen.
Diese Botengänge nutzte ich oft, um an Michaels Klassenzimmer vorbeizugehen und mich davon zu überzeugen, dass bei ihm alles in Ordnung war. Vom Flur aus konnte ich durch die offene Tür sehen; vorsichtig stellte ich mich so hin, dass die Lehrerin mich nicht entdecken konnte. Michael war stets sehr konzentriert, entweder über sein Schulheft gebeugt, wenn er etwas schrieb, oder aber seine Blicke waren auf die Tafel gerichtet. Sein Banknachbar sah mich meist zuerst und gab ihm dann einen kleinen Stups. Michaels Augen glitten dann zwischen der Lehrerin und mir hin und her – er war stets bestrebt, nicht aufzufallen. Wenn sie sich umdrehte, traute er es sich, mir kurz zuzuwinken.
Mutter fand es seltsam, dass ich nach ihm sah, aber für mich war es völlig in Ordnung, dass ich mich als der Ältere gelegentlich überzeugte, wie es meinem kleinen Bruder ging. Damit tat ich meine Pflicht.
Michael machte sich auf der Schule besser als ich. Sein Wissensdurst übertraf den von uns anderen bei weitem. Er war ein neugieriges Kind, das stets „Warum? Warum? Warum?“ fragte, bei den Antworten genau zuhörte und sich jedes Detail einprägte. Ich bin überzeugt, dass sich in seinem Kopf ein Aufnahmechip für Daten, Fakten, Zahlen, Texte und Tanzschritte befand.
Morgens ging ich mit Michael noch in recht gemütlichem Schritt zur Schule, aber nachmittags rannte er nach Hause. Der Heimweg zeigte deutlich, wer von uns Brüdern mit wem am engsten verbunden war. Michael und Marlon liefen herum wie Batman und Robin. Auf der Straße oder auf der Aschenbahn forderte Michael Marlon ständig zu Wettrennen heraus, und jedes Mal hängte er ihn beim Sprint ab. Marlon hasste es, wenn er verlor … und er behauptete gern, Michael habe gemogelt. Dann fingen die beiden an, sich zu prügeln, und Jackie musste sie auseinanderbringen. Michael war jedes Mal wieder verblüfft, wieso die Dinge so aus dem Ruder liefen. „Ich habe ganz ehrlich gewonnen!“, erklärte er dann schmollend.
Ihre gemeinsame Energie war schlicht überwältigend, wenn sie durchs Haus liefen oder durch den Garten, wenn sie schrien, lachten, brüllten. Das Gespann Michael-Marlon machte Mutter oft verrückt, wenn sie beim Kochen war. Manchmal wirbelte sie herum, packte sie im Lauf an beiden Armen und drückte ihnen die Knöchel an die Schläfen.
„Aua!“
„Ihr müsst euch mal beruhigen, Jungs!“, rief sie dann.
Und das taten sie meist auch. Für vielleicht zwanzig Minuten. Dann standen sie schon wieder am Kinderzimmerfenster und spielten „Soldat“, indem sie zwei Besenstiele über das Fensterbrett legten und so taten, als ob sie auf Passanten schössen.
Tito und ich waren auch wie der Schatten des jeweils anderen, und Mutter zog uns auch gleich an, wobei unsere Kleidung später natürlich als Garderobe für die jüngeren Geschwister diente. Wir kommandierten Michael und Marlon gern herum und befahlen ihnen, Sachen für uns zu holen und dies oder das zu tun, aber Jackie ließen wir meist in Ruhe, weil er älter und leicht reizbar war, und Randy war sowieso der Kleinste, der erst noch dabei war, die Welt für sich zu entdecken.
Für Außenstehende war Michael derjenige, der am schwersten einzuschätzen war, denn er erwachte nur in zwei bestimmten Umgebungen wirklich zum Leben – in der geschützten Atmosphäre bei uns zu Hause und auf der Bühne. Wenn es um die Jackson 5 ging, gab er all seine Energie und Konzentration – kein anderes Kind hätte so selbstsicher und kontrolliert agieren können wie er. Wenn man ihn auf der Bühne erlebte, dann zeigte er ein überragendes, außergewöhnliches Selbstbewusstsein, aber auf dem Schulhof wirkte er sehr zurückgezogen, bis er angesprochen wurde.
Zu Michaels engsten Freunden zählte ein Junge namens Bernard Gross. Er war eigentlich mit uns beiden befreundet, aber Michael mochte ihn wirklich sehr. Er fand, er sei „wie ein kleiner Teddybär“ – mit rundem Gesicht und mollig, jemand, der rot wurde, wenn er lachte. Er war so alt wie ich, aber nur so groß wie Michael, und ich glaube, Michael schmeichelte es, dass ein älterer Junge mit ihm befreundet sein wollte. Bernard war ein unglaublich netter Kerl. Uns allen tat er leid, weil seine Mutter ihn ganz allein großzog; wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlte, ein Einzelkind zu sein. Ich glaube, auch deswegen hatte er einen gewissen Exotenstatus bei uns und wurde der einzige Außenstehende, der die Ehrenmitgliedschaft im Club der Jackson-Brüder erhielt.
Michael fand es schlimm, wenn Bernard weinte. Er hasste es, wenn sein Freund sich über etwas aufregte, und wenn das geschah, dann weinte Michael gleich mit. Mein Bruder entwickelte schon in jungen Jahren eine große Sensibilität und Mitgefühl. Aber umgekehrt taten wir auch Bernard leid. Einmal bekam er mit, dass ich in den Schnee hinausgehen sollte, um Limonade zu kaufen, aber ich hatte keine Lust und sagte das auch. Daraufhin bekam ich von Joseph mehrere Male eins mit einem Holzlöffel übergezogen; heulend lief ich anschließend zum Laden und wieder zurück. Bernard begleitete mich, damit ich mich besser fühlte. „Joseph macht mir Angst“, sagte er.
„Könnte schlimmer sein“, schniefte ich.
Könnte schlimmer sein. Wir könnten gar keinen Vater haben, dachte ich.
Musikalisch sollte vor allem eine Band auf Michael großen Einfluss haben, die damals gerade erst durchstartete: Sly And The Family Stone. Wir wurden über Ronny Rancifer auf sie aufmerksam, der gerade als Keyboarder zu uns gestoßen war. Er stammte aus Hammond, East Chicago. Mit seiner beeindruckenden Größe nahm er im VW-Bus zwar recht viel Platz ein, aber seine lebhafte Art sorgte auf unseren Fahrten für noch mehr Spaß. Michael, er und ich träumten oft davon, eines Tages gemeinsam Songs zu schreiben. Und deswegen erzählte er uns von den Brüdern Sly und Freddie Stone, ihrer Keyboard spielenden Schwester Rose und den anderen Mitgliedern der siebenköpfigen Gruppe, die 1966/67 erstmals von sich reden machte, bis ihre Poster schließlich neben denen von James Brown und den Temptations in unserem Zimmer hingen. Mit ihren engen Hosen, den psychedelischen Hemden und den großen Afro-Frisuren bot diese neue Band eine visuelle Explosion. Wir liebten alles an ihren Songs und ihren Texten, in denen es um Themen wie Liebe, Harmonie, Frieden und Verständnis ging, wie in ihrem Hit „Everyday People“ von 1968. Sie schenkten der Welt eine Musik, die ihrer Zeit weit voraus war: R&B, versetzt mit Rock, gewürzt mit Motown.
Für Michael war Sly der ultimative Performer, er beschrieb ihn als musikalisches Genie. „Ihr Sound ist anders, und jeder von ihnen ist irgendwie anders“, sagte er. „Sie sind zwar zusammen, aber auch einzeln sind sie stark. Das gefällt mir!“
Wie wir anderen spürte auch Michael allmählich, dass Josephs Vertrauen in uns gerechtfertigt war. Wir veröffentlichten noch eine Single auf dem Steeltown-Label, „We Don’t Have To Be 21 To Fall In Love“, aber wir wollten längst mehr als nur regionalen Erfolg.
Im Sommer schliefen wir immer bei offenem Fenster, damit die kühle Nachtluft hereinwehte, aber Joseph machte sich deswegen Sorgen, denn schließlich lebten wir in einem Viertel mit hoher Kriminalität. Erst als wir älter wurden, merkte er jedoch, dass wir es vor allem deswegen offen ließen, damit wir tagsüber ins Haus konnten, wenn wir die Schule schwänzten. Michael war zwar viel zu wohlerzogen, um so etwas zu tun, aber wenn ich keine Lust auf den Unterricht hatte, dann ging ich mit den anderen zusammen aus der Haustür, löste mich dann irgendwann von der Gruppe, versteckte mich irgendwo und kletterte später wieder ins Zimmer. Dort versteckte ich mich im Wandschrank, der eine großartige Höhle für diesen Zweck darstellte, und saß dort oder schlief, aß etwas aus meinem Süßigkeitenlager oder ein paar Salamisandwiches. Tito und ich nutzten den Schrank jahrelang als Versteck. Wenn es Zeit zum Nachhausekommen war, sprang ich durch das Fenster in den Garten hinaus und trat durch die Vordertür wieder ein.
Irgendwann hatte Joseph es satt, uns dauernd wegen des offenen Fensters anzubrüllen. Eines Nachts wartete er, bis wir alle schliefen, ging nach draußen und kroch dann zum Fenster herein, eine hässliche, furchteinflößende Maske vor dem Gesicht. Als sich diese große Gestalt mit den Beinen voran in unser Zimmer schob, wurden wir fünf Jungen mit einem Ruck wach und kreischten das ganze Haus zusammen. Michael und Marlon klammerten sich aneinander und waren außer sich vor Angst. Joseph schaltete schließlich das Licht an und nahm die Maske ab. „Ich hätte jemand anderes sein können. Und jetzt haltet ihr das Fenster geschlossen!“
Anschließend hatten einige von uns Albträume, vor allem die beiden im mittleren Etagenbett, aber dass Michael davon richtiggehend traumatisiert wurde, wie später gelegentlich behauptet wurde, das ist lächerlich. Joseph trug häufig mal Masken und fand es lustig, uns im Dunkeln anzuspringen, sich von hinten anzuschleichen oder eine Plastikspinne oder Schlange in eines unserer Betten zu legen, vor allem rund um Halloween. Zu 99 Prozent fand Michael das ebenfalls herrlich und genoss den Gruselkitzel. Wenn jemand einen Schaden davontrug, weil fortan das Fenster tatsächlich geschlossen blieb, dann war ich das, weil ich ab sofort gezwungen war, meine Anwesenheitsquote an der Schule gewaltig zu verbessern.
Joseph meldete uns dann für einen Talentwettbewerb im Regal Theater in Chicago an, und wir gewannen mit deutlichem Vorsprung. Auch an den nächsten beiden Sonntagen versuchten wir unser Glück, und wir siegten jedes Mal, drei Mal hintereinander also. Damals galt die Regel, dass man für so einen Hattrick belohnt wurde, indem man anschließend für einen echten Auftritt engagiert wurde, für den es auch tatsächlich eine richtige Gage gab, und so standen wir schließlich eines Abends vor Gladys Knight & The Pips auf der Bühne, die gerade von Motown Records unter Vertrag genommen worden waren.
Bei den Proben waren wir gerade mitten in unserem Programm, als ich bei einem Blick zur Bühnenseite feststellte, dass Joseph tatsächlich Gesellschaft von Gladys Knight bekommen hatte. Sie erzählte später, sie habe eine Gruppe singen hören, sei sofort aufgesprungen und habe gefragt: „Wer ist das?“ Als wir von der Bühne kamen, verriet uns Joseph, dass sie uns in ihre Garderobe eingeladen habe und uns kennenlernen wolle. Das war eine ziemlich große Sache, denn sie war mit den Pips gerade wahnsinnig angesagt, nachdem sie es im Vorjahr mit „I Heard It Through The Grapevine“ bis auf Platz 2 der US-Charts geschafft hatte.
Also schlichen wir hinter Joseph her in ihre Garderobe. Keine Ahnung, was sie gedacht haben mag, als fünf schüchterne Jungen durch die Tür kamen, nachdem sie von unserer Performance zuvor so beeindruckt gewesen war. Michael war noch so klein, dass er mit den Beinen nicht einmal auf den Boden kam, als er sich aufs Sofa setzte.
„Euer Vater hat mir gesagt, dass ihr Jungs eine große Zukunft vor euch habt“, sagte sie.
Wir nickten.
Gladys sah Michael an. „Macht es dir Spaß zu singen?“
„Ja“, antwortete Michael.
Nun musterte sie uns vier anderen. Wir alle nickten. „Ihr Jungs solltet bei Motown unter Vertrag sein!“
An diesem Abend fragte Joseph Gladys, ob sie jemanden von Motown dazu überreden könnte, sich einen unserer Auftritte anzusehen. Sie versprach, sich für uns einzusetzen, und klang dabei äußerst überzeugend.
Zu Hause erklärte Joseph unserer Mutter, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das Telefon klingle. Aber das tat es nicht.
Wie sich später herausstellte, hatte Gladys tatsächlich Wort gehalten und Taylor Cox, einen Motown-Manager angerufen, aber weiter oben in der Firmenhierarchie bestand kein Interesse an uns. Labelgründer Berry Gordy wollte keine Kindergruppe. So etwas Ähnliches hatte er schon einmal mit Stevie Wonder durchgezogen, und er hatte keine Lust darauf, sich wieder ständig mit den Jugendschutzbehörden herumzuschlagen, wenn es um Arbeitsbeschränkungen und dergleichen ging.
Also sorgte Joseph dafür, dass wir weiter auftraten und auf Tour gingen. Wir spielten regelmäßig im Regal Theater und in kleinen Hallen wie dem Uptown in Philadelphia oder dem Howard Theater in Washington D.C. Und schließlich führte uns unser Weg zum „Chitlin’ Circuit“, wie man damals eine ganze Reihe von Auftrittsorten im Süden und Osten der USA bezeichnete, die sich vor allem der Präsentation neuer, afroamerikanischer Künstler verschrieben hatten. Es waren die „harten Jahre“, in denen wir auf der Bühne lernten, was man bei Liveshows tat und was man besser bleiben ließ. Wir absolvierten einen Auftritt nach dem anderen und machten weiter Werbung für unsere Steeltown-Singles.