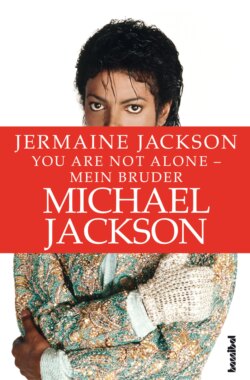Читать книгу You are not alone - Mein Bruder Michael Jackson - Jermaine Jackson - Страница 7
ОглавлениеAlles fing damit an, dass wir eines Tages um die Spüle in der Küche herumstanden und unsere Stimmen entdeckten. Das Abwaschen, Abtrocknen und Einräumen wurde bei uns sozusagen wie am Fließband erledigt und war ein allabendliches Ritual nach dem Essen. Diese Arbeit wurde paarweise im wöchentlichen Wechsel übernommen: Zwei Kinder trockneten ab, zwei andere stellten das Geschirr weg, und unsere Mutter stand in der Mitte, eine Schürze über ihrem Kleid, die Hände tief im Seifenwasser. Ständig pfiff oder sang sie dabei Lieder, aber der Titel, bei dem wir zuerst mit einstimmten, war „Cotton Fields“, ein altes Sklavenlied, das der Bluesmusiker Lead Belly geschrieben hatte. Es war ein Hit, der Mutter sehr bewegte, denn ihre Wurzeln lagen in Eufaula, Alabama, wo sie im Mai 1930 als Katie Scruse zur Welt gekommen war.
Ihre Großeltern hatten damals im so genannten Baumwollstaat eine Baumwollfarm besessen; ihr Urgroßvater war Sklave der dort lebenden Familie Scruse gewesen. Auch ihre Vorfahren konnten singen: „Seine Stimme schallte aus der Kirche über das ganze Tal“, sagte Mutter von ihrem Großvater, und das Gleiche traf auf Papa Prince zu, ihren Vater. Mutter schwor, dass ihre Stimme, die wir in unserer Küche vernahmen, ein Erbe ihrer Vorfahren darstellte, das sie in einem Kirchenchor weiter ausgebildet hatte. Sie stammte aus einer Baptistenfamilie, und gute Stimmen hatte es dort schon immer gegeben. Der Vater meines Vaters, Samuel Jackson, war Lehrer und Schuldirektor, der eine notenreine Version von „Swing Low, Sweet Chariot“ vortragen konnte, aber im Kirchenchor auch durch eine „herrlich hohe Stimme“ auffiel. Unsere Mutter spielte während ihrer Schulzeit Klarinette und Klavier, Joseph Gitarre.
Als unsere Eltern sich 1949 kennenlernten, vereinte sich ihr jeweiliges Erbgut offenbar zu einer Art Super-Gen, was unsere musikalische Begabung betraf. Das war kein Zufall, wie unsere Mutter immer wieder betonte, es war die Gabe Gottes. Oder, wie Michael es später formulierte, „die göttliche Vereinigung von Musik und Tanz“.
Wir alle liebten den Klang von Mutters Stimme. Wenn sie an der Spüle stand, dann verlor sie sich in den Baumwollfeldern von Alabama, und mir liefen Schauer über den Rücken, wenn ich diese klangvolle Stimme hörte, die nie einen falschen Ton sang. Ob sie sprach oder sang, sie klang stets warm, weich und beruhigend. Wir fingen mit dem Singen an, um ein wenig Unterhaltung zu haben, als unser Fernseher zur Reparatur war, und eines Tages versuchte ich mich an ein paar Harmonien. Ich war etwa fünf Jahre alt, aber ich sang frei die zweite (hohe) Stimme, und das mit völlig reinem Ton. Mutter sah zu mir hinunter, sang weiter, aber lächelte mich ganz überrascht an. Und fast sofort fielen meine Brüder Tito und Jackie und meine Schwester Rebbie mit ein. Michael war noch ein Baby, trug Windeln und lernte gerade erst laufen, aber wenn das Geschirr wieder ordentlich weggestellt und alles fleckenlos sauber poliert worden war, setzte sich Mutter hin, nahm ihn auf den Arm und sang ihn in den Schlaf. „Cotton Fields“ war meine erste Gesangserfahrung und Michaels Schlaflied.
Meine erste Erinnerung an Michael stammt aus dieser Zeit. An seine Geburt oder daran, wie Mutter mit ihm nach Hause kam, erinnere ich mich nicht. Geburten waren in unserer Familie kein großes Ereignis. Ich war fünf, als ich Michael zum ersten Mal wickelte. Ich tat das, was wir alle taten – wir halfen Mutter, wo wir konnten, indem wir in unserer Familie, die später neun Kinder zählte, überall mit Hand anlegten.
Michael war von Geburt an ein Energiebündel voll ungezähmter Neugier. Wenn man ihn auch nur für eine Sekunde aus den Augen ließ, war er unter den Tisch oder unters Bett gekrabbelt. Wenn Mutter unser äußerst schlichtes Waschmaschinenmodell in Betrieb nahm, dann stand er davor und hüpfte im Einklang mit den rumpelnden Vibrationen auf der Stelle hin und her. Ihm auf dem Sofa die volle Windel zu wechseln, glich in etwa dem Versuch, einen nassen Fisch festzuhalten, der sich wand, zuckte und sich hin- und herdrehte. Eine Windel mit Sicherheitsnadeln ordentlich festzustecken war schon für einen Erwachsenen nicht einfach, und für mich als Fünfjährigen bedeutete es eine echte Herausforderung. Glücklicherweise sprangen Rebbie oder Jackie mir oft zur Seite. Michael hatte außergewöhnlich lange, dünne Finger, die meinen Daumen packten, und große Rehaugen, in denen zu lesen stand: „Es macht mir einen Riesenspaß, dir die Sache ein bisschen schwerzumachen, Kumpel.“ In meinen Augen war er aber vor allem der kleine Bruder, auf den man aufpassen musste. Uns allen war immer wieder eingeimpft worden, uns umeinander zu kümmern, aber für Michael fühlte ich mich vom ersten Tag an besonders verantwortlich. Vielleicht lag es daran, dass ich immer nur hörte, wie meine Mutter rief: „Wo ist Michael?“ – „Ist Michael nichts passiert?“ – „Hat jemand Michael gewickelt?“
„Ja, Mutter … Wir haben alles im Griff … er ist hier“, antwortete dann einer von uns.
Keine Sorge. Michael ist nichts passiert. Michael geht es gut.
Unsere Großmutter mütterlicherseits, Mama Martha, badete uns, als wir noch klein waren, in einer breiten Aluminiumschüssel voller Seifenwasser. Später sah ich dabei zu, wie Michael mit hochgereckten Armen und verkniffenem Gesicht in dieser kleinen „Badewanne“ stand und mit enormer Gründlichkeit von den Zehenzwischenräumen bis zu den Ohren ordentlich abgeseift wurde. Wir mussten immer sauber sein und uns vor Keimen in Acht nehmen. Ich glaube, das wurde uns eingebläut, noch bevor wir laufen oder sprechen konnten. Und für echte Sauberkeit ging nichts über Castile-Seife mit ihrem groben Schaum. Einseifen und richtig schrubben. Mutter war sehr genau, wenn es um Sauberkeit ging – für sie musste immer alles ordentlich gewischt und gewienert sein. Sauber allein reichte nicht. Das Haus – und wir natürlich auch – hatte porentief rein zu sein und auch so auszusehen.
Keime wurden als unsichtbare Ungeheuer dargestellt. Von Keimen wurde man krank, hörten wir. Andere Menschen übertrugen Keime. Keime waren in der Luft, auf der Straße, auf allen Oberflächen. Ständig wurde uns das Gefühl vermittelt, wir seien von einer unsichtbaren Invasion bedroht. Wenn einer von uns nieste oder hustete, kam das Rizinusöl auf den Tisch, und jeder von uns bekam einen Löffel, um die Infektion gleich zurückzudrängen. Ich weiß, dass ich hier auch für Michael, La Toya und Janet spreche, wenn ich sage, dass wir mit einer beinahe neurotischen Angst vor Keimen aufwuchsen, und es war nicht schwer zu erraten, weshalb.
Bevor es beim Abwasch mit dem Singen losging, bekamen wir unsere erste wichtige Lektion: „Wir waschen nur mit sauberem Wasser ab … mit SAUBEREM Wasser!“ Lektion Nummer zwei: „Macht das Wasser so heiß, dass ihr es gerade noch aushaltet, und nehmt ordentlich Seifenlauge.“ Jeder Teller wurde geschrubbt, bis die oberste Keramikschicht ganz dünn war. Jedes Glas wurde gespült und abgetrocknet und dann gegen das Licht gehalten, um zu überprüfen, ob sich nicht noch Wasserflecken fanden. Wenn ja, dann musste man noch einmal von vorn anfangen.
Wenn wir von draußen ins Haus kamen, wurden wir zunächst einmal entseucht. Mutters erste Worte waren stets: „Habt ihr eure Hände gewaschen? Los, ab, Hände waschen!“ Wenn sie dann nicht binnen Sekunden das Wasser rauschen hörte, gab es Ärger. Morgens vor der Schule gab es die gleiche Hygiene-Inspektion: „Hast du dein Gesicht gewaschen? Deine Füße? Zwischen den Zehen? Die Ellenbogen?“ Darauf folgte der Lackmustest: Sie fuhr uns mit einem in Alkohol getauchten Wattebausch über den Nacken. Wenn der sich grau färbte, waren wir nicht sauber genug. „Geh noch einmal ins Bad und wasch dich richtig.“ Wenn wir Schokoladenkuchen oder einen Keks haben wollten, mussten wir zunächst unsere Hände vorzeigen. „Aber ich habe sie vorhin erst gewaschen!“, protestierte ich oft. „Du hast aber Türklinken angefasst, Junge – geh und wasch sie dir noch mal!“
Kleidungsstücke wurden höchstens zwei Tage hintereinander getragen, dann wurden sie gewaschen und gebügelt. Niemand aus unserer Familie ging je mit einer Knitterfalte oder einem Fleck auf dem Hemd auf die Straße. Mit sechs Jahren wusste jeder von uns, wie er bei der Wäsche mit anpacken konnte. Das gehörte einfach zu der perfekten Ordnung, die man brauchte, wenn man so viele Kinder – und das damit einhergehende Chaos – im Griff behalten wollte.
Als ich 2007 ins Big-Brother-Haus in Großbritannien einzog, machten sich alle darüber lustig, wie sehr ich von Hygiene besessen war und dass ich meine Mitbewohner dauernd fragte, ob sie sich auch die Hände gewaschen hätten, bevor sie das Essen zubereiteten. Meine Frau Halima überraschte das nicht. Ihr zufolge habe ich eine „Keimphobie“, und das kann ich kaum bestreiten. Bis heute fasse ich in einer öffentlichen Toilette keinen Türgriff an, weil ich weiß, wie viele Männer sich eben nicht die Hände waschen. Auch berühre ich in öffentlichen Gebäuden keine Treppengeländer oder Rolltreppenhandläufe. Und wenn ich mein Auto betanke, dann lege ich ein Taschentuch um den Griff des Zapfhahns. Im Hotel wische ich die Fernbedienung für den Fernseher erst einmal mit Alkohol ab, bevor ich sie benutze. Ich erwarte von jeder Oberfläche eine Seuchenattacke.
Michael war genauso. Als seine Fans noch richtig nahe an ihn herankommen konnten, machte er sich sogar Sorgen wegen der Stifte, die sie ihm für die Autogramme reichten. Aber seine Neurose konzentrierte sich vor allem auf Keime in der Luft. Die Leute machten sich lustig darüber, dass er oft einen Mundschutz trug, und es wurde viel darüber spekuliert, ob er damit schönheitschirurgische Eingriffe verstecken wollte. Ich musste immer lachen, wenn ich Artikel zu sehen bekam, in denen es um diese Masken ging, und es dann hieß, es herrsche deswegen „Besorgnis über Michaels Gesundheitszustand“. Denn genau das war der Grund: Michaels Angst davor, dass er krank werden könnte. Wenn er eine Maske trug, dann hatte er vermutlich das Gefühl, dass eine Erkältung oder dergleichen im Anzug oder sein Immunsystem gerade nicht richtig auf der Höhe war. Genau wie ich fürchtete auch er sich sein Leben lang vor Keimen. Zumindest war das der Ursprung seiner Angewohnheit, einen Mundschutz zu tragen; später wurde er wahrscheinlich auch eine Art Mode-Accessoire, das ihm zudem die Möglichkeit bot, sich zu „verstecken“ – ein Mini-Schutzschild für einen Mann, der sich verzweifelt jedes noch so kleine Stück Privatsphäre zu erhalten versuchte.
Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der Mutter nicht schwanger war. Wenn sie die Straße entlangging, dann stets mit diesem typischen Watschelgang und mit zwei Tüten in jeder Hand, die entweder Lebensmittel oder gebrauchte Kleidungsstücke enthielten. Zwischen 1950 und 1966 brachte sie neun Kinder zur Welt. Eine reife Leistung, wenn man bedenkt, dass sie und Joseph eigentlich höchstens drei Kinder geplant hatten.
Als Erste kam meine Schwester Rebbie (Rie-bie ausgesprochen) zur Welt, dann Jackie (1951), Tito (1953), ich (1954), La Toya (1956), Marlon (1957), Michael (1958), Randy (1961) und Janet (1966). Wir wären zehn Kinder gewesen, aber Brandon, Marlons Zwillingsbruder, starb bei der Geburt. Deswegen sagte Marlon bei der Trauerfeier 2009 in seiner Botschaft an Michael: „Bitte umarme unser Geschwisterchen, meinen Zwillingsbruder Brandon, an meiner Stelle.“ Das Band zwischen Zwillingen bleibt eben über den Tod hinaus bestehen.
Als Kinder erfuhren wir viel Zärtlichkeit von unserer Mutter. Es wird gern erzählt, dass wir eine unglückliche Kindheit voller Kälte und Distanz gehabt hätten, aber wir wuchsen ganz im Gegenteil in einem liebevollen Umfeld auf, mit einer Mutter, die uns viel küsste und in die Arme nahm. Die Stärke, die diese Liebe in uns erwachsen ließ, spüren wir alle noch heute. Ich war ein echtes Mamakind – ebenso wie Michael –, und wir beide, wie auch La Toya, kämpften stets um den begehrten Platz an Mutters Seite, eng an ihre Beine geschmiegt, die Hände an den Rock geklammert. La Toya gab sich dann immer alle Mühe, mich aus dem Feld zu schlagen.
Wenn Mutter nicht zu Hause war und wir Brüder miteinander Streit hatten, versuchte jeder sie auf seine Seite zu ziehen. „Versprich uns, dass du nichts erzählst, La Toya. Versprich es!“
„Versprochen“, sagte sie dann ganz überzeugend. „Ich verrate nichts!“ Sobald Mutter aber zur Tür hereinkam, war das Versprechen vergessen, und es folgte eine dramatische Schilderung der Ereignisse. „Mutter, Jermaine hat sich geprügelt.“ Wir hätten es ihr gern einmal richtig heimgezahlt, dass sie dauernd petzte. Sie war die stille Beobachterin, die sich alles merkte, um es später auszuplaudern. Notfalls erfand sie auch irgendwelche Geschichten – sie wollte sich einfach bei Mutter einschmeicheln, während ich zur Strafe zusätzliche Arbeiten im Haushalt aufgebrummt bekam. Aber später witzelten wir oft darüber, dass ich trotzdem sehr hoch in Mutters Gunst stand und „Mamas Liebling“ war, wie Rebbie das nannte.
„Du warst das Lieblingskind!“, meinte auch Michael, und das war schon ein bisschen dreist, weil er in ihren Augen auch nichts falsch machen konnte.
Ich fühlte mich jedenfalls nicht als etwas Besonderes, aber wenn Mutter mich wirklich jemals bevorzugt haben sollte, dann lag das vermutlich an einer Geschichte, die sich ereignete, als sie mit Michael schwanger war. Mit ungefähr drei Jahren wollte ich unbedingt ausprobieren, ob ich eine ganze Packung Salz essen konnte, und landete prompt mit Nierenversagen im Krankenhaus. Ich selbst kann mich an diese traumatische Erfahrung nicht mehr erinnern. Zwar war ich ein kräftiges Kind, aber ich musste trotzdem drei Wochen lang unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Mutter und Joseph konnten es sich nicht leisten, jeden Tag zu mir zu fahren. Wenn sie aber kamen, dann erzählte ihnen die Schwester, dass ich mir den ganzen Tag die Lunge nach ihnen aus dem Hals schrie. Und wenn sie sich wieder verabschiedeten, stand ich heulend auf meinem Bett. Ich bin heute froh, dass ich mich nicht an Mutters Gesichtsausdruck erinnere, wenn sie mich wieder allein lassen musste. Es sei ein schreckliches Gefühl gewesen, sagte sie später.
Schließlich durfte ich wieder nach Hause, aber vielleicht ist dieses Erlebnis eine Erklärung dafür, weshalb ich so empfindlich wurde und mich so übermäßig an sie klammerte, immer in der Angst, wieder alleingelassen zu werden. Am ersten Schultag riss ich mich von der Lehrerin los, rannte den Flur hinunter und hinaus auf die Straße, zurück zu meiner Mutter. „Du musst hierbleiben, Jermaine … du musst hierbleiben“, sagte sie damals mit einer Ruhe, die für mich dann alles wieder in Ordnung brachte. Ihr Einfühlungsvermögen beruht auf einem tiefen, unerschütterlichen Glauben an Gott, und dabei vermittelt sie stets eine Haltung, die irgendwo zwischen der Aura eines Jüngers und der Autorität eines Friedensrichters liegt. Sicher hat auch ihre Belastbarkeit ihre Grenzen, aber mit ihrer Gelassenheit konnte sie viele schwierige Situationen entschärfen.
Sie hat sich für uns aufgeopfert, schon allein dadurch, dass sie 81 Monate ihres Lebens mit uns schwanger war. Und sie war schön, mit ihrem gewellten schwarzen Haar und ihren makellosen Kleidern und mit dem perfekt aufgetragenen roten Lippenstift, der Flecken auf unseren Wangen hinterließ. Mutter war der Sonnenschein in dem Haus in der Jackson Street 2300.
Sie arbeitete als Teilzeitkraft im Kaufhaus Sears. Wir konnten es nie abwarten, dass sie von der Arbeit nach Hause kam. Ich denke heute noch voller Wärme daran, wie sie zur Haustür hereinkam, nachdem sie sich durch den tiefen Schnee des Winters in Indiana gekämpft hatte. Sie stand da, stampfte mit den Füßen auf der Matte und bewegte den Kopf hin und her, um die Schneeflocken abzuschütteln. Dann kam Michael – inzwischen der Schnellste von uns allen – auf sie zugerannt und umklammerte ein Bein, gefolgt von mir, La Toya, Tito und Marlon. Bevor sie den Mantel ablegte, zog sie die Hände aus den Taschen und hatte dann immer etwas zum Naschen für uns darin: zwei Tüten mit heißen spanischen Erdnüssen.
In der Zwischenzeit bereiteten Jackie und Rebbie in der Küche schon alles vor, damit Mutter mit dem Kochen anfangen konnte, bevor Joseph nach Hause kam. Wir nannten ihn immer Joseph. Nicht Vater. Oder Daddy. Oder Papa. Nur „Joseph“. Darum hatte er selbst gebeten. Das war für ihn eine Frage des Respekts.
Es gibt in den USA einen Kinderreim über eine alte Frau, die in einem Schuh lebt und so viele Kinder hat, dass sie gar nicht weiß, wie sie zurechtkommen soll. Das ist vielleicht ein passendes Bild, um das Leben in der Schuhschachtel zu beschreiben, um die es sich bei unserem Haus in der Jackson Street 2300 handelte. Neun Kinder, zwei Erwachsene, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Bad, eine Küche und ein Wohnzimmer auf einer Fläche von 10 mal 13 Metern. Von außen sah es so aus wie die typischen Häuser, die man als Kind malt: links und rechts ein Fenster neben der Eingangstür, und oben ragt ein Schornstein aus dem Dach. Unser Haus war in den 1940er-Jahren erbaut worden, eine Holzkonstruktion, die von einem so dünn gedeckten Pyramidendach gekrönt wurde, dass wir fest davon ausgingen, der erstbeste Tornado würde es herunterreißen. Es stand an der T-Kreuzung, an der die Jackson Street auf die 23. Avenue trifft.
Vorn führte ein kurzer Gartenweg vom Bürgersteig über den Rasen zu einer schwarzen, soliden Tür, die, wenn man sie hart zuschlug, das ganze Haus erzittern ließ. Dahinter lag das Wohnzimmer, in dem unter anderem das braune Sofabett stand, auf dem die Mädchen schliefen; die Küche und der Hauswirtschaftsraum befanden sich zur Linken. Geradeaus führte ein kleiner Flur, etwa zwei Schritte lang, rechts zum Jungenzimmer und links zum Elternschlafzimmer, neben dem sich auch das Badezimmer befand.
Die Jackson Street lag in einem ruhigen Viertel, das im Süden von der Schnellstraße Interstate 80 und im Norden von einer Bahnlinie begrenzt wurde. Der Weg zu unserem Haus war leicht zu beschreiben, weil es direkt neben der Theodore Roosevelt High School und einem Sportplatz lag. Der Maschendrahtzaun, der das Sportgelände einfasste, bildete das Ende der Sackgasse der 23. Avenue und bot einen freien Blick auf die Laufstrecke zur Linken und das Baseballfeld mit den Tribünen auf der anderen Seite zur Rechten. Joseph meinte immer, wir könnten uns glücklich schätzen, dass uns das Haus gehörte. Das war nicht bei allen in unserer Nachbarschaft so. Deshalb betrachteten wir uns auch nie als „arm“, denn die Leute in der Delaney-Siedlung – auf der anderen Seite der Schule – wohnten zur Miete in den Sozialbauten, die wir von unserem Grundstück aus sehen konnten. „Es gibt immer jemanden, der übler dran ist, egal, wie schlecht die Lage gerade erscheinen mag“, hieß es immer. Man konnte unsere Situation von daher wohl so beschreiben: Wir besaßen zwar nicht genug Geld, um neue Sachen zu kaufen, aber wir kamen irgendwie zurecht.
Mutter lernte, wie sie Lebensmittel lange einlagern konnte: Eine Kühltruhe war in der schwarzen Community wichtiger als ein Auto oder ein Fernseher. Es wurden große Portionen gekocht, eingefroren, wieder aufgetaut, gegessen. Oft kam immer wieder das Gleiche auf den Tisch: Pinto-Bohnen und Pinto-Suppe, Hühnchen, Hühnchen und noch mal Hühnchen, Eier-Sandwiches, Makrele mit Reis und so viel Spaghetti, dass ich heute noch keine Pasta mag. Aus Brausepulver machten wir uns Limonade. Wir bauten sogar selbst Gemüse an, denn Joseph hatte einen Schrebergarten in der Nähe und erntete Kartoffeln, Brechbohnen, Augenbohnen, Kohl, Rote Beete und Erdnüsse. Schon als kleine Kinder lernten wir, wie man säte und Stecklinge setzte, eine Reihe zog und darauf achtete, dass genug Abstand blieb, damit die Pflanzen gedeihen konnten. Wenn wir uns beschwerten, dass wir schmutzige Hände und Knie bekamen, und das taten wir oft, dann pflegte Joseph uns daran zu erinnern, dass er als Jugendlicher auf den Baumwollfeldern gearbeitet „und dabei jeden Tag dreihundert Pfund von dem Zeug gepflückt“ habe. Seiner Meinung nach war Mutter „die verdammt noch mal beste Köchin der ganzen Stadt“, und das Essen stand immer auf dem Tisch, wenn er zur Tür hereinkam. Sie halte das Haus perfekt in Ordnung, sagte er immer bewundernd. Alles war immer aufgeräumt und sauber. Deshalb sei sie, wie er meinte, die ideale Ehefrau.
Auch an Rebbie fand er in dieser Hinsicht nichts auszusetzen, denn sie übernahm schnell ebenfalls Hausfrauenpflichten – sie bereitete das Essen vor, kochte, machte sauber und achtete darauf, dass wir anderen unsere Aufgaben erledigten, wenn Mutter arbeitete. Rebbie war große Schwester und Kindermädchen in einer Person, und dementsprechend war sie streng, sanft, organisiert und kontrolliert. Meine stärkste Erinnerung an Rebbie ist, wie sie in der Küche steht und Kekse und kleine Kuchen für uns alle backt. Sie war außerdem das erste von uns Kindern, das „vielversprechende Ansätze“ zeigte, wie Joseph das nannte, als sie sich bei örtlichen Tanzwettbewerben anmeldete und gewann. Sie und Jackie traten manchmal auch als Paar an und räumten eine Reihe von Urkunden und Pokalen ab.
Mutter arbeitete unter der Woche, manchmal auch samstags oder in den Abendstunden, bei Sears an der Kasse. In diesem noblen Kaufhaus selbst einzukaufen, konnte sie sich nicht leisten. Und wenn sie es doch einmal tat, dann handelte es sich meist um Ratenkäufe, bei denen sie sich etwas mit einer Anzahlung sicherte und es dann erst später, wenn sie das Geld zusammenhatte, mit nach Hause nahm. Sears war für uns wie Harrods. Wir alle fanden es schrecklich, wenn wir sahen, wie Mutter Geld über den Tresen reichte und trotzdem mit leeren Händen nach Hause ging. Wir verstanden das einfach nicht. Für uns Kinder war das schwer, und wir beklagten uns häufig, Mutter hingegen nie. Sie biss sich weiter durch und vertraute auf Gott. Wenn sie einmal etwas Zeit hatte, dann las sie in der Bibel.
Mit zwei Jahren war sie an Kinderlähmung erkrankt und behielt davon eine Teillähmung zurück. Bis sie zehn war, hatte sie eine Beinschiene aus Holz tragen müssen. Ich weiß nicht viel darüber, wie schwer sie als Kind gelitten hat, aber sie wurde mehrfach operiert, versäumte viel Zeit in der Schule und behielt ein leichtes Humpeln zurück, weil eines ihrer Beine kürzer ist als das andere. Aber ich habe nie ein Wort der Klage von ihr gehört. Stattdessen pflegte sie zu sagen, dass sie dankbar sei, eine Krankheit überlebt zu haben, an der viele andere Menschen starben. Sie hatte davon geträumt, Schauspielerin zu werden, aber sie zeigte kein bisschen Verbitterung darüber, dass ihr das aufgrund der Erkrankung nicht mehr möglich war. Wegen der körperlichen Beeinträchtigungen wurde sie von anderen Kindern oft gehänselt, und daher war sie stets sehr unsicher und schüchtern. Bei einem der ersten Treffen mit Joseph, als die beiden eine Tanzveranstaltung besuchten und zu einem langsamen Lied schwoften, begann Mutter, damals neunzehn Jahre alt, zu zittern. „Was ist denn los, Katie?“, fragte Joseph.
„Alle starren uns an“, sagte sie und traute sich nicht einmal, den Kopf zu heben.
Er sah sich um und stellte fest, dass sie das einzige Paar auf der Tanzfläche waren. Andere Gäste zeigten auf sie und tuschelten hinter vorgehaltener Hand, vermutlich deswegen, weil Mutter ein kürzeres Bein hatte und deswegen einen Schuh mit einem Keil trug, um den Unterschied auszugleichen. Als Jugendliche hatte sie Partys und gesellschaftliche Anlässe gefürchtet, aber Joseph ignorierte die Blicke und sah die Sache positiv. „Wir haben jetzt doch richtig viel Platz, Katie“, sagte er. „Komm, wir tanzen weiter.“
Mutter war als Kind aus Alabama nach Indiana gekommen, weil Papa Prince sich um Arbeit in der Stahlindustrie bemühte. Sie hatte immer davon geträumt, eines Tages einen Musiker kennenzulernen, und Joseph, der Gitarre spielte, erfüllte diese Anforderung durchaus. Sie gingen ein Frühjahr und einen Sommer lang miteinander aus, bevor sie heirateten. Getroffen hatten sie sich auf der Straße – oder vielmehr, Mutter befand sich draußen auf der Straße, und Joseph saß im Haus am Fenster, als sie auf dem Fahrrad an ihm vorüberfuhr. Sie tauschten Blicke aus, und sie nahm noch eine Woche oder zwei dieselbe Strecke, bis Joseph sich endlich ein Herz fasste, nach draußen kam und sich vorstellte. Daraufhin verabredeten sie sich für ein erstes Treffen im Kino und später dann zu besagter Tanzveranstaltung. Katie Scruse, das Mädchen mit der goldenen Haut, das so schüchtern war, dass es sich nicht traute, anderen ins Gesicht zu sehen, verliebte sich in Joseph Jackson, den hageren, großmäuligen, charismatischen Arbeiter. Sie wurden im November 1949 von einem Friedensrichter getraut und kauften unser Elternhaus in Gary zum Preis von 8.500 Dollar. Einen Teil der Summe brachte Joseph durch seine Ersparnisse auf, den Rest lieh ihnen Mutters Stiefvater.
Aus den geplanten drei Kindern wurden vier, dann fünf und so weiter. Sie versuchten, das bisschen Geld, das Mutter verdiente, zu sparen, denn sie hoffte darauf, dass Joseph eines Tages ein zusätzliches Zimmer würde anbauen können, damit alle mehr Platz hätten. In meiner Kindheit lagen im Garten hinterm Haus einige Reihen Betonsteine aufgestapelt, die allein mit ihrer Gegenwart immer wieder mahnend daran erinnerten, dass meine Mutter gern ein größeres, besseres Haus gehabt hätte.
Die Erinnerung an unser kleines Haus ist für mich mit den verschiedensten Dingen verbunden. Dass es so beengt war, wir uns alle um Mutter scharten und uns ständig gegenseitig auf die Füße traten, machte es nicht gerade besonders gemütlich, aber es war ein Spiegel dessen, was meine Eltern ständig predigten: Zusammenhalten und Zusammenrücken. Ein so enger Verbund schafft Loyalität. Und aus Loyalität erwächst Stärke. Das wurde uns eingebläut. Deswegen wurden wir zu einer Einheit, die nur geschlossen vorging. Das konnten in Gary die wenigsten Familien von sich behaupten. Gary war eine Arbeiterstadt, die 1906 mit der Muskelkraft afroamerikanischer Einwanderer errichtet worden war, die auf den Sanddünen und dem Buschland im Nordwesten von Indiana einen wichtigen Standort der Stahlindustrie aus dem Boden stampften.
Die alten Männer erzählten gern, dass die Arbeitsmoral damals von Blut, Schweiß und harter Plackerei bestimmt wurde. Die Männer in Gary hatten keine Angst davor, Überstunden zu machen und sich abzurackern. „Wer wirklich hart arbeitet, der kommt auch voran“, sagte Joseph. „Man bekommt zurück, was man einzahlt.“ In den Augen seiner Vorväter hatte man etwas „geleistet“, wenn man eine gut bezahlte Arbeit und ein eigenes Haus vorweisen konnte, aber er wollte immer, dass wir einmal höhere Ziele verwirklichten als er. Niemand von uns bekam den typischen Spruch vieler Väter zu hören: „Hör auf mit der Tagträumerei und such dir einen richtigen Job!“ Nein. Unser Vater wollte, dass wir einen Traum hatten und dass wir ihn in die Tat umsetzten.
Etwa 90 Prozent der Bevölkerung von Gary und Umgebung fanden Arbeit bei Inland Steel, kurz „die Fabrik“ genannt, die eine halbe Autostunde entfernt im angrenzenden East Chicago lag. Joseph war dort Kranführer und transportierte Stahlträger von einem Ort zum anderen. Es war eine harte Arbeit in Schichten von acht oder zehn Stunden. Wenn er oben in seiner verglasten Kanzel saß, gingen seine Gedanken oft zurück zu seiner Kindheit in Durmott, einem Ort südlich von Little Rock in Arkansas. Als junger Mann hatte er sein Taschengeld für Kinobesuche ausgegeben und sich Stummfilme angesehen, und er hatte sich stets gesagt, dass er eines Tages der erste Schwarze sein werde, der in einem solchen Streifen auftrat. Schichtarbeit in der Fabrik kam diesem Traum nicht gerade nahe. Es war Sklavenarbeit, ganz in der Tradition dessen, was schwarze Männer vor ihm schon immer hatten leisten müssen. „Es geht darum, aufzusteigen, nicht darum, unten zu bleiben“, pflegte er zu sagen.
Nach seiner Ankunft in Indiana, noch bevor er Mutter kennenlernte, hatte er bei der Eisenbahn gearbeitet. Dann bekam er einen Job in einer Eisengießerei und bediente einen Dampfhammer in der Hitze eines großen Hochofens. „Hitze? Da sind Männer umgekippt“, erzählte er. „Wir arbeiteten immer nur ganz kurz, zehn Minuten lang, und dann mussten wir da wieder raus, weil die Böden glühend heiß waren.“ Damals bestand er nur aus Haut und Knochen. Er konnte essen, so viel er wollte, und nahm doch nicht zu, weil die Arbeit so kräftezehrend war. Ein wenig lag das allerdings wohl auch an seinem Stoffwechsel, den die meisten von uns von ihm geerbt haben, vor allem Michael. Die schlimmste Arbeit, die Joseph je übernahm, bestand darin, Asche aus dem Hochofen zu kehren. Hier war seine hagere Gestalt besonders nützlich, weil er dabei an einem Seil in einem Eimer einen Abzug hinuntergelassen wurde, der lediglich einen Meter Durchmesser hatte. Verglichen mit solchen Geschichten kam mir der Job eines Kranführers geradezu glamourös vor.
Es soll jedenfalls niemand sagen, Joseph wisse nicht, was harte Arbeit war. Solche Jobs konnten nur Männer verrichten, die innerlich gefestigt und wirklich stark waren, und er hatte sich die Finger blutig gearbeitet, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich glaube, deswegen ist ihm „Respekt“ so wichtig. In seinen jungen Jahren hatte er lange in untergeordneten Positionen gearbeitet, und seine Wurzeln lagen ebenso wie bei Mutter in der Sklaverei, aber er hatte sich Respekt verdient, und daher erwartete er ihn auch von seiner Familie. Im Gegenzug war er sich der eigenen Verantwortung bewusst. Je mehr Kinder er hatte, desto mehr Überstunden machte er, um zusätzlich Geld zu verdienen. Als Michael geboren wurde, hatte er einen zweiten Job angenommen und übernahm noch ein paar Schichten in einer Konservenfabrik.
Uns Kindern war bewusst, dass Geld immer knapp war. Unsere Eltern brachten zusammen um die 75 Dollar nach Hause. Sie waren zu stolz, um Sozialhilfe zu beantragen, und daher räumten Tito und ich beispielsweise im Winter den Schnee von den Einfahrten unserer Nachbarn, um zusätzlich Geld zu verdienen. Dass Joseph seine Lohntüte bekommen hatte, merkten wir immer daran, dass ein frischer Laib Brot und ein Päckchen Frühstücksfleisch auf der Arbeitsfläche in der Küche lagen. Mehr als einmal wurde Joseph jedoch auch entlassen und später wieder eingestellt. In der Zwischenzeit half er bei der Kartoffelernte. Wir wussten immer, wenn im Stahlwerk wieder einmal Schluss gewesen war, denn dann kamen nur Kartoffeln auf den Tisch – gebacken, gekocht, geröstet oder als Brei.
Inland Steel war für Generationen von Familien die große Hoffnung. In Gary sagte man, dass man im Leben nur drei Möglichkeiten besaß: Fabrik, Knast oder Tod. Die letzten beiden bezogen sich auf die Gang-Kriminalität, die Schattenseite unserer Gemeinschaft. Doch ganz egal, welche der drei Möglichkeiten das Schicksal für uns vorgesehen hatte, Joseph war fest entschlossen, den Lauf der Dinge zu verändern. Jede Stunde, die er arbeitete, dachte er an nichts anderes. Unsere Flucht war auch die seine und die von Mutter.
Joseph stammte aus einer Familie mit sechs Kindern, vier Jungen und zwei Mädchen. Er war der Älteste und stand besonders der Schwester nahe, die nach ihm zur Welt gekommen war, Verna Mae. Unsere Schwester Rebbie erinnere ihn sehr an sie, sagte er immer – pflichtbewusst, freundlich, eine richtige kleine Hausfrau, die trotz ihrer jungen Jahre schon sehr reif und erwachsen wirkte. Joseph fand es wundervoll, wie sich Verna Mae um den Haushalt und die anderen Kinder kümmerte, und seine liebste Erinnerung war, wie sie im Alter von sieben Jahren beim Licht einer Öllampe saß und den Brüdern Lawrence, Luther und Timothy eine Gutenachtgeschichte vorlas. Dann wurde sie krank, und Joseph konnte nichts tun, um ihr zu helfen. Die Ärzte fanden nicht einmal heraus, woran sie litt. Verna Mae selbst verbreitete noch vom Krankenbett aus Optimismus. „Alles ist gut. Ich werde wieder gesund.“ Aber Joseph musste von der Tür aus mit ansehen, wie es ihr immer schlechter ging, während die Erwachsenen um ihr Bett herumstanden. Dann starb sie. Joseph weinte tagelang und konnte diesen Verlust nie verwinden. Soweit ich das verstanden habe, war es das letzte Mal, dass er eine Träne vergoss: Er war elf Jahre alt.
Als selbsternannte Weicheier fanden Michael und ich es immer schrecklich, dass unser Vater so hart war. Keiner von uns kann sich daran erinnern, dass er sich je Verletzlichkeit anmerken ließ. Wenn wir als Kinder weinten, auch, nachdem er uns gezüchtigt hatte, schimpfte er mit uns: „Wieso heult ihr denn?“
Joseph verbrachte seine prägenden Jugendjahre damit, um seine Schwester zu trauern. Bei ihrer Beerdigung, als er hinter dem Pferdewagen mit dem Sarg herging, schwor er, dass er nie wieder ein Grab sehen wolle. Dieser große Verlust in seinem Leben schloss all seine Emotionen ein, und Joseph hielt Wort: Er ging nie wieder auf eine Beerdigung. Bis zum Jahr 2009.
Während seiner Schulzeit hatte Joseph Angst vor einer Lehrerin. Er war besonders angehalten, Respekt vor den Lehrern zu haben, weil sein Vater Direktor der örtlichen High School war und an strenge Disziplin durch körperliche Züchtigung glaubte. Die furchteinflößende Frau machte Joseph offenbar so viel Angst, dass er schon zu zittern begann, wenn sie nur seinen Namen aufrief. Einmal, so wurde uns erzählt, sollte er vor die Klasse treten und vorlesen, was an der Tafel stand. Zwar wusste er genau, welche Worte es waren, aber die Angst verschlug ihm die Sprache. Die Lehrerin fragte ihn ein zweites Mal. Als er wieder keine Antwort gab, folgte die Strafe auf dem Fuße, in Form eines hölzernen Bretts, das er auf den nackten Hintern bekam. Das Ding hatte noch dazu Löcher, damit es bei jedem Schlag auch richtig zog. Während sie ihn bestrafte, sagte sie ihm auch, wieso er die Prügel bekam: Er hatte ihr nicht gehorcht, als er nicht laut lesen konnte. Zwar hasste er sie dafür, aber er respektierte sie auch. „Aus diesem Grund hörte ich ihr zu und gab immer mein Bestes“, sagte er.
Genauso war es, wenn Papa Jackson ihn schlug. So war er erzogen worden, nach der alten Maxime, dass man jemandem, den man kontrollieren will, erst einmal eine Heidenangst einjagen muss. Diese Lehre wurde ihm sozusagen Schlag für Schlag eingetrichtert. Einige Wochen später veranstaltete dieselbe Lehrerin einen Talentwettbewerb, und die Schüler durften sich dabei aussuchen, was sie tun wollten – Gedichte, eine Kurzgeschichte, eine Theaterszene schreiben oder malen. Joseph hatte keine künstlerische Ader, er verstand sich nicht auf Worte – er hatte sich immer nur Stummfilme angesehen. Ihm fiel nur eins ein, die Stimme seines Vaters, wenn der „Swing Low, Sweet Chariot“ sang. Also beschloss er zu singen, aber als er an die Reihe kam, zitterte er so sehr, dass seine Stimme flatterte und er kaum einen Ton traf, und die ganze Klasse fing an zu lachen. Mit dem Gefühl der Erniedrigung kehrte er auf seinen Platz zurück und erwartete wieder Schläge. Als die Lehrerin zu ihm trat, duckte er sich. „Du hast sehr schön gesungen“, sagte sie jedoch. „Sie lachen, weil du nervös warst, und nicht, weil du schlecht warst. Das war ein guter Versuch.“
Als er von der Schule nach Hause ging, schwor sich Joseph, er würde es ihnen zeigen, und er begann von einem Leben im Showgeschäft zu träumen. Von dieser Geschichte erfuhr ich erst vor kurzer Zeit, als er sie plötzlich wieder ausgrub, vielleicht bei dem Versuch, ihr im Licht der jüngsten Ereignisse neue Bedeutung zu verleihen. Ich glaube nicht, dass einer von uns Jacksons sich je besonders viel Mühe gegeben hat, sich intensiver mit unserer Familiengeschichte zu beschäftigen oder auch nur darüber zu reden. Michael sagte einmal, dass er Joseph nie wirklich gekannt habe. „Das ist traurig für einen Sohn, der seinen Vater immer verstehen wollte“, schrieb er 1988 in seiner Autobiografie Moonwalk – Mein Leben.
Joseph hat vermutlich etwas an sich, das sich nicht entschlüsseln lässt. Es ist schwer, hinter seine Mauern zu dringen, die er sich vielleicht aus Verlustängsten heraus erbaut und mit seinem Bedürfnis nach Respekt verstärkt hat. Keiner von uns kann sich je daran erinnern, dass er uns umarmt oder mit uns gekuschelt hätte oder dass er je „Ich habe dich lieb“ gesagt hätte. Er hat nie mit uns herumgerangelt oder uns abends ins Bett gebracht, und es gab auch keine innigen Vater-Sohn-Gespräche über das Leben. Wir alle erinnern uns an Respekt, an Anweisungen, an Aufgaben und Befehle, aber nicht an Zuneigung. Wir kannten unseren Vater und wussten, wie er war. Ein Mensch, der wollte, dass andere zu ihm aufsahen, und dem es wichtig war, seine Familie zu versorgen – ein richtiger Kerl eben.
Wenn man das akzeptierte, dann kannte man ihn tatsächlich ein wenig – so weit das eben möglich war. Aber auch, wenn es Michael sehr schwerfiel, mit Josephs Art zurechtzukommen, er versuchte doch stets, ihn zu verstehen, und er richtete nicht über ihn. Traurig war allerdings, dass Michael diese Hintergrundgeschichte, die ich gerade erzählt habe, vermutlich nie gehört hat. Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen ihre Eltern in erster Linie als „Mutter“ und „Vater“ und nicht als die Menschen, die sie waren, bevor sie selbst Kinder bekamen. Aber je mehr wir über die Kindheit und Jugend unserer Eltern wissen, desto besser können wir vielleicht verstehen, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Die Geschichten aus Josephs Schulzeit erklären jedenfalls eine ganze Menge, glaube ich.
Im Gegensatz zu den meisten Arbeitern in Indiana träumte Joseph nicht nur von einem Leben in Kalifornien, ohne zu wissen, wie es dort wirklich war. Er hatte tatsächlich schon eine kurze Zeit im Westen gelebt und war auf den Geschmack gekommen. Seine Ziele waren eng verbunden mit den Sonnenuntergängen über dem Pazifik und dem Anblick des Hollywood-Schriftzugs. Mit 13 Jahren war er aus Arkansas nach Oakland in der Bucht von San Francisco gezogen, und auf der Zugfahrt dorthin war er durch Los Angeles gekommen. Grund für den Ortswechsel war, dass sein Vater von der Affäre erfuhr, die Josephs Mutter Chrystal mit einem Soldaten hatte. Er gab seine Stelle als Lehrer auf und fand in Oakland Arbeit auf einer Werft. Dabei war Samuel Jackson zunächst allein aufgebrochen und hatte Joseph zu Hause zurückgelassen. Drei Monate später, nachdem viele bittende Briefe zwischen Vater und Sohn hin- und hergegangen waren, fällte Joseph „die allerschwerste Entscheidung“ und ging in den Westen. Noch mehr Briefe folgten, dieses Mal zwischen Joseph und seiner Mutter. Unser Vater war offenbar schon als Kind mit einer großen Überzeugungskraft gesegnet gewesen, denn einige Monate später verließ Chrystal Jackson ihren neuen Freund und kehrte zu dem Mann zurück, von dem sie sich erst kürzlich hatte scheiden lassen.
Das Familienglück hielt ein Jahr, bevor Chrystal wieder nach Osten zog, um ein neues Leben mit einem anderen Mann in Gary, Indiana, anzufangen. Joseph fühlte sich vermutlich wie der Strick bei dem Tauziehen, das zwischen seinen Eltern stattfand. Dabei war gerade er ein Mensch, dem der Zusammenhalt und der Familienverband so unendlich wichtig waren. Ich weiß nicht, wie er das aushielt. Ich weiß nur, dass er sich eines Tages in den Bus setzte und von Oakland nach Gary fuhr. Er fand die Stadt zunächst „klein, dreckig und hässlich“, aber seine Mutter lebte dort, und wenn ich heute zwischen den Zeilen lese, dann glaube ich, dass er sich ein wenig wie eine „Berühmtheit“ fühlte – für die anderen Jugendlichen in seinem Alter kam er nicht aus Arkansas, sondern aus Kalifornien, und mit seinen Geschichten vom Leben an der Westküste war ihm die Aufmerksamkeit der Mädchen von Gary sicher. Und so blieb der sechzehnjährige Joseph mit seiner Mutter in Indiana, aber in Gedanken hielt er daran fest, dass er eines Tages nach Kalifornien zurückkehren würde. „Wir gehen in den Westen. Wartet nur ab, bis ihr gesehen habt, wie es dort ist“, pflegte er zu uns zu sagen, wie ein Entdecker, der seine Reise nur kurz unterbrochen hat, um sein großes Abenteuer zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufzunehmen.
Die Jahre harter Arbeit hatten Falten und Furchen in Josephs Gesicht hinterlassen, er hatte buschige Brauen, die den Eindruck vermittelten, als runzele er beständig die Stirn, und nussbraune Augen, die direkt bis auf den Grund der Seele seines Gegenübers sehen konnten. Ein strenger Blick genügte uns Kindern, damit wir zu zittern anfingen. Aber wenn er von Kalifornien sprach, wurden seine Züge weicher. Er erinnerte sich an den „goldenen Sonnenschein“, an die Palmen, an Hollywood und überhaupt daran, dass die Westküste „der beste Ort zum Leben“ sei. Keine Verbrechen, saubere Straßen und zahlreiche Möglichkeiten, um bis ganz nach oben zu kommen. Wenn wir Fernsehserien wie Maverick guckten, dann zeigte er uns die Straßen, die er kannte. Im Laufe der Zeit wurde Los Angeles für uns auf diese Weise zu einem fiktiven Paradies, wie ein entfernter Planet: Wenn Menschen zum Mond zu fliegen vermochten, dann konnten wir vielleicht auch eines Tages nach L.A. reisen. Wenn die Sonne in Indiana unterging, dann sagten wir immer: „Bald geht die Sonne in Kalifornien unter.“ Wir wussten: Irgendwo da draußen gab es einen Ort und ein Leben, die besser waren als unsere aktuelle Wirklichkeit.
Lange bevor Michael zu Welt kam, als Mutter noch mit mir schwanger war, unternahm Joseph erste Schritte, um eines Tages „den Durchbruch zu schaffen“. Gemeinsam mit seinem Bruder Luther und ein paar Freuden gründete er eine Bluesband namens The Falcons, in der er Gitarre spielte. Als ich zur Welt kam, hatten sie schon ein gutes Programm ausgearbeitet und traten auf Partys und in kleinen Clubs im Ort auf, um zusätzlich ein wenig Geld zu verdienen. Wenn er oben in seiner Krankanzel saß, komponierte Joseph Songs, schob die Stahlträger gewissermaßen per Autopilot hin und her und dachte im Singer-Songwriter-Modus über Texte nach.
1954, als ich geboren wurde, schrieb er angeblich einen Song, der „Tutti Frutti“ hieß. Ein Jahr später veröffentlichte Little Richard einen Hit mit demselben Namen. Wir wuchsen mit der Legende auf, dass Little Richard den Song von unserem Vater „geklaut“ habe. Das stimmte natürlich nicht. Was aber zählte, das war, dass ein Schwarzer aus dem Nichts einen Song geschrieben hatte, der die ganze Musik neu definierte – „der Sound der Geburt des Rock’n’Roll“. Es war diese Möglichkeit, die sich tief in unsere Köpfe einbrannte, jedes Mal, wenn diese Geschichte erzählt wurde.
Zwar kann ich mich nicht direkt an Proben der Falcons erinnern – jedenfalls an nichts, was auch nur ansatzweise dem geglichen hätte, wie Proben später bei uns aussahen – aber ich weiß noch, wie Onkel Luther, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, mit ein paar Dosen Bier und seiner Gitarre bewaffnet zu uns kam und dann mit Joseph zusammen Riffs spielte, während wir dabeisaßen und alles in uns aufsogen. Onkel Luther spielte den Blues, und Joseph wechselte zwischen Gitarre und Mundharmonika. Manchmal war das der Soundtrack, zu dem wir abends einschliefen.
Josephs Träume von der Musikerkarriere zerplatzten mit der Trennung der Falcons, nachdem einer der anderen Musiker, Pookie Hudson, die Band verließ und seine eigene gründete. Aber Joseph entspannte sich am Feierabend trotzdem oft beim Gitarrespielen. Anschließend stellte er das Instrument an seinen angestammten Platz in den Wandschrank im Schlafzimmer. Tito, der sich als Erster von uns fürs Gitarrespielen begeisterte, umschlich den Wandschrank wie einen unverschlossenen Safe mit einem Goldschatz, aber wir alle wussten, dass dieses Instrument Josephs ganzer Stolz war – und deshalb tabu. „Denkt nicht mal daran, meine Gitarre anzufassen!“, warnte Joseph uns alle, bevor er zur Arbeit ging.
Wir fünf Jungen teilten uns ein Kinderzimmer – die beste Garderobe, die wir je hatten. In dieser Enge wurden wir zu besten Freunden. Und der brüderliche Zusammenhalt wird bis heute mit jedem Jahr stärker. Wir sind die Einzigen, die zueinander sagen können: „Vergesst nicht, wie es war. Vergesst nicht, was wir miteinander teilten. Vergesst nicht, woher wir kamen und wer wir waren.“
Oder, wie Clive Davis es einmal ausdrücken sollte: „Blut ist dicker als Dreck.“ Wir waren in Gary unzertrennlich, immer zusammen, Tag und Nacht. Wir teilten uns ein dreistöckiges Etagenbett aus Metall. Es war gerade so lang wie die Rückwand des Zimmers und so hoch, dass Tito und ich nur einen guten Meter unterhalb der Decke schliefen, er mit dem Kopf an meinen Füßen und umgekehrt. Das Bett in der Mitte gehörte Michael und Marlon, und Jackie hatte das unterste für sich allein. Jackie war der Einzige von uns, der nicht wusste, wie es war, wenn man mit einem Fuß im Auge, Ohr oder Mund aufwachte. Die Mädchen, Rebbie und La Toya, schliefen auf dem Sofabett im Wohnzimmer (später mit unserem Bruder Randy und unserer jüngsten Schwester Janet), und so war wirklich jeder Raum bis an die Grenze ausgelastet. Man stelle sich vor, dass Rebbie, immerhin die Älteste, niemals ein eigenes Zimmer hatte!
Wir Brüder verbrachten viel Zeit in unserem Refugium, dessen Fenster auf die 23. Avenue hinausgingen. Jeder Abend war so, als übernachte man bei Freunden. Wir gingen alle, unabhängig von unserem Alter, ungefähr zur selben Zeit ins Bett – um halb neun oder neun Uhr – und veranstalteten Kissenschlachten, rangen miteinander oder redeten uns noch eine gute Stunde die Köpfe heiß und planten den nächsten Tag, bevor wir einschliefen.
„Ich habe die Rollschuhe, also bin ich morgen mit Fahren dran!“
„Ich habe den Baseballschläger und einen Ball, wer spielt mit?“
„Wir bauen ein Go-Kart, wer macht mit?“
Wir zogen die Laken von den Betten und legten die Matratzen auf den Boden, dann bauten wir Türme aus Büchern und zogen die Laken darüber, um ein Zeltdach zu simulieren. Wir liebten es, in selbstgebauten Höhlen auf dem Boden zu schlafen. Und auch ohne Höhle – es war immer ein bisschen so wie beim Camping.
Morgens weckten wir uns gegenseitig. „Bist du wach, Jermaine?“, hörte ich Michael flüstern. „Jackie?“ Auf dessen Antwort warteten wir meist lange, denn er döste gern noch ein paar Minuten.
Dann kam der Ansturm aufs Badezimmer, das wir laut Vereinbarung jeweils nur eine Viertelstunde blockieren durften. Sobald einer rauskam, schlüpfte der nächste rein, und oft hörten ich Mutters Mahnung: „Jermaine! Deine Viertelstunde ist um!“
Die Morgenstunden zu Hause waren wunderbar. Ich liebte das Chaos in der Küche, und ich fand es herrlich, im Bett kurz nach dem Aufwachen schon ein bisschen Harmoniegesang zu üben. Wir mussten uns gar nicht anschauen, wir lagen einfach da und sangen. Wir sangen eigentlich immer, auch wenn wir uns nützlich machen mussten, sei es, dass wir das Haus neu anstrichen, Wäsche wuschen, den Rasen mähten oder bügelten. Es war unsere Art, selbst für Unterhaltung zu sorgen, damit die Arbeit nicht so langweilig war, und wir „coverten“ die Hits, die wir zu Hause hörten – Songs von Ray Charles, Otis Redding, Smokey Robinson & The Miracles oder Major Lance (dessen Keyboarder ein damals noch unbekannter Musiker namens Reggie Dwight war, heute besser bekannt unter dem Namen Sir Elton John).
Michael sprach später oft von dem „Spaß“, den wir in unserem kleinen Zimmer hatten. Ich glaube, er sehnte sich nach dieser Zeit zurück, als er gewissermaßen jeden Abend bei seinen Brüdern übernachtete. Wenn wir später als Erwachsene bei Familientreffen zusammenkamen oder auch wenn nur wir Brüder uns sahen, dann saßen wir meist im kleinsten Raum zusammen, ganz instinktiv, bis uns einmal jemand darauf aufmerksam machte, dass es doch irgendwie ein bisschen komisch war, sich in Häusern wie Neverland oder Hayvenhurst ausgerechnet im kleinsten Winkel zusammenzuquetschen. Aber offenbar fanden wir das Gefühl schön, so eng beieinander zu sein. Es fühlte sich vertraut an, wie „zu Hause“.
Auch etwas anderes wurde uns erst im Erwachsenenalter klar: Mutter und Joseph hatten abends in ihrem Schlafzimmer auf der anderen Seite des Flurs gelegen und durch die Wand hindurch gehört, wie wir alle sangen, vom dreijährigen Michael bis zum elfjährigen Jackie. „Die ganze Nacht haben wir euch singen hören, und morgens auch“, erinnerte sich Mutter später. Aber ich glaube, dass Joseph das damals noch nicht mit seinem kalifornischen Traum in Verbindung brachte. Das kam erst, als Tito seine geliebte Gitarre kaputtmachte – und wir um unser Leben singen mussten.
Joseph hatte einen dunkelbraunen Buick, der wie ein zorniger Fisch aussah, wenn er auf einen zugerollt kam. Scheinwerfer, Kühlergrill und die leicht spitz zulaufende Haube ergaben zusammen das Bild eines furchteinflößenden Gesichts, das die Zähne fletschte. Ich weiß nicht, ob damals wirklich Autos mit Motoren gebaut wurden, die schnurrten, aber dieses Auto schnurrte ganz sicher nicht, genauso wenig wie Joseph selbst!
Rückblickend hat es etwas Komisches, dass dieser „zornige Fisch“ unser Frühwarnsystem war, das ankündigte, wenn unser Vater sich dem Haus näherte. Wenn wir draußen auf der Straße spielten und einer von uns die grimmige Fratze in der Ferne auftauchen sah, brüllte er: „Aufräumen! Schnell aufräumen!“ Wir ließen alles stehen und liegen, rannten ins Haus und machten schneller als Mary Poppins mit ihrem Zauberstab in unserem Zimmer Klarschiff. In der Eile schnappten wir alle herumliegenden Kleidungsstücke und schoben sie zusammengerollt in den Schrank oder in die Schubladen der Kommode, einfach irgendwohin, ohne sie zusammenzulegen. „Das habe ich euch nicht so beigebracht“, pflegte Mutter uns sanft zu rügen, wenn sie wieder einmal einen Haufen Kleider in einem Laken zusammengepackt in der hintersten Schrankecke entdeckte. Uns ging es indes einfach nur darum, dass oberflächlich alles sauber und ordentlich war: Solange der erste Eindruck stimmte, waren wir aus dem Schneider. Außerdem wussten wir, dass Mutter, wenn wir in der Schule waren, in unser Zimmer gehen, alles ordentlich zusammenlegen und wegpacken würde, ohne ein Wort zu sagen.
Es ist kein Wunder, dass Michael und ich später als Erwachsene unsere Klamotten dort liegen ließen, wo wir sie gerade ausgezogen hatten, und wir beide führten denselben Grund zu unserer Verteidigung an: Wenn man in seiner Kindheit mit vielen Brüdern sein Zimmer teilt, dann kann man sich auch im größten Durcheinander perfekt orientieren und weiß genau, wo sich die eigenen Sachen befinden. Bei Mutter kamen wir jedenfalls mit weitaus mehr durch. Sie war auch streng, keine Frage, und wenn wir uns nicht gut benahmen, dann bekamen wir auch von ihr gelegentlich mal eine kräftige Ohrfeige. Aber Mutter blieb doch eher gelassen, während Josephs Geduldsfaden nach einem harten Tag in der Fabrik äußerst leicht und unerwartet riss. Wir hörten auf das, was Mutter sagte: Respektiert, dass euer Vater zu Hause ist, respektiert, dass er hart gearbeitet hat, respektiert, dass er seine Ruhe haben und keinen Lärm hören will.
Und tatsächlich trat dieser Respekt mit ihm durch die Tür, wenn er nach Hause kam, und die Atmosphäre im Haus wurde angespannt. Josephs erste Regel, an die man sich zu halten hatte, war ganz einfach: Ich sage es dir einmal, und wenn ich es noch einmal sagen muss, setzt es was. Bei unserer stetig wachsenden Kinderschar musste er natürlich öfters etwas zweimal sagen. Jackie, Tito und ich wussten aus schmerzlicher Erfahrung, was dann folgte. Michael und Marlon waren zwar noch klein, spürten aber deutlich unsere Angst – zuerst. Wenn Joseph wütend wurde, dann reichte ein Blick in sein Gesicht, auch ohne dass er etwas sagte. Er hatte ein Muttermal von der Größe eines Zehn-Cent-Stücks auf der Wange, und ich sehe es noch immer vor meinem geistigen Auge, ganz nahe vor mir: Wenn er richtig in Zorn geriet, dann legte es sich ebenso in Falten wie sein ganzes Gesicht. Gewitterwolken zogen auf, bevor dann der erste Donner grollte und mit den gefürchteten Worten „Ab in dein Zimmer, und da wartest du auf mich!“ der Blitz einschlug, in Form eines über die Haut zuckenden Ledergürtels, dessen Biss einem das Wasser in die Augen trieb. Normalerweise bekamen wir zehn „Whops“, die ich so nannte, weil das dem Geräusch entsprach, das der Gürtel machte, wenn er durch die Luft pfiff. Ich bettelte um Erbarmen, schrie nach Gott, nach Mutter, nach jedem, der mir sonst noch einfiel, aber Joseph brüllte nur noch lauter und erinnerte uns daran, weshalb wir gezüchtigt wurden. Begründete Disziplinierung, so wie er es selbst als Schuljunge hatte erfahren müssen.
Wenn wir bestraft wurden, dann hörte Michael natürlich unsere Schreie, und zur Schlafenszeit sah er die roten Striemen und die Spuren der Gürtelschnalle auf der nackten Haut. Daher fürchtete er sich vor dieser Züchtigung, schon lange, bevor er sie das erste Mal zu spüren bekam. Für ihn war der bloße Gedanke daran, von Joseph bestraft zu werden, traumatisch. So ist das mit übertriebener Angst: Sie sorgt dafür, dass eine Sache in der Vorstellung Ausmaße annimmt, die sie vielleicht in der Realität niemals haben wird.
Seit einiger Zeit hatten wir eine weiße Maus im Haus, und Joseph wollte sie unbedingt erwischen, weil die Mädchen jedes Mal völlig durchdrehten und wild kreischten, wenn sie irgendwo herumwuselte. Joseph war ratlos, wieso wir plötzlich mit einem Mäuseproblem konfrontiert waren. Er hatte eben nicht damit gerechnet, dass sich hier erstmals Michaels große, lebenslange Verbundenheit mit Tieren zeigte.
Michael hatte die Maus, ohne dass jemand von uns etwas davon merkte, zu seinem Haustier erkoren und sie mit kleinen Stückchen Käse und Salat angefüttert. Rückblickend passte alles gut zusammen: Wenn Mutter kreischte und Joseph fluchte, dann wurde Michael verdächtig still und verkrümelte sich. Er war erst drei, wer hätte ihm da irgendwelche Heimlichkeiten unterstellen wollen? Aber es dauerte nicht lange, bis es dann doch herauskam. Eines Tages schlich sich Joseph in die Küche und ertappte Michael auf frischer Tat dabei, wie er auf dem Boden kniete und die Maus hinter dem Kühlschrank fütterte.
Das Haus erzitterte, als Joseph brüllte: „Ab in dein Zimmer, und da wartest du auf mich!“
Doch was Michael nun tat, überraschte uns alle.
Er versuchte zu flüchten.
Michael rannte wie ein verschrecktes Kaninchen durchs ganze Haus. Joseph verfolgte ihn mit dem Gürtel und bekam ihn hinten am Hemd zu fassen, aber mein Bruder war wendig und flink, wand sich blitzesschnell aus den Ärmeln und rannte weiter. Er flitzte ins Elternschlafzimmer, sprang über das Bett und drückte sich in die Ecke, wohl wissend, dass der Gürtel ihn hier nicht erwischen konnte, ohne zuvor an den Wänden abzuprallen.
Noch nie zuvor hatte ich Joseph so wütend gesehen. Er ließ den Gürtel fallen, packte Michael und verprügelte seinen Sohn so sehr, dass der das ganze Haus zusammenschrie.
Ich hasste das eigentümliche Schweigen, das nach solchen Vorkommnissen immer in der Luft hing und nur von Mutters gequältem Gemurmel und den leisen Schluchzern desjenigen von uns unterbrochen wurde, den es gerade erwischt hatte.
Michael machte es sich zusätzlich schwer, weil er von uns allen am ungebärdigsten war. Rebbie erinnert sich, dass er mit eineinhalb Jahren Joseph einmal seine Nuckelflasche an den Kopf warf. Das hätte unserem Vater vielleicht eine Warnung sein sollen, denn mit vier Jahren schleuderte Michael in einem Wutanfall einen Schuh nach ihm – und kassierte natürlich wieder eine deftige Abreibung.
Michael rannte aus Angst vor Schlägen immer davon. Manchmal tauchte er mit einem Satz unter das Bett unserer Eltern, presste sich ganz hinten an die Wand und krallte sich an den Sprungfedern des Bettrahmens fest. Das war eine recht effektive Taktik, denn wenn Joseph eine halbe Stunde lang versucht hatte, ihn dort zu herauszuholen, war er meist entweder zu erschöpft, um weiterzumachen, oder hatte sich beruhigt. Und so kam Michael mit viel mehr durch, als er je durchblicken ließ.
Tito begeisterte sich also immer mehr für Gitarren.
Während Jackie und ich die Songs aus dem Radio lernten, hatte er die Möglichkeit, in der Schule Unterricht auf diesem Instrument zu nehmen. Aber zu Hause besaß er keine Möglichkeit zum Üben. Also holte er sich schließlich doch einmal trotz aller Warnungen und Verbote Josephs Gitarre aus dem Schrank. Solange unser Vater das nicht merkte, würde er sich schließlich auch nicht aufregen.
Tito nutzte jede Gelegenheit, wenn Joseph zur Arbeit war. Er spielte, und wir sangen mehrstimmig dazu. Manchmal erwischte Mutter uns dabei, aber außer, dass sie ganz offensichtlich einen Schrecken bekam und uns darauf hinwies, dass wir mit dem Feuer spielten, verriet sie nichts. Sie war wesentlich nachsichtiger als unser Vater. An einem Wochenende dann spielte Tito Gitarre, und wir sangen einen Song von den Four Tops. Er saß da, zupfte selbstvergessen, und Jackie und ich warfen uns die Harmonien wie Bälle zu, als plötzlich ein hässliches Pling ertönte. Tito wurde bleich: Eine Saite war gerissen. „Oh, jetzt kriegst du eine Abreibung“, quiekte Jackie halb aufgeregt, halb voller Angst.
Wir kriegen jetzt alle eine Abreibung, dachte ich.
Vorsichtig stellten wir den lädierten Schatz wieder auf seinen angestammten Platz und saßen in unserem Zimmer, als wir nach einer scheinbaren Ewigkeit dann endlich das Auto vor dem Haus hörten. Jeder laute Schritt auf dem Linoleum korrespondierte mit dem Dröhnen in unserem Brustkorb. Eins … zwei … drei … „Wer … hat … an meiner Gitarre … herumgefummelt?!“ Joseph brüllte so laut, dass man ihn vermutlich noch in Kalifornien hörte. Als er in unser Zimmer stürmte, hatten Michael und Marlon sich verkrümelt, so dass nur noch Jackie, Tito und ich an unserem Etagenbett standen und jetzt schon wimmerten, weil wir so viel Angst vor dem hatten, was kommen würde. Mutter versuchte zu schlichten und behauptete, es sei alles ihre Schuld, aber Joseph hörte ihr nicht zu. Stattdessen drohte er, uns alle windelweich zu prügeln, bis einer von uns zugab, es gewesen zu sein, und daraufhin heulten wir noch mehr.
„Ich war’s“, brachte Tito schließlich kaum hörbar hervor. „Ich habe gespielt …“ Joseph packte ihn. „… aber ich weiß, wie man das macht. Ich weiß, wie man spielt!“, kreischte Tito.
In einigen Berichten wird behauptet, Joseph habe ihn an Ort und Stelle verdroschen, aber das stimmt nicht. Stattdessen hielt er inne, sah uns grimmig an und sagte: „Dann spiele. Zeig mal, was du kannst!“ Und Tito spielte, mit der gerissenen Saite, und Jackie und ich sangen dazu, obwohl wir wohl nur halb so gut waren wie sonst, weil wir immer noch heulten. „The Jerk“ von den Larks wurde unsere Bitte um Vergebung, und nach und nach sangen wir wieder mehrstimmig, wenn auch vielleicht nicht immer ganz rein, aber es klang wahrscheinlich trotzdem ganz gut, denn Joseph wurde zusehends lockerer. Wir sangen weiter. Schließlich merkten wir, dass sein Kopf im Takt nickte, und er tat, was später zu seiner festen Gewohnheit wurde: Stumm bewegte er die Lippen zum Text und führte uns durch den Song. Langsam wurden wir mutiger, hörten auf zu schniefen und rissen uns zusammen. Die Harmonien wurden immer besser, und wir schnippten mit den Fingern. Unser Publikum machte große Augen und kniff sie dann wieder zusammen, hin- und hergerissen zwischen Sieg und Niederlage. Als wir aufhörten, sagte Joseph kein Wort, aber die Abreibung blieb uns erspart, und das war zunächst einmal alles, was uns interessierte.
Zwei Tage später kam Joseph mit einer roten E-Gitarre für Tito nach Hause und befahl ihm zu üben. Auch Jackie und ich sollten uns auf erste Proben vorbereiten. Meiner Mutter sagte er: „Ich werde diese Jungs unterstützen.“ Damit verlagerte sich sein Fokus von den Falcons auf seine Söhne. Wir hatten seine Aufmerksamkeit, und er wollte uns in etwas drillen, an dem wir viel Spaß hatten. Es fühlte sich wie Anerkennung an, und wir waren völlig begeistert. Später hat man oft gesagt, unser Vater habe uns „zum Singen gebracht“ oder „seine Jungs in die Unterhaltungsbranche gezwungen“, aber wir hatten schon vorher stets Spaß am Singen gehabt, und diese Leidenschaft war unsere Wahl. Schon lange hatten wir unsere Stimmen erprobt und trainiert, noch bevor Joseph mit seinem Raketenbenzin für mehr Antrieb sorgte. Wir würden als Brüder-Trio auftreten, und wir sagten uns, dass wir die beste Gruppe in ganz Gary sein würden.