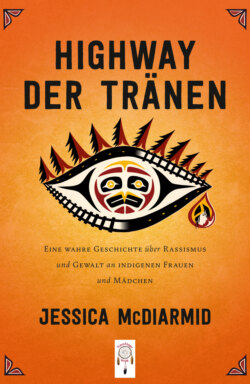Читать книгу Highway der Tränen - Jessica McDiarmid - Страница 7
VORWORT VON MONIKA SEILLER
ОглавлениеDunkle Wälder umschließen den 725 km langen Highway 16, der von Prince Rupert an der pazifischen Küste bis nach Prince George im Landesinneren der kanadischen Provinz British Columbia führt – und sie bergen ein dunkles Geheimnis: Warum verschwanden hier Dutzende indigene Mädchen und Frauen oder wurden ermordet? Warum hat die kanadische Öffentlichkeit die Augen vor einer Tragödie verschlossen, welche die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft erfasst hat? Warum hat die Regierung ihre Verantwortung gegenüber den indigenen Völkern des Landes ignoriert? Und warum haben Justiz und Polizei weder die indigenen Frauen und Mädchen beschützt noch die Täter zur Rechenschaft gezogen?
Die Gewalt an indigenen Mädchen (viele Opfer sind minderjährig) und Frauen wirft viele Fragen auf, welche die kanadische Journalistin Jessica McDiarmid in ihrem Buch beantworten will, denn – wie schon der Titel nahelegt – handelt es sich um ein komplexes Geflecht von Ignoranz, systemischem Rassismus und mangelnder Gerechtigkeit, das aus den anhaltenden Verheerungen des Kolonialismus resultiert, die auch im 21. Jahrhundert längst nicht überwunden sind.
2019 bezeichnete die Untersuchungskommission National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls die Gewalt an indigenen Mädchen und Frauen als „Völkermord“. Da es (noch) keine verlässlichen Datenbanken auf nationaler Ebene gibt, kann das wahre Ausmaß nur geschätzt werden. Anhand einzelner Statistiken und Untersuchungen, Zeugenberichten und Recherchen wird die Zahl der vermissten und ermordeten indigenen Mädchen und Frauen allein für die letzten Jahrzehnte auf rund 4.000 Opfer geschätzt. Der Highway 16 steht als „Highway of Tears“ stellvertretend für die unzähligen Schicksale, die viel zu lange ignoriert wurden und werden.
Jessica McDiarmid erzählt die Geschichten hinter den blanken Zahlen und Statistiken, indem sie das Schicksal der Opfer entlang des „Highway of Tears“ veranschaulicht. Die eingehende Schilderung des Lebens und der letzten Stunden der Mädchen und Frauen entreißt sie der Anonymität der Opferstatistik. Ramona Wilson, Alberta Williams oder Roxanne Thiara waren nicht nur Opfer von Sexismus, Verachtung und Rassismus, sondern auch Subjekte ihres eigenen Lebens mit ihren Hoffnungen und Träumen. Sie waren Menschen, die von Freunden und Familien geachtet und geliebt wurden, und hinterlassen eine schmerzliche Lücke, unter der die indigenen Gemeinschaften bis heute leiden. Indem die Autorin ihnen ihre Würde zurückgibt, ist das Buch auch der Versuch einer ersten Wiedergutmachung, indem die Öffentlichkeit endlich das Schicksal dieser Mädchen und Frauen anerkennen muss.
Fünf Jahre hat Jessica McDiarmid akribisch recherchiert, Tausende von Zeugenaussagen, Dokumenten und Artikeln studiert und vor allem mit den betroffenen Familien und Freunden, aber auch Ermittlern korrespondiert, um ihre Ergebnisse zu belegen (siehe die ausführlichen Anmerkungen), denn die Betroffenen hatten in allen Fällen vor allem damit zu kämpfen, dass man ihren Aussagen kein Gehör und keinen Glauben schenkte. Die Opfer wurden erneut diskriminiert und zur Unsichtbarkeit verdammt. Im öffentlichen Bewusstsein existierten sie nicht oder waren allenfalls eine Randnotiz in Lokalblättern – ohne Namen und ohne Persönlichkeit.
Den rassistischen Hintergrund für die Ignoranz gegenüber dem Schicksal der Indigenen verdeutlicht McDiarmid, indem sie den zahlreichen Fällen der vermissten und ermordeten indigenen Mädchen und Frauen die Geschichte von Nicole Hoar gegenüberstellt – und vor allem die mediale und öffentliche Reaktion analysiert. Die 25-Jährige verschwand im Juni 2002 ebenfalls am „Highway of Tears“, doch sie war keine Indigene. Ihr Verschwinden sorgte für Schlagzeilen und Anteilnahme im ganzen Land, Freiwillige meldeten sich zu Suchtrupps, die Medien berichteten umfangreich und die RCMP, die kanadische Bundespolizei, mobilisierte alle Kräfte, um die junge Frau zu finden. In der öffentlichen Meinung war Nicole Hoar das unschuldige Opfer eines vermutlichen Verbrechens, während den indigenen Mädchen und Frauen eine Mitschuld an ihrem Schicksal zugeschrieben wurde. Sie wurden als Ausreißerinnen, Drogenabhängige oder Prostituierte diffamiert, um deren Verbleib sich offensichtlich niemand in der kanadischen Mehrheitsgesellschaft Gedanken machte.
McDiarmid ist selbst in British Columbia aufgewachsen und mit der Situation der Indigenen vertraut, die noch heute unter dem Trauma von Kolonialismus und Rassismus leiden, welche den Hintergrund für die heutigen Lebensbedingungen bilden. Ohne diesen Hintergrund lässt sich die Dimension der Gewalt an indigenen Frauen und Mädchen nicht erfassen. Dazu zählen auch die Erfahrungen der Residential School, der Internatsschulen, in denen die Indigenen ihrer Sprache, Kultur, Traditionen und Identität beraubt werden sollten – einhergehend mit physischen, sexuellen und emotionalen Missbrauch. Das System der Internatsschulen, deren letzte erst 1996 schloss, wurde in den 1960er Jahren durch den „Sixties Scoop“ erweitert, als indigene Kinder aus ihren Familien gerissen und in (weiße) Pflegefamilien oder zur Adoption freigegeben wurden. Dies war ein weiteres Instrument indigene Kinder in die weiße Kultur zu assimilieren. Heute sind so viele indigene Kinder wie nie zuvor in staatlicher Obhut oder in Pflegefamilien. 68% der Kinder unter 14 Jahren, die sich 2019 in staatlicher Fürsorge in British Columbia befanden, waren Indigene, obwohl sie nur 8% der Bevölkerung stellen (in Manitoba waren es sogar 87%). McDiarmid schildert die Auswirkungen dieses Systems auf die Kinder und die indigenen Gemeinschaften – Entwurzelung und Identitätsverlust, aber auch Armut oder Alkohol- und Drogenprobleme. Sie sind die Opfer des systemischen Rassismus, werden aber für diese Umstände selbst verantwortlich gemacht und zu Schuldigen abgestempelt. Auch viele der vermissten oder ermordeten indigenen Mädchen und Frauen waren Opfer dieser Fürsorgepolitik.
Verantwortlich für diese Situation sind auch Polizei- und Justizbehörden, die zu willfährigen Helfern des rassistischen Systems wurden, indem sie die Kinder aus den Familien rissen und gewaltsam in die Internatsschulen oder zu Pflegefamilien schleppten. Die Diskriminierung der indigenen Frauen setzt sich im Strafvollzug fort, indem sie wegen geringfügiger Vergehen verhaftet und dann zu überzogenen Haftstrafen verurteilet werden. Im Januar 2020 waren 42% der Frauen im kanadischen Strafvollzug indigener Herkunft, obwohl sie nur 5% der Bevölkerung bilden. Die meisten von ihnen sind Mütter, deren Kinder dann wieder in die Mühlen der staatlichen Fürsorge geraten. Zudem gibt es zahlreiche Fälle von (sexualisierter) Gewalt an indigenen Frauen durch Mitglieder von Polizei und Justiz.
Sowohl der RCMP als auch dem Vancouver Police Department (Vancouvers Stadtteil Downtown Eastside verzeichnet besonders hohe Zahlen an vermissten oder ermordeten indigenen Mädchen und Frauen) kommt eine besondere Rolle hinsichtlich der Gewalt an indigenen Frauen zu, denn die Familien, die Hilfe bei der Polizei suchen, erfahren stattdessen häufig Gleichgültigkeit und weitere Diskriminierung. McDiarmid ist sich dieser Problematik bewusst, doch statt das Polizeiversagen pauschal zu verurteilen, sucht sie die Gründe dafür in der Entstehungsgeschichte und dem System der RCMP, das einen besonderen Corpsgeist entwickelt hat, der sich selbst berechtigter Kritik verweigert.
Aber McDiarmid legt auch dar, mit welchen Maßnahmen die RCMP der Gewalt an den Indigenen entgegenzutreten versuchte, u.a. der Schaffung der E-PANA-Taskforce, welche die hier geschilderten Fälle untersuchte. Besondere Erwähnung findet dabei die Arbeit zweier Detektive, die sich mit den üblichen Nachforschungen nicht zufriedengeben wollten und sich mit ganzer Kraft in die Aufklärung der Fälle stürzten: Garry Kerr (RCMP) und Kim Rossmo (Kriminologe und ehemals Vancouver Police), der die geographische Profilerstellung ins Leben rief, die für die Fälle der vermissten und ermordeten indigenen Mädchen und Frauen eine besondere Rolle spielt.
Nicht zuletzt würdigt die Autorin die außergewöhnliche Resilienz der Indigenen selbst, die seit Jahrzehnten die Erinnerung an ihre Liebsten aufrechterhalten, weiterhin Suchaktionen und Nachforschungen koordinieren und deren unermüdlichem Drängen die Einrichtung der National Inquiry zu verdanken war. Ihr beharrlicher Einsatz mit Kampagnen, Gedenkmärschen und Kundgebungen hat dazu beigetragen, die Öffentlichkeit aufzurütteln und für die Vulnerabilität der indigenen Mädchen und Frauen zu sensibilisieren.
Vor 25 Jahren wurde der Leichnam von Ramona Wilson (Mitglied der Gitxsan Nation) nahe Smithers, British Columbia, gefunden, doch bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Seit einem Vierteljahrhundert organisiert ihre Mutter Matilda gemeinsam mit anderen indigenen Familien den „Ramona Wilson Memorial March“, bei dem auch der weiteren Opfer gedacht wird. Die Teilnehmer selbst verstehen sich als „Survivor“, als Überlebende eines systemischen Rassismus, der bis heute immer weitere Opfer fordert. 24% der ermordeten Frauen in Kanada sind Indigene. Öffentlichkeit und Behörden können nicht mehr behaupten, sie hätten nichts von dem Völkermord an den indigenen Mädchen und Frauen gewusst.
Jessica McDiarmid hat mit ihrem detailreichen und sorgfältig recherchierten Bericht dazu beigetragen, dass die Opfer und die Überlebenden nicht mehr vergessen werden.
Monika Seiller
(Die Übersetzerin ist Vorsitzende der Aktionsgruppe Indianer & Menschenrechte e.V. und engagiert sich selbst seit Jahrzehnten für die Rechte der indigenen Völker und insbesondere gegen die Gewalt an indigenen Mädchen und Frauen.)