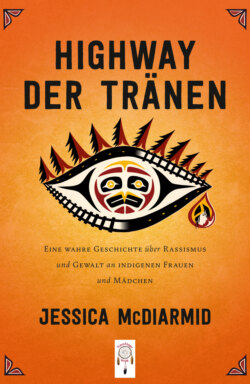Читать книгу Highway der Tränen - Jessica McDiarmid - Страница 8
EINFÜHRUNG DER HIGHWAY DER TRÄNEN
ОглавлениеDer „Highway der Tränen“ ist eine einsame Straße, die durch abgeschiedenes Land führt. Dieser düstere Asphaltstreifen schneidet einen schmalen Pfad durch die ausgedehnte Wildnis der Gegend. Dürre Wiesen grenzen an dunkle Kiefernwälder und die hügeligen Felder des Landesinneren stoßen auf die zerklüfteten Gebirge der Küstenregion. In der dünn besiedelten Landschaft trennen viele Kilometer die kleinen Städte, die sich an der Straße entlangreihen und deren Gemeinden mit dem Aufschwung und Niedergang der Industrien kämpfen, von denen sie leben. Nachts können viele Minuten vergehen, bis ein Fahrzeug auf das vorherige folgt; meist sind es Sattelschlepper auf ihrer langen Fahrt zwischen der Küste und einem weiter südlich gelegenen Ort. Und da ist der Zug, der spät in der Nacht vorbeifährt und dessen Pfeifen noch lange durch die Täler hallt, während er schon längst außer Sicht ist.
Prince George liegt in einer Senke, die von Gletschern im Laufe der Jahrtausende auf dem Nechako-Plateau, ungefähr in der Mitte des heutigen British Columbia, am Zusammenfluss von Nechako und Fraser River ausgehöhlt wurde. Verglichen mit anderen Städten ist Prince George zwar eine Kleinstadt, doch mit etwa 80.000 Einwohnern bei weitem die größte Stadt entlang des Highways, eine einst prosperierende Holzfällerstadt, die schwere Zeiten durchlebt hat. Das einstmals geschäftige Stadtzentrum am Ausläufer von Sandsteinformationen, welche die Flüsse ins Land geschnitten haben, ist heute beschaulicher geworden, auch wenn der Drang nach wirtschaftlicher Diversifizierung in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung an Boutiquen, Pubs und gehobenen Restaurants hervorgebracht hat.
Von der Stadt aus verläuft der Highway in Richtung Nordwesten, vorbei an Farmen mit durchhängenden Stacheldrahtzäunen und Reklametafeln, die für landwirtschaftliche Zulieferbetriebe und Abschleppunternehmen werben. Er schlängelt sich von der Hochebene hinunter in Richtung Küste und führt durch immer schmalere Täler, in denen Zedern, Sitka-Fichten und Hemlocktannen aus Moos- und Farnbetten aufragen und fast eine Art Baldachin bilden, während der Himmel tiefer sinkt und die Berge höher aufragen. Die Luft wird immer dunstschwerer, je näher die Straße zum Pazifik führt. Oberhalb des Skeena River hat man aus den Berghängen einen Felsvorsprung herausgesprengt, um Platz für Züge und Lastwagen zu gewinnen. Der Weg ist gefährlich, denn wer von der Spur abkommt, stürzt tief hinab und ist für immer im Fluss verschwunden, der Holzlaster genauso verschlingt wie Fischerboote. Wer hier verschwindet, ist oft nur schwer zu finden.
Die Städte verdanken ihre Existenz der Eisenbahn, die vor etwas mehr als hundert Jahren einen Weg von den Rocky Mountains nach Prince Rupert bahnte, angetrieben von der Furcht Ottawas vor einer amerikanischen Invasion und der Hoffnung, Getreide aus den Plains von einem Hafen am nördlichen Pazifik aus nach Asien zu exportieren. Der letzte Nagel der Grand Trunk Pacific Railroad wurde am 7. April 1914 in den Boden getrieben, nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Europa. Entlang der Eisenbahn sprossen die Siedlungen aus dem Boden. Die Lebensmittel rangen sie den Farmen ab, die von spätem Frühjahr und frühem Frost heimgesucht wurden; das Holz schlugen sie in den hoch aufragenden Wäldern und in den Minen schürften die Männer nach Silber, Kupfer und Gold, das sie auf die Waggons verluden und in andere Regionen transportierten.
Aber vor diesen Städten, die nach Eisenbahnern, Pelzhändlern und Siedlern benannt sind, gab es hier noch andere Gemeinden. Menschen bewohnten dieses Land lange bevor es geschichtliche Aufzeichnungen im europäischen Sinne gab. Lange bevor die Ägypter die Pyramiden errichteten, bevor die Mayas ihre Schriften verfassten und den Himmel studierten oder die Mesopotamier die ersten Städte bauten, lebten an diesem Ort Indigene. Die Europäer landeten an der pazifischen Nordwestküste erst vor etwa 200 Jahren auf der Suche nach Seeottern, Gold und später nach Holz. Bald sollte die Regierung Kanadas, das erst noch im Entstehen war, das Gebiet für sich beanspruchen und alles unternehmen, um diejenigen, die schon lange vorher hier lebten, zu assimilieren oder zu vernichten. Die Siedler kamen anfangs zu Fuß oder in Kanus, dann mit Eisenbahnwaggons oder Dampfbooten und schließlich auf dem Highway. Anfang der 1950er Jahre verband eine Straße Prinz Rupert mit Prinz George, wenngleich es sich eher um eine Kiesstraße handelte, die nach Schneefällen, Erdrutschen oder Lawinen häufig unpassierbar war. Bald wurde der Highway 16 durch die Rocky Mountains verlängert, um den Nordwesten von British Columbia mit Edmonton und anderen Städte zu verbinden und diese riesige Region für den Rest des Landes zu öffnen. Die Straße1 erhielt die Bezeichnung „Yellowhead“ (Gelbkopf), benannt nach dem Irokesen-Metís-Pelzhändler Pierre Bostonais, der wegen seines leuchtend gelben Haarschopfes als „Tȇte Jaune“ bekannt war. So blieb es lange Zeit, bis spätere Ereignisse ihr einen neuen Namen gaben: „Highway der Tränen“.
Niemand weiß, wer das erste indigene Mädchen oder die erste indigene Frau war, die entlang des Highways zwischen Prinz Rupert und Prinz George verschwand, oder wann es geschah. Auch weiß niemand zu sagen, wie viele seitdem verschwunden sind oder ermordet wurden.2 In den letzten Jahren sind Grassroots-Aktivisten, unter ihnen viele Familienmitglieder von Vermissten und Ermordeten, von Gemeinde zu Gemeinde gereist, um die Namen der Toten und Vermissten zu sammeln. Ihre Listen lassen Zahlen vermuten, die weit höher sind als die, die in den meisten Medienberichten erscheinen, aber sie sind immer noch unvollständig – selbst Menschen, die seit vielen Jahren die Namen der Opfer zusammentragen, hören immer wieder von Fällen, von denen sie bislang nichts wussten.
Die RCMP hat die Zahl der vermissten und ermordeten indigenen Frauen in Kanada in ihrem Bericht 2014 auf etwa 1.200 geschätzt,3 von denen rund 1.000 ermordet wurden. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich wesentlich höher; die Native Women‘s Association of Canada4 (NWAC) und andere Interessenverbände schätzen die Zahl auf rund 4.000 Opfer.5 Und während die RCMP berichtete, dass rund 89% der Fälle geklärt würden, ergaben Untersuchungen der NWAC, dass von 582 untersuchten Fällen, welche sie in ihrem ersten Bericht „Sisters in Spirit“ (2004) dokumentiert hatte, 40% der Morde ungeklärt blieben.6
Nach Angaben der RCMP verzeichnet British Columbia ein Drittel der landesweit 225 ungelösten Fälle (die hier genannten Zahlen beziehen sich auf den RCMP-Bericht von 2014). Mit 36 Tötungsdelikten und 40 ungelösten Fällen vermisster Personen sind diese Zahlen mehr als doppelt so hoch wie in der Nachbarprovinz Alberta, die in der Statistik an zweiter Stelle liegt. Die Aufklärungsrate der RCMP ist in B.C. – von Neufundland abgesehen – die niedrigste in Kanada. Im gesamten Norden British Columbias leben nur etwa 250.000 Menschen, was rund sechs Prozent der Bevölkerung der Provinz entspricht. Allein im Gebiet um den „Highway der Tränen“, einer Region, die nur einen Bruchteil des nördlichen British Columbia ausmacht, verschwanden mindestens fünf indigene Frauen und Mädchen in dem von den RCMP-Statistiken erfassten Zeitraum. Dies sind mehr als zwölf Prozent der gesamten Vermisstenzahlen in der Provinz. Zudem gibt es mindestens fünf ungelöste Morde an indigenen Frauen und Mädchen, d.h. etwa 14% der Mordfälle.
Der „Highway of Tears“, der sich über 725 Kilometer im Nordwesten British Columbias erstreckt, ist das Symbol einer nationalen Tragödie. Die Ureinwohner dieses Landes sind weitaus häufiger mit Gewalt konfrontiert als jede andere Bevölkerungsgruppe. Ein Bericht der kanadischen Statistikbehörde Statistics Canada aus dem Jahr 20147 stellte fest, dass Indigene doppelt so häufig Gewalt ausgesetzt sind wie Nicht-Indigene. Vor allem indigene Frauen und Mädchen sind Zielscheibe der Gewalt. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden, sechsmal höher als bei nicht-indigenen Frauen. Sie sind doppelt so häufig schwerer Gewalt ausgesetzt wie indigene Männer und fast dreimal häufiger als nicht-indigene Frauen. Dies liegt zum Teil daran, dass sie häufiger Risikofaktoren wie psychischen Erkrankungen, Obdachlosigkeit und Armut ausgesetzt sind, unter denen Indigene unverhältnismäßig stark zu leiden haben – Auswirkungen des Kolonialismus in Vergangenheit und Gegenwart. Aber auch ohne diese Faktoren sind indigene Frauen und Mädchen mehr Gewalt ausgesetzt als alle anderen. Einfach ausgedrückt: Sie sind allein deshalb in größerer Gefahr, weil sie als Indigene und Frauen geboren wurden. Oder wie es eine langjährige Aktivistin auf den Punkt brachte: „Jedes Mal, wenn wir unser Haus verlassen, sind wir in Gefahr.“8
Weder in Kanada noch entlang des „Highway of Tears“ hat je einer die Toten gezählt. Aber wie hoch die Zahl auch sein mag, so wird allzu oft vergessen, dass es sich bei jedem einzelnen Todesoder Vermisstenfall um einen Menschen handelt, der Familie, Gemeinde und Freunde zurücklässt, die ihn lieben. Es sind diese Bande der Gemeinschaft, die sie stark machen, aber auch brechen, wenn sie zerrissen werden.
Ich war zehn Jahre alt, als ich Ramona Wilson zum ersten Mal sah. Ein DIN-A4-Ausdruck mit ihrem Foto war in ganz Smithers plakatiert, jener Kleinstadt in B.C., in der wir beide aufgewachsen sind. Auf dem Bild lächelte sie und ihre schwarzen Haare schmiegten sich um ihre linke Schulter – über dem Bild stand der Schriftzug „Vermisst“ und darunter eine Beschreibung: 16 Jahre alt, indigen, 1,52 m groß, 54 kg, zuletzt gesehen am 11. Juni 1994.9 Monatelang hingen die Plakate in der ganzen Stadt und der Umgebung an Telefonmasten, Tankstellen und Schwarzen Brettern der Lebensmittelgeschäfte, doch im April des folgenden Jahres waren sie abgehängt. Sie war verschwunden.
Später erfuhr ich, dass Ramona nicht das einzige Mädchen oder einzige junge Frau der First Nations war, die in der Region vermisst wurde. 1989 verschwanden Alberta Williams und Cecilia Anne Nikal, im Jahr darauf Cecilias 15-jährige Cousine Delphine Nikal. 1994, im selben Jahr, als Ramona nicht nach Hause kam, wurden Roxanne Thiara und Alishia Germaine ermordet; ihre Leichen wurden später in der Nähe des Highways gefunden. 1995 verschwand Lana Derrick. Plakate wurden aufgehängt und wieder abgenommen – aber nicht etwa, weil diese Mädchen lebend nach Hause zurückkehrt wären.
Diese vermissten und ermordeten Mädchen waren kein großes Thema in der Öffentlichkeit. „Nur eine weitere Indigene“, so beschreiben Mütter, Schwestern und Tanten die allgegenwärtige Haltung. Die Polizeibeamten gaben den verstörten und trauernden Familien deutlich zu verstehen, dass diese vermissten Mädchen ihnen egal waren und sie sich nicht besonders bemühen würden, sie zu finden. Auch die Öffentlichkeit zeigte sich wenig engagiert – weder gab es zahlreiche Spenden für Belohnungen, um die Mädchen zu finden, noch beteiligte sich eine größere Zahl an Suchaktionen oder Mahnwachen und Gedenkmärschen. Die Familien waren oft allein gelassen, um die Vermissten zu suchen, Geldmittel aufzutreiben, Nachforschungen anzustellen und zu trauern. In den 1990er Jahren war es nicht ungewöhnlich, abschätzige Kommentare über die „Fehltritte“ zu hören, die ein Mädchen begangen haben musste, um einem solchen Schicksal zu begegnen. Die Vermissten galten als Tramperinnen, Prostituierte, Trinkerinnen oder Herumtreiberinnen. Noch heute werden die Todes- und Vermisstenfälle häufig als das Resultat des vermeintlich falschen Lebenswandels („risky life-style“) der Opfer gesehen, nicht jedoch als das, was sie wirklich sind – das Ergebnis eines gesellschaftlichen Versagens. Viele der Mädchen waren weder Tramperinnen noch Prostituierte, sie waren einfach Jugendliche wie andere auch. Viele, die in Gemeinden mit hauptsächlich weißer Bevölkerung leben, glauben, solche Schicksale widerfahren nur den anderen, denn in diesem Land ist es sechsmal wahrscheinlicher, dass eine Ramona Wilson ermordet wird als ich.
Ich verließ den Nordwesten von British Columbia in meinen späten Teenagerjahren und hatte, von ein paar Wochen zu Besuch bei meiner Familie abgesehen, nie vor, nach British Columbia zurückzukehren. Ich arbeitete als Journalistin und berichtete aus dem ganzen Land, aber auch aus Übersee. Vor allem konzentrierte ich mich, wenn möglich, auf die Themen, die mir wichtig waren – Menschenrechtsverletzungen und soziale Ungerechtigkeit. Diese Themen wollte ich beleuchten und hoffte, damit zu deren Überwindung beizutragen. Im Laufe dieser Jahre beobachtete ich, wie immer mehr Frauen und Mädchen in dieser Gegend verschwanden: Nicole Hoar, Tamara Chipman, Aielah Saric-Auger, Bonnie Joseph, Mackie Basil. Und ich hatte zunehmend das Gefühl, dass ich für diese Geschichten nach Hause zurückkehren musste. 2009 sprach ich das erste Mal mit Familienmitgliedern vor Ort, die sich zu den stärksten Fürsprechern der vermissten und ermordeten indigenen Frauen und Mädchen entwickelt hatten und zu einer treibenden Kraft im Lande wurden. Allerdings hatte ich erst sieben Jahre später die Gelegenheit, nach Hause zurückzuzukehren, um das Thema zu recherchieren und dieses Buch zu schreiben.
Kurz nach meiner Rückkehr nach Smithers hatte ich im Juni 2016 die Ehre, mit Ramonas Schwester Brenda Wilson am Gedenkmarsch entlang des „Highways der Tränen“ teilzunehmen. Angeline Chalifoux, die Tante der 14-jährigen Aielah Saric-Auger, und Val Bolton, ein Freund von Brenda, waren zusammen mit Dutzenden von Familienmitgliedern und Unterstützern ebenfalls gekommen, um sich für einen Teil der Strecke anzuschließen. Der „Cleansing the Highway Walk“ wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des ersten Gedenkmarsches veranstaltet. Als wir schließlich in Prince George ankamen, nachdem wir drei Wochen lang den ganzen Weg von Prince Rupert gelaufen waren, stand Angeline neben Brenda und Val auf einer Bühne. Es war der 21. Juni, der National Aboriginal Day, der nationale Tag der Indigenen, und Hunderte von Menschen waren gekommen, um im Lheidl T‘enneh Memorial Park am Ufer des Fraser River zu feiern. Angeline erzählte Aielahs Geschichte und trug dann der Menge ihr Lieblingszitat vor, das vom amerikanischen Bürgerrechtsführer Martin Luther King jr. stammt: „Wer das Böse tatenlos hinnimmt, ist daran genauso beteiligt wie derjenige, der dabei hilft, es zu verüben. Wer das Böse akzeptiert, ohne dagegen zu protestieren, unterstützt es in Wirklichkeit.“
Viel zu viele Menschen scheren sich einen Dreck darum, wenn diese Mädchen und Frauen verschwinden. Wir haben sie nicht beschützt. Wir haben sie im Stich gelassen. Und die Polizei hat diese Fälle nicht gelöst. Aber es gibt hier mehrere Täter: Es gibt diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, doch es gibt auch uns alle in der Gesellschaft, die wir tatenlos zugesehen haben, wie diese Verbrechen wieder und wieder geschahen. Und obwohl wir das Geschehene nicht ungeschehen machen können, können wir doch versuchen zu verstehen, warum es geschah und wo wir versagt haben, es zu verhindern. Wir können uns mit den unzähligen Faktoren auseinandersetzen, welche indigene Frauen und Mädchen gefährden. Wir können aufhören, uns abzuwenden und untätig zu bleiben, wenn jemand vermisst wird. Wir können dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder geschieht. Und wir können die Erinnerung an diese jungen Frauen mit all ihren Träumen, Sorgen und Hoffnungen aufrechthalten. Das schulde ich ihnen. Wir alle schulden ihnen das.