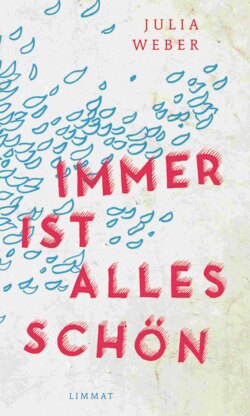Читать книгу Immer ist alles schön - Júlia Wéber - Страница 5
ОглавлениеIch wünsche mir einen Urlaub mit Feuer und Ferne, und Bruno wünscht sich einen Urlaub ohne Alkohol.
Gut, sagt Mutter, weil ihr einen Geburtstag habt.
Dann machen wir Urlaub. Und berühre ich auf dem Weg zur Busstation die Büsche, zwitschern sie. Und bewege ich die Arme, berühren sie Luft. Und strecke ich die Zunge aus dem Mund, bleibt sie warm.
Mutter raucht vor einem Plakat, auf dem ein Mann am Frühstückstisch lächelt, und Mutter schließt dabei die Augen. Wir fahren in Urlaub. Im Bus kommt der Uringeruch aus dem dreidimensionalen Muster der Sitze. Wir fahren in Urlaub bis zur Endstation. Bruno trägt sein Buch über die Brücken der Welt unter dem Arm, alle paar Minuten muss er es ablegen und die Arme schütteln.
Und auf einem Steg den Schilfweg entlang gehend, sagt Mutter, dass es schön ist. Ein Blesshuhn schreit, der Wind zieht an den rostigen Schilfköpfen.
Sehr schön, sagt sie.
Fantastisch, sagt sie.
Wunderbar, sagt sie.
Ganz, ganz wunderbar.
Das ist wegen dem nicht absehbaren Bier, sagt Bruno. Verzweiflung, sagt er noch.
Es ist wirklich schön, sage ich, weil der Wind ganz warm die Armhaare aufstellt.
Immer ist alles schön, sagt Bruno, dann zählt er die Schilfstangen mit seinem dicken Buch auf dem Kopf.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ich schaue beim Gehen abwechselnd über den See, auf seine silbernen Wellen, dann an mir herunter auf den zitronengelben Stoff an meinem Bauch. Und es schmatzt das Wasser unterhalb meines Bauches, unter dem Steg.
Ein Mann mit Doppelkinn starrt Mutters Körper an. Neben ihm liegt ein Hund, auch er mit Falten. Der kleine Bruno legt das Buch ins zertrampelte Gras und macht aus seinen Händen Fäuste.
Wir wollen einen Wohnwagen, sagt Mutter, sie steht vor uns, schüttelt ihr Haar. Mit den Absätzen sinkt sie langsam nach hinten in die Erde. Der Mann lacht. Und durch sein Lachen bewegt sich alles an ihm und auch alles um ihn herum. Seine Haut bewegt sich, der winzige Tisch, an dem er sitzt, bewegt sich, der Boden bewegt sich und hinter ihm das Rezeptionshäuschen mit der abgesplitterten weißen Farbe und den Blumenkisten vor den Fenstern. Der Mann trägt eine kurze, weiße Hose, bei der ich mir nicht vorstellen kann, wie er in sie hineingekommen ist, und erst recht kann ich mir nicht vorstellen, wie er jemals wieder aus ihr herauskommt.
Dann gehen wir durch vereinzelt herumstehende Fichten und Birken. Ich sehe die Abdrücke der Zelte zwischen den Bäumchen, ich sehe, wo im letzten Sommer die Zelte standen, wo die Klappstühle, wo die Tische, wo die Luftmatratzen lagen. Und jetzt ist hier niemand außer uns und dem Koloss, der den Wohnwagen aufschließt, dreimal an die Außenwand des Wagens klopft und geht.
Und wir sitzen auf Baumstücken feierlich. Wir sitzen im Feuerlicht. Bruno, der Luftgitarre spielt; die Flammen in Brunos Brillenglas, sie tanzen zu seiner Musik. Der Wohnwagen, der nach fremden Menschen und ihrem Schlaf riecht. Das alkoholfreie Bier in Mutters eleganten Händen, das lauwarm wird, kommt auch als bitterer Geruch aus ihrem Mund.
Mutter, die in Gedanken ist und schweigt; das Knistern.
Der dunkelbraune Tisch, den man aus dem Wagen herausklappen kann, der wackelt, an dem ich sitze, und die Schatten im Wald, die ich beobachte, ihre Unheimlichkeit, die Möglichkeit von allem in der Dunkelheit. Mein zitronengelbes Kleid, unruhig im Feuerlicht, und meine feinen Finger mit dem goldenen Kaugummiautomatenring. Und das Grün der Wiese, das beinahe schwarz ist.
Später liegt Mutter auf einer Matte am Boden, summt leise eigene Melodien. Bruno und ich liegen auf dem Hochbett. Wir können mit Füßen und Händen die Decke berühren. An die Decke hat jemand geschrieben: «Der einzige Unterschied zwischen mir und Salvador Dalí ist, dass ich nicht Dalí bin.»
Am Morgen hat sich der Geruch der fremden Menschen mit unserem vermischt. Mutter schläft. Bruno und ich gehen herum, sind hungrig, versuchen zu schwimmen, aber das Wasser ist kalt und der Boden des Sees so weich, dass wir uns zu gut vorstellen können, was sich noch alles in diesem Boden befindet, auf das man treten könnte, was einen dann beißen oder erschrecken würde. Weil uns nichts mehr einfällt, sammeln wir leere Schneckenhäuser, lecken die Tautropfen vom Klee, werfen Holzstücke in den See, füttern Fische mit Brot. Der Wind ist lauwarm und riecht nach der Gülle in den Güllelöchern der Bauernhöfe, die hinter dem kleinen Wald liegen. Wir beobachten den Hund vor der Hütte und den Koloss, der mit einem Schlauch ein Motorboot abspritzt, dabei stolpert er manchmal über den Schlauch. Es ist warm in der Sonne und kalt im Schatten, und das Boot heißt Susanna.
Am Abend sitzen wir wieder am Feuer, die Sonne ist weg, die Luft blau. Mutter hält den Zahnputzbecher mit Wein gefüllt in die Höhe.
Auf uns, sagt sie.
Davor sagte sie, entweder Urlaub oder kein Alkohol, aber beides gehe nicht, denn sie könne uns nichts gönnen, wenn sie nicht sich selber was gönnen könne, und das Einzige, was sie sich wünsche, sei am Abend ein Becher voll Wein.
Mit dem Becher wird Mutter weich wie das Licht des Feuers.
Jetzt ist alles gut, sagt sie.
Hast du mit Peter geredet?, fragt sie.
Noch nicht, sage ich.
Hast du geküsst?
Nein, sage ich, ich möchte nur mit ihm reden.
Aber das wird großartig, das Küssen, sagt Mutter.
Und dann erscheint der Koloss zwischen den Bäumen. Er kommt näher, wird immer größer, wird riesengroß, steht im Feuerlicht vor uns mit einem langen Schatten hinter sich. Seine Zehen schauen aus den weißen Sandalen, und sein Gesicht ist im Licht ein Ungeheuer. Er fragt Mutter, ob sie wohl mit ihm tanzen gehen wollen würde.
Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier.
Ob wir wohl alle mit ihm tanzen gehen wollen würden, also tanzen würden nur Mutter und er, aber wir könnten ja Steine ins Wasser werfen oder eine Cola trinken oder was Kinder eben so tun, wenn die Erwachsenen zusammen tanzen.
Er bewegt die Zehen beim Reden. Seine Zehennägel haben die Farbe von Ohrenschmalz.
Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier, um mit ihnen hier zu sein.
Und wenn jetzt aber, sagt der Mann, sie nur für einen Tanz, er fände sie nämlich reizend und würde so gerne mit ihr einen Tanz haben.
Nein, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier.
Also keinen einzigen Tanz?
Es zuckt ihm das Flammenlicht im Gesicht, und er trägt die gleiche kurze Hose, aber zu der Hose ein Safarihemd mit dunklen Flecken unter den Achseln. Er riecht nach frisch rasiert und auch ein bisschen nach altem Wasser.
Nein, verdammt, sagt Mutter.
Einen nur, sagt er.
Bruno singt. Ich schaue dem Koloss auf die Haare an den Beinen. Mutter starrt ins Feuer und trinkt schnell. Der Wein leuchtet rot im Feuerschein.
Also, sagt sie.
Mutter steht auf.
Ist das gut für euch?, fragt sie.
Ich nicke.
Bruno?
Bruno singt.
Dann geht sie schön und rot davon neben dem Koloss, der von oben auf ihre Stirn einredet.
Er freue sich also so sehr, sagt er.
Wenn er sich doch so freut, sage ich.
Bruno singt lauter.
Bruno, wenn er sich doch so freut, dann ist doch nichts dabei, Mutter ist doch eine Gute, deshalb nur.
Bruno singt lauter. Und ich schweige am Feuer. Ich möchte Mutter fragen, wie es war.
Wir können die Tänze hören, aber sie kommt nicht zurück nach einem Tanz, nicht nach zwei, nicht nach drei, nicht nach vier. Ich stochere in der Glut, höre die Geräusche im Wald, stelle mir Wildponys vor. Bruno singt nicht mehr. Ich denke ein bisschen an Peter, aber nur kurz, und weiß nicht, was ich damit soll. Ich denke noch ein bisschen an ihn. Ich denke, was er wohl gerade tut, ob er mich schön findet, also mein Gesicht, ob er es wohl so schön findet, dass er auch mal mit mir reden würde, weil er gerne in mein Gesicht schaut.
Das ist wichtig, hat Mutter gesagt, es ist wichtig, ein schönes Gesicht zu haben, wenn man nicht hart ist, und du Anais, bist der weichste Mensch, den ich kenne, aber eben auch der mit dem schönsten Gesicht. Es ist wichtig, weil, wenn man weich ist, dann trampeln die Menschen gerne auf einem herum, wenn man aber ein schönes Gesicht hat, nicht.
Ich denke daran, wie er mir damals sein Pausenbrot gegeben hat, wie er auf mich zugelaufen kam, seine Freunde weit hinten standen. Er kam zu mir gelaufen, hielt mir sein Brot hin. Magst du?, hat er gefragt. Ich habe nichts gesagt, habe es in meine Hände genommen, ihn weiter angeschaut. Ich nahm einen Bissen vom Brot, sagte nichts. Peter lächelte, nahm das Brot wieder und ging weg.
Ich denke, dass ich Peter einmal nach seinen Hobbys fragen sollte.
Was Peter wohl für Hobbys hat?, frage ich ins Feuer hinein.
Fechten vielleicht, sagt Bruno, gehen wir sie suchen.
Fechten. Wie schön.
Dann gehen wir sie suchen, weil sie auch nach sieben Tänzen nicht kommt.
Wir gehen vom Wohnwagen weg zwischen ein paar Bäumchen hindurch. Wir hören die Musik von Weitem, sehen die Scheune, darin das Licht und kleine Menschenschatten. Bruno wirft Blätter in den schwarzen See, auf dem See sind Glitzerpunkte. Eine Ente erschrickt und quakt, die Glitzerpunkte werden Glitzerwellen. Wir gehen zur Scheune hin. Mit der Musik vermischen sich schwere Stimmen. Sie singen und schreien auch. Wir bleiben beim Scheunentor stehen.
Und dann sehen wir Mutter. Hinten auf der Tanzfläche leuchtet sie in ihrem roten Leinenkleid mit goldenen Knöpfen. Männer sehen wir im Kreis um Mutter herumstehen. Einer zieht sie zu sich hin, dann wirbelt sie davon und zum nächsten Mann. An langen Bänken sitzen Menschen, manche klatschen. Und ein sehr alter Mann spielt Akkordeon auf einer kleinen Bühne aus Holzkisten. Er trägt ein rosa Hemd, hat einen langen Bart und große Ohren. Mutters Kleid ist eine rote Glocke, sie dreht sich im Kreis, ihr Haar ist hell wie das Feuer. Sie lacht und lässt sich in Arme fallen und weiterwerfen. Dann löst sie sich und tanzt in der Mitte der Männer einen wilden Tanz. Sie hebt die Beine, hebt ihr Kleid, stampft und dreht sich. Sie legt die Hände in ihr Haar und hält den Mund, an die Decke blickend, offen.
Ich höre auf dem See die Enten quaken und denke, jemand hat sie aufgeschreckt. Ich denke, dass Bruno nicht da ist, aber er steht neben mir. Ich denke, es gibt keine Kinder, die Steine in den See werfen. Ich denke, dass der Mann nicht mit Mutter tanzt, sondern alle Männer mit Mutter tanzen, und ich denke, das sind viele, die mit Mutter tanzen.
Ich sehe den Koloss vom Wohnwagen im Kreis stehen und sehe sein Lachen. Er lacht, und alles an ihm bewegt sich.
Bruno läuft vorbei an den Männern und Frauen, an den aufgereihten Festbänken und geht in den Kreis hinein. Ich gehe ihm nach. Er geht zu Mutter in den Kreis und fasst sie am Arm. Ich stehe hinter Bruno im Kreis, und die Männer bewegen sich nicht mehr. Sie wenden ihre Blicke und Bärte und Ohren und Ohrringe ab.
Mitkommen, sagt Bruno, bitte.
Warum seid ihr nicht im Bett?, fragt Mutter, sie redet, als hätte sie Steine im Mund.
Warum seid ihr hier, das hier ist nichts für euch, sagt sie mit den Steinen im Mund.
Mitkommen, sagt Bruno.
Wir haben auf dich gewartet, du sagtest, einen Tanz, sage ich.
Es ist ja ein Tanz, sagt sie, es ist hier ein großer Tanz, und er tut mir gut, dieser Tanz, ich brauche jetzt unbedingt genau diesen einen Tanz und noch was zu trinken und noch einen Tanz. Ich will noch einen Tanz, den brauche ich auch wegen euch, unter anderem auch wegen euch. Ich finde, ich habe ihn mir verdient, so einen Tanz, einen Tanz, sagt sie. Geht heim, meine Tierchen, geht heim.
Wir wollen, dass du mitkommst.
Bruno schaut Mutter von unten an.
Ich kann jetzt nicht, es ist schon gut hier. Lasst mir doch diesen einen Abend, sagt sie leiser.
Und dann schiebt sie uns weg.
Bitte, sagt Bruno.
Bitte, sage ich.
Jetzt nervt mich nicht, wirklich, ich will das jetzt, das ist lustig hier, mit euch am Feuer ist es langweilig.
Draußen drehe ich mich um und sehe den Schein der Kerzen in roten Plastikschälchen auf den Tischen, sehe die Strohballen in der Ecke der Scheune, sehe die Menschen weiterklatschen, sehe ihre Beine wippen unter den Tischen und wie die Männer sich langsam auf die Tanzfläche zurückbewegen. Mutter in der Mitte hebt ein kleines Glas zum Mund.
Im Wasser spiegeln sich nur noch wenige Lichter, die Ente ist still. Wir gehen durch die Bäume zurück, die Glut ist aus. Wir putzen die Zähne und pinkeln in den Wald, ich trete auf eine Nacktschnecke, und Bruno streift eine Brennnessel. Unter dem Schlafsack halten wir uns fest, weil es kalt ist.
Am nächsten Morgen sitzen Bruno und ich vor dem Wohnwagen unter dem kleinen Vordach, wir essen das restliche Weißbrot, Tropfen fallen auf unsere Hände und das Brot. Tropfen prallen am Gefieder einer Amsel ab, während der Rest der Welt langsam aufweicht. Mutter kommt durch die Bäume gelaufen, auch sie aufgeweicht. Auf uns liegt ein Blätterschattenspiel, hinten in den Bäumen ruft ein Kuckuck kuckuck.
Tierchen, meine Tierchen, sagt sie.
Sie nimmt die Haare nicht aus dem Gesicht, steht vor uns. Hinter ihrem Vorhang ein Lächeln.
Ich denke, könnten wir neben dieser aufgeweichten Welt nochmals eine komplette Welt haben, eine weniger komplizierte, eine mehr mit Tieren als mit Menschen, dann wäre es gut.
Ist schon gut, sage ich zu Mutter, die sich nicht bewegt, und nehme ihre und meine Tasche. Bruno nimmt das Buch.
Wir gehen durch die Fichten. Über den Rasen gehen wir fort.
Der Koloss steht neben der Hütte, lächelt ein Kolosslächeln am Telefon. Seine Körperabdrücke sehe ich im Gras neben dem Motorboot mit dem Namen Susanna.
Beim Vorübergehen an seiner Hütte kommt aus dem offenen Fenster der Geruch von Paprikachips und kaltem Zigarrenrauch. Auch vermischt sich ein süßlicher Menschengeruch mit dem Geruch der Gülle. Sein Klappbett steht in einer Spinnwebenecke, Kissen und Bettbezug mit Löwenkopf, der Löwe darauf schreit. Das Poster einer Frau im silbernen Bikini hängt über seinem Tisch und über dem Bett das Bild von Mohn. Das Safarihemd liegt auf dem Bretterboden, da, wo die dunklen Flecken waren, sind jetzt Salzränder. Auf dem Schreibtisch die militärgrünen Ordner, zerkaute Bleistifte, ein Locher, ein einziger Stuhl am Tisch.
Sein Blick ist in unserem Rücken, als wir das Areal verlassen. Koloss, Hütte und Hund bleiben zurück, nach Hund und dem Inneren des Menschen riechend. Ich habe den Hund nicht gesehen, ich habe seine Abdrücke neben den Abdrücken des Kolosses im Gras vor der Hütte gesehen.
Ich stelle mir den Koloss vor, wie er im Bett liegt und mit seiner Mutter telefoniert. Er streichelt beim Telefonieren mit der freien Hand seinen über den Bund hängenden Bauch. Er hebt den Bauch an und lässt ihn fallen, hebt ihn an, lässt ihn fallen. In der Fensterscheibe sieht er sein Spiegelbild, vermischt mit Rasen und Feldern, dahinter, draußen wartet der bellende Hund.
Ich stelle mir die Brote vom Koloss vor, die Butterbrote. Seine Zehen bewegen sich, wenn er kaut, und unter ihm sitzt der Hund, wartet auf das Herunterfallen der Brotstücke, und da, wo sie sitzen, vor dem Häuschen, sind ihre Abdrücke im Gras, ist der Rasen dunkel.
Der Koloss, der das Boot namens Susanna abspritzt. Der Koloss, der sich danach auf seinen im Gras hinterlassenen Abdruck legt und wartet. Der Koloss, der die Frau im Bikini betrachtet, die in seinem Raum hängt, die er ebenfalls Susanna nennt. Sein Tag, der mit Sonnenlicht und Güllegeruch beginnt. Sein Tag ist warm. Der Koloss schwitzt neben seinem hechelnden Hund, er schwitzt in den Abend hinein und schwitzt über den Nudeln, die er sich kocht auf einer Herdplatte in der Ecke. Er schwitzt und schiebt Dinge in sich hinein. Würstchen, Nudeln, Brot, Bier. Der Koloss sitzt vor dem kleinen Fernseher. Bilder von tanzenden Frauen und um sie herumtanzenden Männern, von Auswanderern und Verwandten und von Streit und Liebe, Küssen. Der Koloss wird größer und voller von den Bildern, von den Broten und Würsten. Bald ist sein Bett zu klein, und er bringt den Hörer kaum ans Ohr, seine Arme sind zu dick, die Finger, um den Hörer zu halten. Die Abdrücke wachsen vor dem Haus. Er versucht, den Hund zu streicheln. Am Abend schiebt er Dinge in sich hinein. Ein Brot, zwei Brote, drei Brote, viele Brote, während die Frauen und Männer am Strand tanzen, während auf den Bildern die Sonne untergeht und Palmenblätter sich vor dem Sonnenuntergang bewegen. Auch beim Koloss verschwindet die Sonne, er wird größer und größer. Er füllt den Raum, kann sich nicht mehr bewegen. Er sieht seine Arme nicht, die Beine nicht, den Bildschirm sieht er nicht. Der Koloss kann die Tür nicht öffnen, durch das Fenster kommt der Sommergeruch, kommt ein feiner Wind hinein und streichelt ihn am Bein. Und das Telefon klingelt irgendwo unter seinem Fleisch.
Zu Hause streichle ich, bei Mutter im Bett liegend, ihren Rücken. Sie schläft. Ich schreibe Mutter einen Brief.
Liebe Mama,
bei uns im Treppenhaus riecht es nach alten Sachen. Nach altem Öl oder nach alten Spaghetti, nach Kleidern. Aber in unserer Wohnung riecht es gut und ist es hell. Ich bin sehr gerne hier.
Deine Anais.