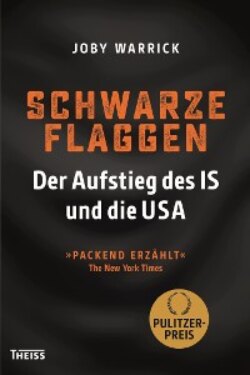Читать книгу Schwarze Flaggen - Joby Warrick - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog Amman, Jordanien, 3. Februar 2015
ОглавлениеKurz nach Einbruch der Dunkelheit traf im wichtigsten Frauengefängnis des Landes ein Vollstreckungsbefehl ein. Die Anweisung, Sadschida al-Rischawi hinzurichten, war von König Abdullah II. persönlich unterschrieben worden, der sich damals auf einem Staatsbesuch in Washington befand. Mit seinem Privatflugzeug hatte man den Befehl an den Königshof in der jordanischen Hauptstadt überstellt. Ein Angestellter gab diesen an das Innenministerium weiter, und von dort aus erreichte er die für das Justizvollzugswesen zuständige Abteilung. Hier sorgte der Vollstreckungsbefehl für Aufregung – eine staatliche Hinrichtung ist eine komplizierte Angelegenheit, die zahlreiche Verwaltungsgänge einschließt. Doch die Anweisungen des Königs waren unmissverständlich: Sadschida al-Rischawi sollte bereits am nächsten Tag bei Sonnenaufgang am Galgen hängen.
Der Anstaltsleiter ging schnell zu der Zelle, in der Rischawi bereits seit fast zehn Jahren in einer Form von selbst auferlegter Einzelhaft dahinvegetierte. Die Gefangene war inzwischen 45 Jahre alt und längst nicht mehr so schlank wie einst. Sie verbrachte die meiste Zeit damit, fernzusehen und in einer Taschenbuchausgabe des Korans zu lesen. Sie redete mit keinem, und falls sie sich über irgendetwas Gedanken machte, so blieben diese unter ihrem schmutzigen Hidschab, der Teil der Sträflingskleidung war, verborgen. Sie war nicht dumm, doch schien sie von dem, was sich um sie herum abspielte, nichts mehr mitzubekommen. »Wann darf ich wieder nach Hause?«, fragte sie ihren Pflichtverteidiger jedes Mal, wenn er sie in den Monaten nach ihrer Verurteilung zum Tode besuchte. Immer seltener kam der Anwalt vorbei, irgendwann gar nicht mehr. Als sich nun der Anstaltsleiter mit ihr zusammensetzte und ihr klarmachte, dass sie am nächsten Morgen sterben würde, nickte Rischawi, sagte aber nichts. Falls sie weinte oder betete oder fluchte, dann tat sie es so, dass niemand im Gefängnis etwas davon mitbekam.
Dass sie hingerichtet wurde, war indes keine Überraschung. 2006 hatte ein Richter Rischawi zum Tode verurteilt, weil sie mitverantwortlich für den schlimmsten Terroranschlag war, den Jordanien je erlebt hatte: Drei gleichzeitig in verschiedenen Hotels gezündete Bomben hatten damals 60 Menschen in den Tod gerissen, von denen die meisten einer Hochzeitsgesellschaft angehört hatten. Rischawi war die Selbstmordattentäterin, die überlebt hatte. Später wurde die ungelenke, sonderbar wirkende Frau mit den buschigen Augenbrauen vor die TV-Kameras gezerrt, wo man sie ihren defekten Sprengstoffgürtel präsentieren ließ. Damals kannte jeder in Amman ihre Geschichte: Wie die 35 Jahre alte unverheiratete Irakerin eingewilligt hatte, einen Fremden zu heiraten, mit dem zusammen sie sich in die Luft sprengen wollte. Wie sie in Panik geraten und davongerannt war. Wie sie sich im Taxi völlig orientierungslos durch die Außenbezirke der Stadt fahren ließ. Wie sie Passanten nach dem Weg gefragt hatte, ihre Kleidung und Schuhe noch immer blutbefleckt.
Aber all das war nun fast zehn Jahre her. Die Hotels waren wieder aufgebaut und umbenannt worden, und Rischawi war im Labyrinth des jordanischen Strafvollzugssystems verschwunden. Innerhalb des Dschuwaida-Frauengefängnisses war sie so etwas wie eine verblasste Berühmtheit, fast wie ein Exponat im Museum, das man so gut kennt, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Die älteren Angehörigen des Staatssicherheitsdienstes nannten sie hin und wieder noch »Zarqawis Frau« – eine spöttische Anspielung auf den berüchtigten jordanischen Terroristen Abu Mus‘ab az-Zarqawi, der die Anschläge auf die Hotels angeordnet hatte. Die jüngeren erinnerten sich kaum noch an sie.
Doch innerhalb weniger Wochen sollte sich all das radikal ändern. Wie sich herausstellte, hatten Zarqawis Anhänger Sadschida al-Rischawi nicht vergessen. Die Terroristen hatten sich im Laufe der Jahre neu organisiert und waren in Jordanien inzwischen unter einem anderen Namen bekannt – dem arabischen Akronym »Daesh«, auf Deutsch: ISIS. Im Januar 2015 verlangte ISIS Rischawi zurück.
Die Forderung ihrer Freilassung kam mitten während der schlimmsten innenpolitischen Krise, die Jordanien seit Jahren erlebt hatte. Ein Jet der jordanischen Luftwaffe war über Syrien abgestürzt, und der überlebende junge Pilot war von ISIS-Kämpfern gefangen genommen worden. Die Terroristen hatten Fotos verbreitet, auf denen der Pilot verängstigt und halbnackt von grinsenden Dschihadisten vorgeführt wird. Einige von ihnen strecken die Arme aus, um das großartige Geschenk zu umarmen, das Allah ihnen direkt vom Himmel in den Schoß hatte fallen lassen.
Vom König und seinen Beratern im Palast bis hin zu den Sicherheitsbehörden machte man sich auf weitere schlechte Nachrichten gefasst. Allen war klar: Entweder würde der Pilot öffentlich von ISIS hingerichtet werden, oder die Terroristen würden als Gegenleistung für seine Freilassung einen Preis verlangen.
Wie erwartet verkündete ISIS seine Entscheidung auf ziemlich makabre Weise. Kaum eine Woche nach dem Flugzeugabsturz erhielt die Familie des entführten Piloten Zuhause einen Anruf vom Handy des Piloten aus. Am anderen Ende der Leitung teilte ein Fremder auf Arabisch mit irakischem Akzent die einzige Forderung der Gruppe mit.
»Wir wollen unsere Schwester Sadschida«, sagte der Anrufer.
Im Laufe der folgenden, größtenteils recht einseitigen Verhandlungen wurde diese Forderung immer wieder aufs Neue wiederholt, und weitere kamen hinzu. All diese Forderungen wurden an die Zentrale des jordanischen Geheimdienstes Muchabarat weitergeleitet, wo sie zuletzt auf dem Schreibtisch des Brigadiers landeten, der die Anti-Terror-Abteilung leitete. Mit seinen 47 Jahren war Abu Haytham immer noch eine imposante Erscheinung: Er hatte den stämmigen Körperbau eines Straßenkämpfers, war äußerst hart im Nehmen und innerhalb der Behörde berüchtigt für seine Zähigkeit. Seit Jahren kämpfte er gegen ISIS sowie dessen viele Inkarnationen, und er gehörte zu den wenigen, denen es gelungen war, einige Top-Funktionäre der Gruppe im Verhör weichzuklopfen. Zarqawi höchstpersönlich hatte eine Zeit lang in Abu Haythams Arrestzelle gesessen, genau wie Sadschida al-Rischawi – die Frau, die ISIS jetzt befreien wollte.
Außerhalb von Jordanien machte diese Forderung wenig Sinn. Rischawi war als Kämpferin oder Anführerin wertlos, sie taugte nicht einmal als Symbol. Jeder wusste, dass sie an einem einzigen Terroranschlag beteiligt gewesen war, und den hatte sie verpatzt. Sie war mitnichten »Zarqawis Frau«; tatsächlich hatte sie den Mann, der den Anschlag befohlen hatte, nie getroffen. Hätte ISIS ihren Namen nicht plötzlich aufs Tapet gebracht, so hätte sie wohl ihr restliches Leben still und leise im Gefängnis verbracht; ihre Hinrichtung wäre immer wieder aufgeschoben worden, da es ja keinen triftigen Grund gegeben hätte, diese durchzuführen.
Doch Abu Haytham verstand genau, was los war. Mit dem Namen Rischawi erinnerten die Terroristen an die Anfänge ihrer Gruppe, an eine Zeit vor ISIS und vor dem Bürgerkrieg in Syrien; bevor es zum Zusammenbruch des Irak kam, der der Bewegung solchen Auftrieb gegeben hatte; sogar bevor die Welt von einem Terroristen namens Zarqawi gehört hatte. Die Männer des Muchabarat hatten versucht, diese Terrorgruppe daran zu hindern, Fuß zu fassen. Und sie hatten versagt – manchmal, weil sie selbst Fehler gemacht hatten, noch häufiger aber wegen den Fehlberechnungen anderer. Jetzt hatte sich Zarqawis Dschihad-Bewegung zu einem eigenen Staat erklärt, mit territorialen Ansprüchen auf zwei von Jordaniens Staatsgrenzen. Und Rischawi, die gescheiterte Selbstmordattentäterin, war eine von vielen alten Rechnungen, die ISIS nun begleichen wollte.
Indem dieser, schon fast in Vergessenheit geratene Geist heraufbeschwört wurde, weckte ISIS die Erinnerung an eine der schrecklichsten Nächte in der Geschichte des Landes – einen Moment, der sich für immer ins Gedächtnis von Abu Haytham und den Angehörigen seiner Generation eingebrannt hatte; Männern, die damals Nachrichtendienstler, Ermittlungsbeamte und Abgeordnete gewesen waren und die mittlerweile in die Führungsriege des Muchabarat aufgestiegen waren. Damals hatte Zarqawi Jordanien mitten ins Herz getroffen, und jetzt, wo ISIS einen jordanischen Piloten in seiner Gewalt hatte, schien sich die Geschichte zu wiederholen.
Abu Haytham war an jenem Abend vor Ort gewesen. Wenn er daran zurückdachte, konnte er sich an jedes noch so kleine Detail des Verbrechens erinnern, für das man Rischawi schuldig gesprochen und zum Tod durch den Strick verurteilt hatte. Der Geruch von Blut und Rauch stieg ihm dann in die Nase, er konnte wieder die Schreie der Verletzten hören.
Vor allem aber musste er an die beiden Mädchen denken.
Sie waren Cousinen, 9 und 14 Jahre alt, und er wusste sogar noch ihre Namen: Lina und Riham. Zwei Mädchen aus Amman, die zur Hochzeitsgesellschaft gehörten. Beide trugen sie weiß, ihre kleinen Gesichter waren hübsch und blass, vollkommen ruhig. »Wie zwei Engel«, fuhr es ihm durch den Kopf.
Sie trugen noch immer die fast identischen, mit Spitze verzierten Kleider, die ihnen die Eltern für das Fest gekauft hatten, und ihre Tanzschuhe. Wie durch ein Wunder hatte keine der beiden vom Hals aufwärts auch nur einen Kratzer erlitten. Als Abu Haytham im Krankenhaus eintraf und sie zum ersten Mal sah, wie sie da inmitten des Chaos nebeneinander auf einem Brett lagen, fragte er sich, ob sie schliefen. Vielleicht waren sie nur verletzt, und man hatte ihnen Beruhigungsmittel verabreicht? »Bitte«, betete er, »gib, dass sie nur schlafen«.
Dann erst bemerkte er die Löcher, die das Schrapnell gerissen hatte.
Die Mädchen müssen gestanden haben, als es passierte, so wie die anderen Gäste auch. Sie jubelten und klatschten Beifall, als Braut und Bräutigam den Ballsaal des Radisson Hotels in Amman betraten, der an diesem kühlen Novemberabend glitzerte und leuchtete, wie ein Jahrmarkt in der Wüste. Die Väter der zwei Vermählten hatten in ihren geliehenen Smokings und mit breitem Grinsen gerade auf dem Podium Platz genommen; die Holzbläser und Trommeln der arabischen Tanzkapelle hatten sich zu einer solch infernalischen Lautstärke hochgeschaukelt, dass die Hotelangestellten in der Lobby brüllen mussten, um gehört zu werden. Die Feier stand kurz vor ihrem lauten, schweißtreibenden und ausgelassenen Höhepunkt. Niemand achtete auf die zwei Gestalten in dunklen Jacken, die zunächst eine Weile an der Tür verbracht hatten, sich nun unter die jubelnden Hochzeitsgäste mischten und in Richtung der Vorderseite des Saales vorbewegten.
Plötzlich blitzte es grell auf, dann schien alles ins Bodenlose zu stürzen – die Decke, die Wände, der Fußboden. Durch die Druckwelle fielen die Hotelgäste in den oberen Etagen aus ihren Betten; in der Lobby zerbarsten die dicken Glastüren.
Ein Donnerschlag, dann Stille. Dann Schreie.
Nur eine der Bomben war explodiert, aber mit ihr wurden Hunderte Stahlkugeln, die dicht an dicht um den explosiven Kern gepackt waren, durch den Ballsaal geschossen. Wie ein Schwarm umherfliegender Rasierklingen schnitten sie die hochzeitliche Dekoration, Essenstabletts und Polstermöbel entzwei. Sie ließen Holztische zersplittern und zerschmetterten Marmorfliesen. Sie schlugen durch Abendkleider und teure Handtaschen, durch Sakkos und frisch gestärkte Hemden und durch weiße Rüschenkleider, wie sie junge Mädchen bei einem so förmlichen Anlass zu tragen pflegen.
An jenem Mittwoch im November 2005 war Abu Haytham, damals Kommandant, kurz vor Dienstschluss. Wie schon seit vielen Tagen dauerte auch heute seine Schicht länger als gewöhnlich. Kurz vor 21 Uhr kam der erste Anruf: Im Grand Hyatt auf der anderen Seite der Stadt habe es irgendeine Art von Explosion gegeben. Zu diesem Zeitpunkt nahm man noch an, dass vielleicht eine Gasflasche die Ursache dafür sei, aber dann kam die Nachricht von einer zweiten Explosion, im Days Inn Hotel, und dann einer dritten – angeblich noch schlimmer als die vorherigen beiden – im Radisson. Abu Haytham kannte das Radisson gut. Es war beinahe so etwas wie ein Wahrzeichen von Amman, glamourös und topmodern (zumindest nach jordanischen Standards). Es lag auf einer Anhöhe und war fast überall in der Stadt gut sichtbar, auch von Abu Haythams Büro aus, das drei Kilometer entfernt lag.
Er fuhr in aller Eile zum Hotel und kämpfte sich ins Innere vor, vorbei an Rettungskräften, weinenden Überlebenden und geborgenen Leichen, die man kurzerhand auf Gepäckwagen stapelte und auf die Auffahrt schob. Im Ballsaal sah er durch einen Schleier von Rauch, der nur von der Notbeleuchtung erhellt wurde, weitere Tote. Einige waren in merkwürdigen Körperhaltungen auf dem Boden ausgestreckt, als hätte sie ein Riese durch den Saal geschleudert. Anderen fehlten Gliedmaße. Auf dem Podium lagen zwei nicht mehr als menschlich erkennbare Gestalten in den Überresten ihrer Smokings. Die Attentäter hatten ihre Bomben ganz in der Nähe der Väter des Hochzeitspaares gezündet. Beide waren sofort tot gewesen.
Abu Haytham stellte mehrere Teams zusammen, die die ganze Nacht hindurch an den drei Tatorten arbeiteten. Sie sammelten ein, was sie von den Sprengkörpern an Überresten finden konnten, und bargen Fleischstücke, die zu drei Selbstmordattentätern zu gehören schienen. Erst später, im Krankenhaus, als er sich im provisorischen Leichenschauhaus über eine Holzplatte beugte, wurde er vom Schrecken dieser Nacht überwältigt: Von den kaputten Leibern. Den zahllosen Verletzten. Dem Geruch von Blut und Rauch. Den beiden Mädchen, Lina und Riham, die in ihren zerrissenen weißen Kleidern dalagen. Abu Haytham war ein Familienmensch, er hatte zwei Töchter im selben Alter.
»Wie kann jemand«, sagte er laut, »in dem ein Menschenherz schlägt, so etwas tun?«
Keine zwei Tage später erfuhr er, dass einer der Attentäter – eine Frau – überlebt hatte und geflohen war. Und bereits am nächsten Tag saß Sadschida al-Rischawi vor ihm.
Sie musste etwas wissen, immerhin hatte sie bei der gut geplanten Aktion eine wichtige Rolle übernommen. Wo würden die Terroristen als Nächstes zuschlagen? Wie sahen ihre Pläne aus? Würde vielleicht sogar jetzt gleich, in der nächsten Stunde, wieder etwas passieren?
»Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht«, war das Einzige, das die Frau gelegentlich von sich gab. Ein leises Murmeln, das sie immer wieder aufs Neue wiederholte, als stünde sie unter Drogen. Abu Haytham flehte sie an. Er drohte ihr. Er appellierte an ihr Gewissen und ihren Glauben an Allah. So vergingen mehrere Stunden – entscheidende Stunden, wie er fürchtete.
»Sie sind ja gehirngewaschen!«, brüllte er sie schließlich an. »Warum schützen Sie die Leute, die Sie zu so etwas angestiftet haben, auch noch?«
Der Frau kam nicht eine nützliche Silbe über die Lippen, weder in jener Nacht noch in den Monaten, die folgen sollten, nachdem man sie schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt hatte. Und doch war Abu Haytham sofort klar, wer hinter den Attentaten steckte. Jeder beim Muchabarat wusste es, noch bevor der Täter in einer Audioaufnahme mit prahlerischer Stimme die Verantwortung für die Tat übernahm. Alle Charakteristika waren da: die koordinierten Explosionen, die allesamt binnen zehn Minuten erfolgten; der Einsatz von Selbstmordattentätern; die Cyclonitbomben, die lose Metallteile enthielten, um möglichst viele Menschen mit in den Tod zu reißen. Vor allem die Auswahl der Ziele sprach Bände – gewöhnliche Hotels, in denen die Mittelschicht von Amman auch an jedem anderen Abend Säle mietete und sich für besondere Anlässe in Schale warf. Um 21 Uhr an einem Wochentag würde sicherlich kein Geheimdienstoffizier durch die Lobby des Radisson spazieren, dafür aber zahlreiche Jordanier, die an den Ritualen ihres alltäglichen Lebens festhielten. Bürger eines Landes, das an ein Kriegsgebiet grenzte.
Das alles war typisch für einen Mann, der beim Muchabarat bekannt war und dessen Stimme man auf der Audioaufnahme hörte: Abu Mus‘ab az-Zarqawi. Zum Zeitpunkt der Bombenanschläge war er der Kopf eines besonders grausam agierenden Terrornetzwerks namens Al-Qaida im Irak. In Jordanien kannte man Zarqawi noch von früher, als Ahmad, den Ganoven, einen Schulabbrecher, Trinker und Schläger. Man hatte mitbekommen, wie er Ende der 1980er-Jahre nach Afghanistan gegangen war, um gegen die Kommunisten zu kämpfen, und auch wie er wieder als kampferprobter religiöser Fanatiker heimgekehrt war. Nach seinem ersten Terroranschlag verschwand er in einem der übelsten Gefängnisse Jordaniens. Diesmal kam er als ein kampferprobter religiöser Fanatiker zurück, der mühelos zahlreiche Anhänger um sich scharte.
Abu Haytham hatte zu denen gehört, die versucht hatten, Zarqawi nach seiner Entlassung aus der Haft auf den rechten Weg zu führen. Er hatte sich 1999 als letzter Geheimdienstoffizier mit ihm unterhalten, bevor Zarqawi gestattet wurde, das Land für immer zu verlassen und wieder nach Afghanistan zu gehen – auf dem Weg in eine Zukunft, die ihm (wie man in Jordanien glaubte) kaum mehr zu bieten hatte als ein paar sinnlos verbrachte Jahre und ein staubiges Grab.
Dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte: Die USA intervenierten. Außerhalb der Geheimdienste hatte kaum jemand den Namen Zarqawi gehört, bis Washington 2003 der Welt erklärte, dieser obskure Jordanier sei das Bindeglied zwischen der Diktatur im Irak und den Verschwörern hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001, und ihn auf diese Weise zum Superstar unter den Terroristen machte. Das entsprach zwar überhaupt nicht der Wahrheit, doch nur wenige Wochen später, als US-Truppen im Irak einmarschierten, hatte der plötzlich weltbekannte Terrorist eigene Finanziers, ein eigenes Schlachtfeld sowie einen eigenen Grund zu kämpfen – und schon bald Tausende eigene Anhänger. Drei unruhige Jahre lang brachte er den Irak vorsätzlich immer wieder an den Rand eines sektiererischen Krieges, indem er regelmäßig schiitische Zivilisten in Moscheen, auf Basaren und in Schulen töten ließ. Er versetzte Millionen von Menschen in Angst und Schrecken mit einer neuen, äußerst »intimen« Form des Terrorismus: der Enthauptung von Geiseln, die auf Video festgehalten und über das Internet direkt in die Wohnstuben auf der ganzen Welt geschickt wurde. Zwischendurch nahm er seine Heimat Jordanien ins Visier und trug dazu bei, dass der Sieg der Amerikaner im Irak zur teuersten Militäraktion der USA seit Vietnam wurde.
Was jedoch seine größte Leistung war, sollte sich erst Jahre später zeigen. Auch wenn seine neue Bewegung für viele als Ableger von Al-Qaida galt, war er doch niemandes Gefolgsmann. Seine neue Ausrichtung des Dschihadismus war ebenso brutal wie einzigartig. Osama bin Laden hatte alle muslimischen Nationen nach und nach vom schädlichen Einfluss des Westens befreien wollen, damit sie sich eines Tages zusammentun und eine einzige große islamische Theokratie bilden würden: ein Kalifat. Zarqawi hingegen wollte das Kalifat sofort. Er schreckte vor keiner noch so grausamen Bluttat zurück, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Er ging zu Recht davon aus, dass besonders theatralische Akte exzessiver Gewalt die hartgesottenen Dschihadisten anziehen und alle anderen so einschüchtern würden, dass sie sich ihm und seinen Leuten unterwerfen würden. Seine Strategie ging auf, und sie erschütterte die ganze Region in einer Weise, wie Al-Qaida es niemals vermocht hatte.
Allerdings trugen Zarqawis Exzesse zugleich zur immer stärkeren Entschlossenheit seiner Widersacher bei. Nach den Anschlägen auf die Hotels wollten Abu Haytham und die übrigen Mitarbeiter des Muchabarat nur eines: den Mann beseitigen, der sie befehligt hatte. Und als das ihnen im Jahr 2006 schließlich gelang, indem sie den Vereinigten Staaten Informationen lieferten, die zu Zarqawis Versteck führten, sah zunächst alles danach aus, als habe man mit dem Terroristen auch seine Organisation ausgeschaltet. Doch weit gefehlt. Seine Anhänger zogen sich in aller Stille in die gesetzlosen Provinzen Syriens zurück, und 2013 waren sie auf einmal wieder da – nicht mehr als Terrorgruppe, sondern als eine Armee.
Diesmal weigerte sich das kriegsmüde Amerika einzugreifen, bis es zu spät war. Weder wurde ein ernsthafter Versuch unternommen, die gemäßigten Rebellen, die ISIS am Aufbau eines sicheren Stützpunktes hindern wollten, mit Waffen auszurüsten, noch gab es Luftangriffe gegen die Führungsriege oder die Versorgungsrouten von ISIS. Zweimal innerhalb eines Jahrzehntes hatte eine Welle von Dschihadisten gedroht, die Region in den Untergang zu reißen. Und zweimal, so schien es zumindest den Jordaniern, reagierten die Amerikaner, indem sie ein weiteres Loch in das Rettungsboot schnitten.
Zarqawis Nachfolger gaben sich unterschiedliche Namen, bevor sie sich auf ISIS einigten, »Islamischer Staat im Irak und in Syrien« – oder kurz IS, »Islamischer Staat«, wie die Organisation heute genannt wird. Zarqawi jedoch war für sie nach wie vor der »Mudschahed-Scheich«, der Gründer ihrer Bewegung, der die Kühnheit besessen hatte, zu glauben, die Grenzen im Nahen Osten neu ziehen zu können. Und genau wie Zarqawi waren sie der Meinung, noch lange nicht an ihrem Ziel zu sein.
In den »Hadith« genannten prophetischen Passagen der heiligen Texte des Islam sah Zarqawi sein Schicksal vorherbestimmt. Er und seine Männer waren die schwarz gekleideten Soldaten, über die die alten Gelehrten schrieben: »Die schwarzen Flaggen werden aus dem Osten kommen, angeführt von mächtigen Männern mit langen Haaren und Bärten, die als Familiennamen die Namen ihrer Heimatstädte tragen.« Diese Eroberer würden nicht nur die alten muslimischen Länder zurückfordern. Sie würden auch zum letzten großen Kampf aufrufen, der zur Vernichtung der großen Armeen des Westens im Norden Syriens führen würde.
»Hier im Irak wurde der Funke gezündet«, hatte Zarqawi gepredigt, »der zu jener Flamme wird, die die Armeen der Kreuzritter in Dabiq verbrennen wird.« Beim Muchabarat hatte man oft genug solche Worte aus Zarqawis Mund gehört, damals, als er ihr Gefangener war. Nun kamen diese Worte von seinen Nachfolgern. Mit 30.000 Mann warteten sie direkt hinter der Grenze und forderten die Herausgabe ihrer Schwester Sadschida.
Am 3. Februar 2015 endete jeder Gedanke an einen Gefangenenaustausch abrupt. Es war ein Tag nach der Ankunft des Königs von Jordanien in Washington. Für Abdullah II. bildete dieser Staatsbesuch den Schlusspunkt einer ganzen Reihe anstrengender Reisen, auf denen er gebetsmühlenartig immer wieder denselben Hilferuf wiederholt hatte. Sein kleines Land musste gleich zwei fremdbestimmte Lasten tragen: eine regelrechte Flutwelle von Flüchtlingen aus Syrien – bislang rund 600.000 – und seinen Anteil an den Kosten des Feldzugs gegen den IS, an dem sich westliche und arabische Mächte beteiligten. Der König erreichte auch in den USA nicht viel: Die Mitglieder des Kongresses sicherten ihm zwar zu, auf seiner Seite zu stehen, mehr passierte aber nicht. Beamte des Weißen Hauses machten die üblichen Zusagen, dass man Jordanien helfen werde, sich zu verteidigen und seine Wirtschaft stabil zu halten. Doch die Art von Unterstützung, die Abdullah am dringendsten benötigte, war nirgends in Sicht.
Die Enttäuschung des Königs war längst in Feindseligkeit umgeschlagen. Schon bei seinen früheren Besuchen hatte sich US-Präsident Obama geweigert, seinen Wunsch nach lasergesteuerter Munition und anderen modernen Waffensystemen zu erfüllen, mit denen Jordanien es mit den Lastwagen und Panzern des IS hätte aufnehmen können. Auf der jetzigen Reise war nicht einmal ein Treffen zwischen den beiden Staatsmännern vereinbart.
Abdullah saß gerade im Kapitol mit Senator John McCain zusammen, um dem republikanischen Senator und Vorsitzenden des United States Senate Committee on Armed Services ein paar Zugeständnisse abzuringen, als einer seiner Bediensteten den Raum betrat und das Gespräch unterbrach. Der König folgte ihm vor die Tür, und dann sah er sich auf dem Display eines Smartphones die finale Stellungnahme des IS zum geforderten Gefangenenaustausch an. Vor laufender Kamera sperrten maskierte Dschihadisten den jungen jordanischen Pilot in einen kleinen, mit Benzin übergossenen Metallkäfig. Dann zündeten sie ihn an und filmten, wie der Pilot bei lebendigem Leib verbrannte.
Als Abdullah zu McCain zurückkehrte, hatten dessen Assistenten das Video bereits gesehen. Der König blieb nach außen hin gelassen, McCain erkannte aber, wie erschüttert er tatsächlich war.
»Können wir noch mehr für Sie tun?«, fragte McCain.
»Sie tun doch bis jetzt überhaupt nichts für uns«, sagte Abdullah schließlich. »Wir haben immer noch ausschließlich ballistische Bomben, und nicht einmal davon erhalten wir genügend Nachschub. Inzwischen fliegen wir 200 Prozent mehr Einsätze als alle anderen Alliierten zusammen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten.«
Der König nahm noch ein paar weitere Termine wahr, doch sein Entschluss zur Heimkehr stand bereits fest. Als er gerade dabei war, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, rief das Weiße Haus an. 15 Minuten mit dem Präsidenten könne er haben. Abdullah sagte zu.
Im Oval Office sprach Obama der Familie des Piloten sein Beileid aus und dankte dem König für den Beitrag Jordaniens am Feldzug gegen den IS. Seine Regierung tue alles, was in ihrer Macht stehe, um ihm zu helfen, versicherte der Präsident dem Monarchen.
»Nein, Sir, das tut sie nicht«, erwiderte Abdullah mit fester Stimme und ratterte eine Liste der Waffen und Gerätschaften herunter, die sein Land benötigte.
»Drei Tage reichen unsere Bomben noch«, fügte er hinzu, wie einer der anwesenden Beamten später berichtete. »Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich in den Krieg, und ich werde jede einzelne Bombe, die ich habe, benutzen, bis sie aufgebraucht sind.«
Ein letzter Punkt stand noch auf Abdullahs Agenda, bevor er abreisen konnte. Vom Flughafen aus rief er seine Adjutanten in Amman an und trug ihnen auf, zwei Hinrichtungen vorzubereiten. Im Todestrakt saßen zwei Häftlinge, die für mehrere im Auftrag von Zarqawi begangene Morde verurteilt worden waren: Ein Iraker aus der mittleren Riege von Zarqawis irakischen Rebellen – und Sadschida al-Rischawi. Beide sollten so schnell wie möglich hingerichtet werden.
Der König ahnte, dass die Regierungen im Westen diese Hinrichtungen als Racheakt missbilligen würden, auch wenn beide Häftlinge rechtskräftig und im Rahmen ganz normaler Gerichtsverfahren verurteilt worden waren. Aber er würde sich nicht einschüchtern lassen. Seines Erachtens hatte man den Henker bereits viel zu lange warten lassen, wie er seinen Adjutanten mitteilte.
»Ich will kein Wort hören. Von niemandem!«, sagte Abdullah.
Der König befand sich noch in der Luft, als die Wachen Sadschida al-Rischawi um 2 Uhr morgens Ortszeit aus ihrer Zelle holten. Sie lehnte das übliche Henkersmahl ab und auch das rituelle Bad, mit dem gläubige Muslime ihren Körper reinigen, um sich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Sie zog die rote Uniform an, die ausschließlich Verurteilte am Tag ihrer Hinrichtung trugen, und setzte sich den üblichen Hidschab auf, der Kopf und Gesicht verhüllte.
Man führte sie aus dem Gefängnis zu einem Kleinbus mit Militäreskorte, der sie nach Swaqa bringen sollte, zur größten Vollzugsanstalt Jordaniens, die etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt auf einem einsamen Hügel lag. Kurz vor 4 Uhr trafen die Fahrzeuge ein. Durch einen leichten Dunst näherte sich der Vollmond dem südwestlichen Horizont.
Das Letzte, was sie sah, bevor man ihr die Augen verband, war eine kleine Kammer mit geweißten Wänden und ein paar winzigen Fensteröffnungen sowie ein paar müde Gesichter aus der Zeugengalerie unterhalb des Raumes. Ein Imam sprach ein Gebet, während man eine Schlinge mit einer stabilen Metallklammer sicherte. Ein Richter fragte Rischawi, ob sie irgendwelche letzten Wünsche habe oder einen letzten Willen verkünden wolle. Sie antwortete nicht.
Als sich die Falltür unter dem Galgen öffnete und sie in die Dunkelheit stürzte, gab sie keinen hörbaren Laut von sich. Es war 5:05 Uhr, etwa anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang, als der Gefängnisarzt ihren Puls prüfte.
»Zarqawis Frau« war tot, ihre Hinrichtung der letzte Akt des schlimmsten Terroranschlages in der Geschichte Jordaniens. Doch »Zarqawis Kinder« verfolgten bereits ganz andere Pläne, die der Gründer ihnen hinterlassen hatte: das Ende von Jordanien und seinem König, die Auslöschung der internationalen Grenzen und die Zerstörung aller modernen Staaten des Nahen Ostens. Dann, wenn über den muslimischen Hauptstädten von der Levante bis zum Persischen Golf die schwarzen Flaggen wehen würden, konnte er endlich beginnen – der große apokalyptische Showdown mit dem Westen.