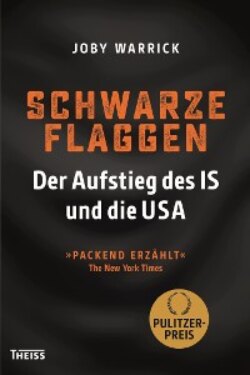Читать книгу Schwarze Flaggen - Joby Warrick - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
»Ein Problem wie das hier wird man nicht mehr los«
ОглавлениеNach sechs Monaten in Freiheit betrat Abu Mus‘ab az-Zarqawi die Abflughalle des Queen Alia International Airport von Amman. Er wollte Jordanien verlassen, und zwar für immer. Im Gepäck hatte er neben einem frisch ausgestellten jordanischen Reisepass mit der Nummer Z393834, in dem ein Visumstempel von Pakistan prangte, auch eine druckfertige Titelgeschichte: Der Kriegsveteran und Ex-Sträfling Zarqawi ging in die Wirtschaft, um sich im internationalen Honighandel zu betätigen.
Er hatte sogar seine Mutter dabei, die 50 Jahre alte Dallah al-Chalaila, eine durchaus nützliche Staffage für jemanden, der als einfacher Geschäftsmann auf der Suche nach Partnern für seine Bienenzucht durchgehen wollte. Auffallend war die Abwesenheit seiner Frau und seiner drei Kinder. Dort, wo Zarqawi in Wahrheit hinwollte, gab es keinen Platz für eine junge Familie; außerdem plante er bereits, sich eine zweite Ehefrau zu nehmen, sobald er sich niedergelassen hatte.
Er hatte nicht mit dem Empfang gerechnet, den der Muchabarat für ihn vorbereitet hatte.
Als er sich dem Gate näherte, kamen mehrere hochgewachsene Männer in dunklen Anzügen auf Zarqawi zu, packten ihn am Arm und stießen ihn in einen Nebenraum. Alles ging ganz schnell, sodass seine Mutter, völlig außer sich, plötzlich allein in der Abflughalle stand. Ein paar Minuten später fand sich Zarqawi im Hauptquartier der Spionageabwehr wieder. Er hatte sichtlich Mühe, sich zu beherrschen.
»Ich habe doch gar nichts getan!«, protestierte er. »Warum halten Sie mich hier fest?«
Der Mann, der Zarqawi gegenübersaß, hatte den Dschihadist inzwischen so oft verhört, dass er praktisch wusste, was dieser sagen würde, schon bevor er den Mund aufmachte. Geheimdienstoffizier Abu Haytham arbeitete bereits seit 15 Jahren in der Anti-Terror-Abteilung des Muchabarat. Seit Wochen ließ er Zarqawi beobachten; ihr »Gespräch« hatte er sich eigens für dessen Abreise aufgespart. Zarqawi hatte ihn noch nie beeindruckt. Für ihn war der Mann lediglich einer von vielen islamistischen Hitzköpfen – vielleicht etwas lauter und aggressiver als die meisten anderen, aber ganz klar ohne jene Art von intellektuellen und organisatorischen Fähigkeiten, die ihn zu einem besonders gefährlichen Faktor gemacht hätten. Jetzt aber schien Zarqawi vorzuhaben, Jordanien für immer zu verlassen, und er hatte sich dafür eine ziemlich durchschaubare Tarnung zurechtgelegt. Was genau hatte er bloß vor?
In einer Hinsicht hatte Zarqawi durchaus recht: Seit seiner Entlassung aus der Haft hatte er keine Straftat begangen, zumindest keine so schwere, die eine derart dramatische Szene vor seiner Mutter und zahlreichen Flugreisenden gerechtfertigt hätte. Aber so einfach wollte der Muchabarat es ihm nicht machen. Im Gefängnis hatten sich Zarqawis Überzeugungen nur noch weiter verhärtet, und er hatte sein Netzwerk an möglichen Mitverschwörern ausgebaut. Nun besaß er ein Flugticket nach Peschawar in Pakistan, dem Tor zum Hindukusch. Hinter dem Hindukusch lag Afghanistan, und in Afghanistan hielt sich Osama bin Laden auf, der saudische Terrorist, der 1998 zwei US-Botschaften in Afrika in die Luft gejagt und den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt hatte.
Der Geheimdienstler hatte Zarqawis eigentliche Pläne noch nicht durchschaut, eines war ihm jedoch klar: Zarqawi hatte mit Sicherheit nicht vor, sich in den Bergen im Nordwesten Pakistans als Honigfabrikant niederzulassen. Wenn er sich dort mit Terroristen vernetzen sollte, könnte das am Ende auf Jordanien zurückfallen – mit fatalen Folgen.
»Man kann so jemanden nicht einfach abschieben und anderen überlassen«, erklärte Abu Haytham seinen Kollegen später. »Ein Problem wie das hier wird man nicht mehr los.«
Rein rechtlich konnten sie Zarqawi drei Tage lang festhalten, während die Agenten vom Muchabarat seine Sachen durchsuchten und seine Verwandten und Verbündeten befragten. De facto aber konnte der Sicherheitsdienst ihn so lange in Gewahrsam behalten, wie er wollte. Jeder wusste das, natürlich auch Zarqawi, der sich in der Verhörzelle der Spionageabwehr weiterhin nach Kräften bemühte, nicht die Beherrschung zu verlieren. Abu Haytham rieb es ihm trotzdem noch einmal unter die Nase.
»Als Sicherheitsdienst«, sagte er, »ist es unsere Pflicht, zu wissen, was Sie tun.«
Zarqawi war nicht immer so folgsam gewesen. Als Abu Haytham dem Mann, der damals noch Ahmad Fadil al-Chalaila hieß, zum ersten Mal begegnet war, war es alles andere als friedlich zugegangen; beinahe hätte es sogar Tote gegeben. Am 29. März 1994 gehörte Abu Haytham zu dem Team aus 14 schwer bewaffneten Offizieren, die eine Wohnung stürmten, in der sich Zarqawi aufhielt. Der Geheimdienst hatte damals eine Zelle im Visier, die aus afghanischen Kriegsveteranen bestand und mit einem geplanten terroristischen Anschlag in Verbindung stand. Die Mitglieder der Terrorzelle, die alle mit einem radikalen Prediger namens Abu Muhammad al-Maqdisi vernetzt waren, hatten sich Landminen und Panzerabwehrraketen verschafft und planten, an einem Grenzübergang israelische Soldaten anzugreifen. Man wusste, dass Zarqawi zu den Anführern der Zelle gehörte. Der damals 27-jährige Kriegsheimkehrer aus Afghanistan arbeitete in einer Videothek und traf sich in seiner Freizeit heimlich mit kleinen Gruppen islamischer Radikaler. Während andere Zellelemente bereits im Gefängnis des Muchabarat verschwunden waren, war Zarqawi aus seinem alten Zuhause aus- und in diese Wohnung eingezogen, um die letzten Vorkehrungen zur Flucht aus Jordanien zu treffen. Er hatte beinahe alles Nötige organisiert, als sich Abu Haytham und seine Kollegen in einer schmalen Gasse hinter dem Wohnblock zum Angriff sammelten.
Die Agenten hatten die Wohnung den ganzen Tag beobachtet. Nachdem Zarqawi nach Hause gekommen war, warteten sie noch mehrere Stunden. Die Lichter im Haus waren längst erloschen, als sie um 1 Uhr morgens mit einem Schlüssel, den der Vermieter ihnen ausgehändigt hatte, leise die Haustür aufschlossen und die Treppe hochstiegen. Sie entdeckten Zarqawi in einem Hinterzimmer. Er war allein und schlief.
Die Männer standen bereits am Fuß seines Bettes, als Zarqawi auf einmal aus dem Schlaf hochschreckte. Er stieß einen Fluch in Richtung der Fremden aus und schob eine Hand unter sein Kopfkissen. Scheinbar wollte er nach etwas greifen.
»Waffe!«, rief einer der Offiziere.
Mehrere Männer warfen sich auf Zarqawi, packten ihn, und einer ergriff die Waffe. In diesem Moment bemerkte einer der Angehörigen des Stoßtrupps, wie sich hinter einem Vorhang etwas bewegte. Instinktiv stürzte er auf den Vorhang zu. Dort stand ein zweiter Mann, ein Ägypter, der, zum Glück der Offiziere, unbewaffnet war.
»Wir wussten nicht, dass noch jemand in der Wohnung war«, erklärte Abu Haytham hinterher. »Wir entdeckten ihn nur, weil sich der Vorhang bewegte, obwohl dahinter kein Fenster war.«
Die Agenten warfen die Pistole – eine halbautomatische M 15 mit drei geladenen Magazinen – in ihren Kastenwagen und luden die vor sich hin fluchenden Verdächtigen ein. Zarqawi, der immer noch »bereit war zu töten«, wie einer der Anwesenden später aussagte, saß auf der Rückbank und starrte die Agenten wütend an. Sein Haar war verfilzt, und an den Ärmeln seines zerrissenen Nachthemds schauten seine Tätowierungen hervor.
»Er war wütend, und er fluchte: ›Ihr seid kafir, ihr seid Ungläubige!‹«, erinnerte sich der Offizier.
Dann ging es zum Verhör in die wie eine Festung abgeschottete Zentrale des Muchabarat. Samih Battichi, der bereits ergraute, weltgewandte Leiter des Geheimdienstes, sah zu, wie seine Männer in einer kleinen, grell ausgeleuchteten Zelle abwechselnd versuchten, Zarqawi zu zermürben. Doch der ließ sich kaum beeindrucken.
»Die Ideologie spritzte geradezu aus ihm heraus«, so Battichi. »Sein Kopf war voll davon.« Battichi, der bald zum Direktor der Behörde ernannt werden sollte, beobachtete seit Längerem mit wachsendem Unbehagen, wie immer mehr Jordanier aus Afghanistan heimkehrten, wo sie unter dem islamistischen Banner der Mudschaheddin gekämpft hatten. Wie er sich später erinnerte, waren die Jordanier, die als Freiwillige nach Afghanistan gezogen waren, zunächst »die Guten, die gegen die Kommunisten kämpften« – standen also ideologisch auf einer Linie mit den wichtigsten Verbündeten des Landes, namentlich den Amerikanern, den Briten und den Saudis. Nun kehrten sie als Veteranen zurück und vertraten auf einmal ganz andere Ansichten als zuvor; sie kleideten sich anders und sprachen anders. Zarqawi sah aus wie all die anderen und hörte sich auch so an, aber seine Aggressivität glich, wie Battichi fand, der eines Raubtieres im Käfig. Zarqawis jugendliche Vergangenheit als Raufbold und Kleinkrimineller war allen bekannt. Battichi fragte sich, ob inzwischen zwei Seiten seiner Persönlichkeit miteinander verschmolzen waren – der Gangster mit dem religiösen Fanatiker.
»Er passte in kein Profil«, erklärte Battichi. »Früher war er ein Schläger und ein Trinker. Seine besorgte Familie hatte versucht, ihn mithilfe religiöser Gruppen zur Vernunft zu bringen. Aber dann kam er auf einmal zu sehr zur Vernunft, wenn man das so sagen kann. Und jetzt verkörperte er das Schlechteste aus beiden Welten.«
Der Muchabarat war über Zarqawi bereits vor seiner Haftzeit ziemlich gut informiert gewesen. Nun konnten die Beamten die noch bestehenden Lücken in seiner dicken Polizeiakte und den zahllosen Berichten der Informanten der Spionageabwehr füllen.
Ahmad Fadil al-Chalaila hatte, wie die Aufzeichnungen zeigten, eine schlimme Kindheit gehabt. Sein Weg führte ihn vom Vandalismus über Drogen und Alkohol geradewegs in die schwere Kriminalität. Er kam am 30. Oktober 1966 zur Welt. Sein Vater war Beamter in der Stadtverwaltung von Zarqa, seine Mutter eine streng religiöse Frau, die den kleinen Ahmad über alles liebte und ihn stets seinen sieben Schwestern und zwei Brüdern vorzog. Die Familie lebte in einem bescheidenen zweistöckigen Haus auf einem Hügel oberhalb eines großen Friedhofs, wo die weniger betuchten Einwohner von Zarqa ihre Toten begruben. Der Friedhof ist heute wie damals alles andere als ein Schmuckstück. Tausende bröckelige, per Hand beschriebene Grabsteine liegen über ein abschüssiges, von Unkraut überwuchertes Gelände verteilt, auf dem wild lebende Katzen herumstreunen. Dennoch ist es für das Stadtviertel die einzige öffentliche Grünfläche. Als Kind spielte der spätere Abu Mus‘ab az-Zarqawi stundenlang auf dem Friedhof. Als Teenager machte er hier seine ersten Ausflüge in die Welt der Kriminalität.
Die Familie Chalaila gehörte einem großen und einflussreichen Beduinenstamm vom Ostufer des Jordan an, den Bani Hassans – wenn ein junger Mann auf der Suche nach einem Job Kontakte knüpfen wollte, war diese Tatsache in einer patriarchalischen Gesellschaft wie die von Jordanien durchaus von Vorteil. Zarqawi jedoch ließ eine Chance nach der anderen verstreichen. Er brach die Schule ab, trotz überdurchschnittlicher Noten und einer nachgewiesenen Begabung für bildende Kunst. Er absolvierte die zweijährige Wehrpflicht und nahm anschließend eine Arbeitsstelle in der Stadt an, die sein Vater ihm vermittelt hatte. Doch dort wurde er schon bald entlassen.
Seine kriminelle Karriere nahm ihren Anfang, als er 12 Jahre alt war und sich auf der Straße mit einem Jungen aus der Nachbarschaft prügelte. Er arbeitete als Zuhälter, stieg in den Drogenhandel ein und teilte immer wieder Schläge aus. In seinen späten Jugendjahren hatte er mehrere Tätowierungen und sich bereits einen Ruf als starker Trinker und brutaler Straßenkämpfer erworben, dem es Spaß machte, seine Opfer und Gegner mit Faust und Klinge zu quälen. Geheimdienstler und Bekannte, die damals mit ihm zu tun hatten, berichteten, dass er seine Sexualität auslebte, indem er jüngere Männer vergewaltigte, um so die eigene Dominanz zu unterstreichen und den anderen zu erniedrigen.
Mit 21 heiratete er seine Cousine Intisar, die ihm eine Tochter gebar. Aber Zarqawis große Liebe war und blieb seine Mutter. Dallah al-Chalaila ärgerte sich zwar immer wieder über ihren jüngsten Sohn, der ihr ständig Kummer bereitete, doch sie glaubte fest daran, dass er eigentlich ein guter Mensch sei und es am Ende doch noch zu etwas bringen würde. Zugleich wusste sie um die begrenzten intellektuellen Fähigkeiten ihres Sohnes. Als Jahre später einmal Journalisten in ihrem Haus auftauchten und ihr von Zarqawis Leistungen als Terroristenführer und Bombenbauer berichteten, wirkte sie ehrlich amüsiert.
»Er war nicht besonders intelligent«, erzählte sie einem amerikanischen Reporter. Sie gab zu, dass sich ihr Sohn »dem Islam hingegeben« habe, doch seine Entscheidung, sich den Dschihadisten anzuschließen, begründete sie damit, dass es dem jungen Mann schlichtweg nicht möglich gewesen sei, daheim eine andere Tätigkeit zu finden.
»Mein Sohn ist ein guter Mann, ein ganz gewöhnlicher Mann, ein Opfer der Justiz«, sagte sie.
Dabei war es eigentlich seine Mutter gewesen, die Zarqawi in Richtung der Islamisten getrieben hatte. Sie schickte ihn in die Koranschule der örtlichen al-Husain Ben-Ali-Moschee. Sie hoffte, dass er unter den Imamen und den frommen jungen Männern mit ihren theologischen Debatten und den Spendenaktionen für die muslimischen Gotteskrieger in Afghanistan bessere Vorbilder für sein Leben finden würde als auf der Straße. Zur Überraschung aller stürzte sich Zarqawi geradezu auf den Islam, mit all der Leidenschaft, die er zuvor in seine kriminellen Aktivitäten gesteckt hatte. Er schwor dem Alkohol ab und besuchte regelmäßig Gespräche über den Koran sowie das Freitagsgebet. Er verschlang Propagandavideos und -kassetten über die sektiererischen Kriege in Afghanistan, Bosnien und Tschetschenien. Als der Vorbeter der örtlichen Moschee die Anwesenden dazu aufrief, als Freiwillige nach Afghanistan zu ziehen und gegen die kommunistischen Unterdrücker der Muslime zu kämpfen, hob Zarqawi sofort die Hand.
Im Frühjahr 1989 traf er an der afghanisch-pakistanischen Grenze ein. Ein paar Wochen zuvor hatten sich die letzten sowjetischen Truppen aus dem Land zurückgezogen, doch er kam gerade noch rechtzeitig, um sich an einem islamistischen Angriff auf die pro-russische afghanische Regierung zu beteiligen, die sich plötzlich von Moskau alleingelassen sah. Später erinnerte sich einer der afghanischen Veteranen, die ihn am Flughafen begrüßten, an Zarqawi als einen drahtigen jungen Mann, der zu allem bereit schien, aber zugleich seltsam befangen wirkte. Er machte kaum den Mund auf; später erklärte er, dass er fürchtete, die anderen hätten sofort seine geringe Bildung und seine schlechten Kenntnisse über den Koran bemerkt. Trotz der drückenden Hitze trug er lange Ärmel, um seine Tätowierungen darunter zu verstecken.
»Wir alle wussten, wer er war: Er war dieser berüchtigte brutale Typ aus Zarqa«, sagte Hudhaifa Azzam, der damals ebenfalls in Afghanistan kämpfte und dessen Vater der einflussreiche palästinensische Geistliche Abdullah Azzam war, den viele für den Vordenker der globalen Dschihad-Bewegung hielten. »Nun hatte er zur Religion gefunden, und er schämte sich für seine Tätowierungen. Man konnte beobachten, wie er immer wieder verlegen seine Hände verbarg.«
Zarqawis erster Auftrag lautete, mehrere Artikel für eine Dschihadisten-Zeitschrift zu verfassen und die Heldentaten der Mudschaheddin auf dem Schlachtfeld zu beschreiben. Für einen jungen Mann mit begrenzter Schulbildung war das keine leichte Aufgabe. Einer seiner ersten Freunde vor Ort war Saleh al-Hami, ein Journalist, der bei der Explosion einer Landmine ein Bein verloren hatte. Zarqawi verbrachte Stunden um Stunden am Bett dieses Mannes und war so beeindruckt von dessen Hingabe, dass er eine seiner Schwestern nach Pakistan einfliegen ließ und mit dem Journalisten verheiratete. Sein neuer Schwager siedelte später nach Jordanien über und schrieb eine sehr wohlwollende Biografie über Zarqawi. Al-Hami beschrieb den jungen Zarqawi als einen hochemotionalen Menschen, dem beim Lesen des Korans schnell die Tränen kamen. Die meisten arabischen Kämpfer versuchten, ihre Emotionen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Nicht so der Jordanier.
»Immer, wenn er laut seine Gebete aufsagte, weinte Zarqawi«, schrieb al-Hami, »sogar dann, wenn er die Gebete leitete.«
Während der Pausen in seiner Ausbildung wanderte Zarqawi oft ziellos durch Peschawar. Hin und wieder besuchte er eine lokale Moschee, die vorzugsweise die arabischen Kämpfer frequentierten. Noch Jahre später erinnerte sich der Imam der Moschee lebhaft an den ernsthaften jungen Jordanier, der stets mit den Sünden seiner Vergangenheit beschäftigt zu sein schien. Als der Geistliche einmal davon erzählte, dass er eine Reise nach Mekka, der heiligsten Stadt des Islam, plane, kam Zarqawi mit einer Bitte auf ihn zu.
»Wenn Sie auf Pilgerfahrt gehen«, sagte der junge Mann, »beten Sie auf dem Weg dorthin zu Gott, dass er Abu Mus‘ab verzeiht.«
1991 nahm Zarqawi zum ersten Mal selbst an Kampfhandlungen teil, bei denen die Mudschaheddin-Rebellen in den Provinzen Paktia und Chost im Osten Afghanistans eine Offensive gegen die von der Regierung kontrollierten Städte starteten. Zarqawi war mit Begeisterung dabei und bewies einen Grad an Tapferkeit, der für manche seiner Kameraden schon fast an Tollkühnheit grenzte. Laut Azzam gelang es ihm einmal während der Kämpfe in Gardez im Osten des Landes, im Alleingang mindestens ein Dutzend Soldaten der afghanischen Regierung in Schach zu halten. Auf diese Weise hatte er so viel Zeit gewonnen, dass der Rest seiner Einheit entkommen konnte.
»Er war so mutig, dass ich zu sagen pflegte: Er hat ein totes Herz«, so Azzam. Wenn man Azzams Erinnerung Glauben schenken kann, schienen Zarqawis heroische Taten immer wieder über eine bloße Risikobereitschaft hinauszugehen. Scheinbar war da etwas, von dem er sich unbedingt befreien wollte. »Es war wirklich auffällig, wie sehr er mit seiner Vergangenheit beschäftigt war. Ständig wirkte er, als kämpfe er mit Schuldgefühlen«, sagte Azzam. »Ich bin überzeugt davon, dass das der Grund für seine Tapferkeit war. Er sagte immer: ›Was ich in meiner Vergangenheit getan habe, kann mir Allah nicht vergeben, es sei denn, ich werde zum schahid ‹« – zum Märtyrer.
Ein Märtyrer war Zarqawi am Ende zwar nicht, doch immerhin erarbeitete er sich in den Bergen im östlichen Afghanistan den Ruf eines glaubwürdigen Mudschahed – eines heiligen Kriegers. 1993 verließ er Afghanistan als Veteran mit einigen Jahren Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Er war tief in die Doktrin des militanten Islam eingetaucht und bei radikalen afghanischen und arabischen Geistlichen in die Lehre gegangen, die sich später mit den Taliban oder mit Osama bin Laden zusammentun sollten. Er hatte eine militärische Ausbildung im Trainingscamp von Abdul Rasul Sayyaf absolviert, dem Kommandanten der afghanischen Rebellen und späteren Mentor von Chalid Scheich Mohammed – dem Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001.
Wie die anderen afghanischen Kämpfer hatte er von dem berauschenden Cocktail gekostet, der durch die Kameradschaft auf dem Schlachtfeld und den im Grunde recht unwahrscheinlichen Erfolg der Rebellen entstand. Eine zusammengewürfelte Armee aus Afghanen und islamistischen Freiwilligen hatte die Sowjets mit ihrer immensen Übermacht gedemütigt. Wie ließ sich das anders erklären als mit einer göttlichen Intervention?
»Gott schenkte den muslimischen Mudschaheddin in Afghanistan den Sieg über die Ungläubigen«, erklärte Sayf al-Adel, ein Stellvertreter Osama bin Ladens, in einem schriftlichen Bericht über den Krieg. Viele Veteranen teilten seine Meinung, und Zarqawi war absolut überzeugt davon, dass er recht hatte.
1993 kehrte Abu Mus‘ab az-Zarqawi mit Hunderten anderen jordanischen Veteranen nach Hause zurück. Sie erkannten ihre Heimat kaum wieder. Doch nicht nur Jordanien hatte sich verändert. In den vergangenen vier Jahren, während Amman und die anderen Großstädte des Landes gewachsen und moderner geworden waren, waren Zarqawi und seine Kameraden quasi in der Zeit zurückgereist – das von den Taliban kontrollierte Afghanistan glich einem Ort, der in nahezu jeder Hinsicht der zivilisierten Welt Jahrhunderte hinterherhinkte.
Zurück in der Stadt, in der er aufgewachsen war, schien Zarqawi sein selbst gewählter Spitzname »der Fremde« auf einmal einzuholen. Er musste nur auf den lokalen Markt gehen, und schon tat sich für ihn eine Kluft auf zwischen dem gemäßigten, leichtlebigen Jordanien und der strengen islamischen Disziplin, die er in Afghanistan erlebt hatte. Zarqawi beschwerte sich bei Freunden darüber, wie schamlos sich die jordanischen Frauen kleideten und dass unverheiratete Paare zusammen in Cafés saßen und ins Kino gingen. Er schimpfte über eben jene Spirituosenläden und Sexshops, die er ein paar Jahre zuvor selbst besucht hatte. Sogar die eigene Familie enttäuschte ihn: Seine Mutter und seine Schwestern weigerten sich, die burkaartige Verschleierung zu tragen, die in Afghanistan üblich war, und seine Brüder erlaubten ihren Familien, sich im Fernsehen unislamische Filme und sogar Komödien anzuschauen. Die Nachrichtensendungen, die sich Zarqawi gelegentlich ansah, machten ihn nur noch wütender, vor allem, wenn über die Annäherung zwischen Palästinensern, Jordanien und Israel berichtet wurde. Ein möglicher Friedensschluss mit dem jüdischen Staat war für viele Islamisten ein Dorn im Auge. Es gab Leute, die früher für König Hussein durchs Feuer gegangen wären – diese eine Tat konnten sie dem Monarchen nicht verzeihen.
Eine Zeit lang versuchte es Zarqawi mit einem ganz normalen Leben – er nahm einen Job in einer Videothek an, die neben Hollywood-Filmen auch islamistische Propaganda im Angebot hatte. Doch über kurz oder lang fand er seinen Platz wieder dort, wo er seine eigentliche Bestimmung sah. Er las Bücher über die Helden des frühen Islam und war vor allem von Nur ad-Din Zengi fasziniert, einem Prinzen und Krieger des 12. Jahrhunderts aus Damaskus. Nur ad-Din war dafür bekannt, dass er eine Armee europäischer Kreuzritter besiegt und versucht hatte, den damaligen Flickenteppich muslimischer Königreiche unter einem Sultanat zu vereinigen, das sich vom Süden der Türkei bis zum Nil erstreckte. Nachdem seine Soldaten den aus Frankreich stammenden Fürsten von Antiochia getötet hatten, ließ Nur ad-Din dessen Kopf in einen silbernen Kasten legen und als Geschenk an den Kalifen in Bagdad schicken.
Zarqawi sollte sich ein paar Jahre später als moderne Inkarnation von Nur ad-Din stilisieren und versuchen, dessen militärische Strategie zu kopieren. Für den Moment beschied er sich aber damit, klein anzufangen. Zarqawi suchte einen alten Bekannten aus Afghanistan auf, einen Prediger und Gelehrten namens Abu Muhammad al-Maqdisi. Er besuchte Maqdisi in dessen Haus in Amman und verkündete, er wolle sich »in Jordanien im Namen der Religion betätigen«, wie sich der Gelehrte später erinnerte. Es war der Beginn einer langjährigen Partnerschaft. Zunächst trafen sie sich mit anderen afghanischen Veteranen, um gemeinsam den Koran zu studieren, später dann organisierten sie kleine Zellen für ambitioniertere Vorhaben.
»Wir druckten einige meiner Bücher aus und verteilten sie unter die Menschen«, schrieb Maqdisi später über diese Zeit. »Junge Männer scharten sich um uns, wenn wir riefen, und sie brachten unsere Bücher und unsere Botschaften in Umlauf.« Damals entstanden überall in Jordanien ähnliche Gruppen, die von unzufriedenen Ex-Mudschaheddin angeführt wurden. Einige von ihnen hatten bereits mit Angriffen auf Spirituosengeschäfte und andere Symbole westlicher Dekadenz begonnen. Bald genügte es auch Zarqawi nicht mehr, religiöse Traktate zu kopieren. Er überlegte sich, wie man die bevorstehenden Parlamentswahlen in Jordanien stören könnte, und redete aufgeregt über mögliche Ziele, bis manche in der Gruppe nervös wurden. »Er wollte, dass alles ganz schnell über die Bühne ging«, erinnerte sich Mohammed Abu al-Muntasir, ein jordanischer Islamist, der 1993 bei einigen dieser Treffen dabei war. »Er wollte alle seine Ziele innerhalb von ein paar Monaten erreichen, am besten sogar innerhalb von ein paar Stunden.« Seine Ungeduld führte dazu, dass Zarqawi »einseitige Entscheidungen« traf, »zur falschen Zeit und am falschen Ort«, so Muntasir. »Und was das Tragische war: Die meisten anderen stimmten ihm zu.«
Anfang 1994 gab sich die Gruppe einen Namen: Bay’at al-Imam, wörtlich: »der Treueeid zum Vorbeter«. Sie besaß auch bereits einen kleinen Vorrat an Waffen aus einer ganz unerwarteten Quelle: Maqdisi hatte in Kuwait gelebt, als Saddam Hussein dort 1990 einmarschiert war, und er hatte damals ein paar Minen, Granaten und Artillerieraketen eingesammelt, die die irakische Armee nach ihrem Abzug im Jahr 1991 zurückgelassen hatte. Als er dann nach Jordanien übergesiedelt war, hatte er die Waffen in seinen Wohnmöbeln versteckt.
Am 25. Februar 1994 ereignete sich für die Gruppe schließlich der passende Anlass, um in Aktion zu treten: Ein jüdischer Extremist hatte in einem islamischen Heiligtum in Hebron im Westjordanland auf betende Muslime geschossen. Er tötete 29 Männer und Jungen, und es gab zahlreiche Verletzte. Die Gruppe war von dieser Gräueltat so aufgebracht, dass sie beschloss, Maqdisis Waffen für einen koordinierten Angriff auf einen israelischen Vorposten an der Grenze zu benutzen. Maqdisi war davon nicht gerade begeistert, stimmte am Ende aber zu. Der Plan sah vor, dass sich an der Wachstation nacheinander mehrere Selbstmordattentäter in die Luft sprengten und der Rest der Gruppe die Israelis mit Handfeuerwaffen beschoss.
Die Verschwörer hatten keine Chance. Der Muchabarat mit seinem riesigen Informanten-Netzwerk erfuhr von ihrem Vorhaben und brachte es im Handumdrehen zum Scheitern. Abu Haythams Team startete eine Reihe von Razzien, die am 29. März zu der dramatischen Verhaftung von Zarqawi in dessen Bett führte. Er und zwölf weitere Mitglieder der Terrorzelle unterzeichneten schließlich Geständnisse darüber, dass sie illegale Waffen besessen und eine terroristische Aktion geplant hatten.
Maqdisi nutzte das Verfahren gegen die Gruppe, um seine radikalen Ansichten zu verbreiten. Einmal brüllte er den Militärrichter an: »Sie selbst sind schuldig!«
Die Angeklagten schrien durcheinander, als sie verurteilt wurden, während Maqdisi eine Warnung in den Saal rief: »Eure Strafen stärken nur unser Vertrauen in unseren Glauben!«
Die Möglichkeit bestand natürlich. Aber nun, wo Maqdisi und Zarqawi für 15 Jahre hinter Gitter kommen sollten, war die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, dass man von diesen Männern und ihrer Bewegung nie wieder etwas hören würde. Und wenn es den Vollzugsanstalten des Landes nicht gelingen sollte, die beiden unter Kontrolle zu halten, gab es für den Muchabarat immer noch diverse weitere Methoden, das gleiche Ergebnis zu erreichen – wie Abu Haytham nicht müde wurde, Besuchern aus dem Westen zu versichern.
»Unsere Behörde kann durchaus Druck ausüben«, pflegte er zu sagen, »wenn das die einzige Möglichkeit ist, ein Verbrechen zu verhindern.«
In Wirklichkeit war der Anführer des Muchabarat sich nicht ganz sicher, wie er mit Zarqawi umgehen sollte, als jener im Frühjahr 1999 ganz unerwartet wieder auf freiem Fuß war. Ein halbes Jahr später zerbrach man sich bei der Spionageabwehr immer noch den Kopf darüber, bis zu jenem Morgen, als Zarqawi auf einmal am Flughafen auftauchte, seine Mutter im Schlepptau und zwei Economy-Class-Flugtickets nach Pakistan im Gepäck. Während Zarqawi drei Tage lang in einer Arrestzelle schmorte, durchforstete der Muchabarat sorgfältig sein Gepäck nach Hinweisen auf seinen Zielort und die geplante Dauer seines Aufenthalts. In einem der Koffer fand man einen handgeschriebenen Brief, den man Zeile für Zeile analysierte, um irgendeine verschlüsselte Botschaft darin zu finden. Am Ende schien es sich lediglich um einen harmlosen Gruß von einem Freund Zarqawis an einen gemeinsamen Bekannten in Pakistan zu handeln.
Abu Haytham verhörte Zarqawi auch persönlich und stellte auf unterschiedliche Weise immer wieder die gleichen Fragen. Der Häftling behauptete, sobald sein Honig-Geschäft zur Unterstützung seiner Familie genug abwerfen würde, wolle er sich in Pakistan endgültig niederlassen.
»Ich kann in diesem Land nicht leben«, teilte er dem Kommandanten mit. »Ich will ein neues Leben beginnen.«
Dass sich Zarqawi nicht wohlfühlte, war wenig überraschend. Zum einen vermisste er das Gefängnis. So hart die Bedingungen in Al-Dschafr auch gewesen waren: Zarqawi hatte dort eine Identität und eine Gemeinschaft gefunden. In Freiheit war er mitunter ängstlich und orientierungslos, wie seine Angehörigen aussagten.
Den meisten Stress bereitete ihm aber der Muchabarat. Dort war man so unzufrieden über die frühzeitige Entlassung der Islamisten, dass die Leiter der Anti-Terror-Abteilung es sich zur Aufgabe gemacht hatten, Zarqawi und seine Brüder ständig zu bedrängen und nicht zur Ruhe kommen zu lassen.
In dieser Kunst hatten es Abu Haytham und seine Kollegen regelrecht zur Meisterschaft gebracht. In die Köpfe von Unruhestiftern und mutmaßlichen Terroristen einzudringen, gelang dem Muchabarat außerordentlich gut. Die seit jeher relativ kleine Behörde war, was die Überwachungstechnologie und die finanzielle Ausstattung des laufenden Betriebs anging, traditionell auf die USA und andere Verbündete angewiesen. Doch kaum ein anderer Geheimdienst konnte so gut Informanten ausbilden, Spionageaktionen durchführen und in feindliche Netzwerke eindringen. Früher hatte man regelmäßig zu grausamen Verhörmethoden gegriffen, dass so mancher Jordanier das imposante Gefängnis des Muchabarat als »Fingernagel-Fabrik« bezeichnete. Später dann wendete man feinere Methoden an, mit denen man im Endeffekt dasselbe erreichte.
Um Zarqawi auf Trab zu halten, bediente sich der Muchabarat einer Strategie, die die Mitarbeiter selbst als »Belästigung« bezeichneten: Immer wieder tauchten zwei Geheimdienstler zu den unpassendsten Zeiten am Haus der Familie Chalaila auf, manchmal mitten in der Nacht, und forderten Zarqawi auf, mit ihnen irgendwohin zu fahren. Diese Fahrten endeten unweigerlich in der Zentrale des Muchabarat, wo dann »Gespräche« geführt wurden, die mitunter mehrere Stunden dauerten. Ein wichtiger Bestandteil dieses Rituals war es, Dinge herunterzubeten, die Zarqawi gesagt oder getan hatte, nur um ihren Gast daran zu erinnern, dass die Behörde überall ihre Informanten hatte.
Natürlich gingen Zarqawi diese Besuche auf die Nerven, doch konnte er wenig dagegen tun. Als es im Spätsommer wieder einmal zu einer solchen routinemäßigen Belästigung kam, rief bereits der Anblick des schwarzen Autos der Spionageabwehr einen Wutanfall bei Zarqawi hervor, wie sich einer der Beamten später erinnerte.
»Sieh an, da ist er wieder, der Muchabarat«, rief Zarqawi so laut, dass man seinen Sarkasmus noch eine Straße weiter hören konnte. Seine Mutter, deren rundliches hochrotes Gesicht sich deutlich vom dunklen Kopftuch abhob, öffnete die Tür und empfing die Besucher mit einer Reihe von Flüchen. Sie verwünschte den Geheimdienst, die Regierung und sogar ihren eigenen Sohn, der ihr immer wieder solchen Kummer bereitete. »Ich verfluche den Tag, an dem er geboren wurde!«, rief sie.
In der Muchabarat-Zentrale wurde Zarqawi nacheinander von verschiedenen Vernehmern mit verschiedenen Methoden verhört. Abu Haytham wechselte sich manchmal mit seinem Chef ab. Ali Bursak, der Leiter der Anti-Terror-Abteilung, gehörte zu den am meisten gefürchteten Mitarbeitern der Behörde. Sein brutales Vorgehen und sein dünner rötlicher Haarkranz hatten ihm seitens der häufiger vorgeladenen Delinquenten den Spitznamen »Roter Teufel« eingebracht. Zarqawi hasste diesen Mann. Noch Jahre später, als Zarqawi Jordanien längst dauerhaft verlassen hatte, schickte er zweimal Agenten nach Amman mit der expliziten Anweisung, den Roten Teufel zu ermorden. Beide Attentate scheiterten.
Ein dritter Offizier, der ein besonderes Interesse am Fall Zarqawi an den Tag legte, war ein junger Anti-Terror-Spezialist, der annähernd das gleiche Alter wie sein Zielobjekt hatte. Abu Mutaz gehörte einer jüngeren Generation von Muchabarat-Mitarbeitern an: Er besaß einen Hochschulabschluss, reiste viel umher und hatte bei Nachrichtendiensten in Großbritannien und den USA eine spezielle Ausbildung als Analyst genossen. Zugleich entstammte er einem der Beduinenstämme der jordanischen Wüste und damit derselben Kultur wie viele der Dschihadisten und Kriminellen, mit denen er bei der Arbeit zu tun hatte. Mit seinem kurzen Haarschnitt, den schartigen Zähnen und der Lederjacke sah er beinahe aus, als gehöre er einer Straßengang an, doch seine warmen braunen Augen und sein offenherziges Lachen machten ihn sofort sympathisch. Das fanden selbst die Islamisten.
Immer, wenn Zarqawi im Hause war, griff sich Abu Mutaz einen Notizblock und eine Packung Zigaretten der Marke Parliament und machte sich auf den Weg in das spärlich eingerichtete Büro, wo die informellen Verhöre stattfanden. Dann saß Zarqawi ihm gegenüber an dem kleinen Tisch, ohne Handschellen oder Fußfesseln, mit dem üblichen Ausdruck eisiger Gleichgültigkeit im Gesicht. Abu Mutaz fand ihn immer ein wenig verwahrlost mit seinem locker sitzenden afghanischen Gewand und dem ungepflegten Bart; mit den dunklen Rändern unter den ungeschnittenen Fingernägeln erinnerte ihn Zarqawi an einen Feldarbeiter.
Abu Mutaz bot ihm gezuckerten Kräutertee und Süßigkeiten an, und meistens griff er zu. Kaffee und Zigaretten lehnte er dagegen ab. Zarqawi mochte keinen Kaffee, und als strenger Islamist sah er das Rauchen als westliches Laster an. Abu Mutaz, den das nicht weiter kümmerte, zündete sich trotzdem eine an.
»Also, Ahmad«, sagte Abu Mutaz dann (er nannte Zarqawi immer bei seinem Geburtsnamen), »erzähl mir was über eure Pläne.« Abu Mutaz wusste, wie er bei Zarqawi die richtigen Emotionen wecken konnte, damit dieser auspackte. Wenn er das Gespräch auf Religion oder Familie lenkte – hierbei vor allem auf Zarqawis Stammeswurzeln –, konnte er damit in der Regel eine Reaktion provozieren. Die Stammesidentität ist für jeden, der vom Ostufer des Jordans kommt, eine Frage von großer Bedeutung, und die Bani-Hassan-Sippe, zu der Zarqawi gehörte, war schon seit der Zeit Mohammeds einer der größten und einflussreichsten Stämme der ganzen Region. Die Stammeszugehörigkeit eines Menschen definierte seine Stellung in der Gesellschaft. Patriotismus, Kindespflicht, Familienstolz – all das spielte mit hinein. Wie zufällig erwähnte Abu Mutaz hin und wieder, dass er mit den Stammesältesten über Zarqawi gesprochen habe und dass sie sich Sorgen um ihn machten. In einem solchen Moment verschwand der Trotz kurzzeitig aus Zarqawis Augen. Dennoch schwieg er.
»Was du getan hast«, sagte Abu Mutaz dann, »könnte deinen Stamm zerstören. Es könnte das ganze Land zerstören.«
Nur wenn der Offizier das Thema Religion zur Sprache brachte, wurde Zarqawi lebhaft. Allzu gern prahlte er mit seinen Kenntnissen von dem Koran und dem Hadith – der Sammlung apokrypher Sprüche von Mohammed und seinen Gefährten, aus denen sich die Dschihadisten zur Rechtfertigung ihrer religiösen Ansichten ausgiebig bedienten. Abu Mutaz, der es gewohnt war, der Argumentation von Islamisten zuzuhören, fragte Zarqawi nach seiner Meinung zum Thema Gewalt. Verbat der Islam nicht die Tötung unschuldigen Lebens?
»Abtrünnige sind nicht unschuldig«, lautete dann Zarqawis Antwort. »Es ist nicht nur halal« – erlaubt, wie Zarqawi monoton sagte – »sie zu töten, Gott gebietet uns, die kafir umzubringen.« Irgendwann kam dann immer der Punkt, an dem Zarqawi keine Lust mehr zu reden hatte und wieder dichtmachte.
»Sie mochten mich nicht, als ich ein Krimineller war«, grummelte er einmal in Richtung Abu Mutaz, »jetzt bin ich religiös, und Sie mögen mich immer noch nicht.«
So verstörend seine Worte im Nachhinein anmuten, Zarqawi benutzte lediglich die Standard-Rhetorik der Dschihadisten. Die älteren Mitarbeiter des Muchabarat hielten seinen Partner Maqdisi, den Vordenker und Missionar, für viel gefährlicher als Zarqawi. Weil sie immer wieder neue Gründe fanden, diesen einzusperren, verbrachte Maqdisi den Großteil der folgenden 15 Jahre hinter Gittern. Zarqawi spielte eindeutig nicht in dessen Liga. Aber wie genau sollte man ihn dann einstufen?
Für die Experten im Geheimdienst war Zarqawi ein Mysterium. Er redete zwar wie ein religiöser Radikaler, doch die intensiven Überwachungsaktionen zeigten, dass sein Auftreten voller Widersprüche war und er immer wieder in alte Verhaltensweisen aus der Zeit vor seiner Islamlistenkarriere zurückfiel. Regelmäßig verschwand er in Zarqa für mehrere Stunden im Haus einer Frau, die nicht seine Ehefrau war; anschließend ging er direkt zu einer islamistischen Versammlung oder besuchte das Abendgebet in der örtlichen Moschee. Abu Mutaz fiel auf, dass Zarqawi ständig log, auch bei ganz trivialen Dingen. Selbst wenn man ihm konkrete Beweise für das Gegenteil präsentierte, beharrte er auf seiner Aussage. Sein Verhalten war derart undurchsichtig, dass der Muchabarat mehrere Psychiater anheuerte, um seine Akten zu prüfen und seinen Geisteszustand zu beurteilen. Auch wenn ihre Ergebnisse nicht übereinstimmten, wies einiges darauf hin, dass Zarqawi an einer Persönlichkeitsstörung litt: Eine, bei der das Subjekt unter einer tiefen Verunsicherung und schwerwiegenden Schuldgefühlen leidet, die sich in einem ständigen Wettstreit mit einem übergroßen Ego befinden.
»Er hatte einen Helden- und einen Schuldkomplex«, so Abu Mutaz. »Er wollte unbedingt ein Held sein, und er hielt sich auch tatsächlich für einen Held, bereits damals, als er noch ein Kleinkrimineller war. Aber es waren die Schuldgefühle, die ihn in den Extremismus trieben.«
Auch manchen seiner islamistischen Freunde fiel sein zunehmend erratisches Verhalten auf. Einer von ihnen erinnerte sich später daran, wie Zarqawi in seinem afghanischen Gewand manchmal stundenlang in einem beliebten Falafel-Shop in Zarqa hockte, ohne mit irgendjemandem zu reden. »So, wie er da saß, kam er mir vor wie ein Sufi, ein Mystiker. Ganz ruhig und fromm sah er aus. Und ein wenig traurig.« In anderen Momenten wirkte er wiederum fast manisch, plapperte ununterbrochen darüber, seine alte Islamistenzelle wiederbeleben zu wollen, entweder in Jordanien oder im Ausland.
»Er besuchte mich zu Hause und bat mich, mit ihm ein neues Kapitel aufzuschlagen, zusammenzuarbeiten und vielleicht nach Afghanistan zu reisen«, erinnerte sich al-Muntasir, der Islamist aus Amman, der 1994 zusammen mit Zarqawi verhaftet und eingesperrt worden war: »Ich begrüßte ihn als Gast, aber ich weigerte mich, in irgendeiner Hinsicht wieder mit ihm zu kooperieren, alleine schon wegen seines Narzissmus. Von seinen anderen schlechten Eigenschaften ganz zu schweigen.«
Solche Unterhaltungen stellten indes noch keinen Straftatbestand dar, das musste auch Abu Haytham zugeben. Als er Zarqawi am dritten Tag seines unfreiwilligen Aufenthalts beim Muchabarat nach der Szene am Flughafen noch einmal befragte (es sollte das allerletzte Mal sein), da begann sich jener mit einem Mal erbittert darüber zu beschweren, dass man ihn einfach so festhielt.
»Wenn Sie etwas gegen mich in der Hand haben, dann stellen Sie mich doch vor Gericht!«, rief er. »Wenn ich etwas gegen Sie vorzubringen hätte, würde ich Sie auch vor Gericht bringen!«
Abu Haytham nickte. Es war ein ganz ungewohnter Moment gegenseitiger Offenheit. Der Kommandant erklärte Zarqawi noch einmal, wie wichtig es war, Männer wie ihn an einer besonders kurzen Leine zu halten. »Es ist nichts Persönliches«, sagte er. »Sie müssen verstehen, wie wir Sie wahrnehmen. Für uns sind Sie ein Extremist.«
»Und Sie müssen verstehen, wie ich Sie wahrnehme«, erwiderte Zarqawi. »Für mich seid ihr alle Ungläubige.«
Am nächsten Tag standen Zarqawi und seine Mutter wieder im Flughafen und warteten auf ihren Flug nach Pakistan. Dieses Mal behelligte sie niemand. Aber der Muchabarat blieb wachsam.