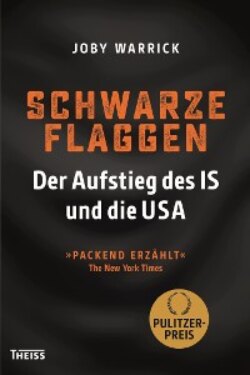Читать книгу Schwarze Flaggen - Joby Warrick - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
»Er war der geborene Anführer«
ОглавлениеZwei Wochen vor König Husseins Tod – vor seinen Abschiedsworten auf dem Sterbebett und vor den Beileidsbekundungen von unzähligen Trauernden und Staatenlenkern aus aller Welt, die Jordaniens bekanntestem und am längsten regierenden Staatschef Tribut zollten – rief der Monarch seinen ältesten Sohn Abdullah zu sich in den Palast und teilte ihm eine Entscheidung mit, die das Leben des jungen Mannes von Grund auf verändern und das Schicksal des ganzen Landes in eine neue Richtung lenken sollte.
Der König litt unter Lymphdrüsenkrebs und hatte gerade sechs Monate in einer Klinik in den USA verbracht. Doch der Krebs war wieder ausgebrochen, und die Ärzte sagten ihm, dass er nicht mehr viel Zeit hätte. Am 22. Januar 1999 rief er Abdullah an, der damals 36 Jahre alt war und als Kommandeur auf dem Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn stand.
»Ich muss dich sehen«, sagte Hussein am Telefon, »umgehend.«
Abdullah bin Hussein stieg sofort ins Auto und fuhr die steile Straße hinauf zum Palast in Hummar. Von hier oben aus hatte man einen atemberaubenden Blick auf die Hauptstadt. Er fand den König im Speisesaal und erschrak über das gebrechliche Aussehen seines Vaters. Der 63-Jährige war bis auf die Knochen abgemagert, seine Haut hatte sich von der Gelbsucht verfärbt. Das graue Haar und der Bart, wodurch er früher ein wenig das Aussehen von Sean Connery hatte, waren infolge der Chemotherapie verschwunden.
Der König schickte seine Diener fort und schloss die Tür. Dann wandte er sich an Abdullah. Blasse Finger ergriffen die Hände des Sohnes. »Ich möchte dich zum Kronprinzen machen«, sagte er.
Die Worte waren unmissverständlich. Seit mehr als drei Jahrzehnten stand dieser Titel Prinz Hassan zu, dem weltlich orientierten und verdienstvollen jüngeren Bruder des Königs. Er war zum Thronfolger ernannt worden, als Abdullah noch nicht einmal zur Schule ging. Der sportliche und jugendlich wirkende älteste Sohn des Königs hatte die letzten Jahre damit zugebracht, Panzer zu fahren, Hubschrauber zu fliegen und aus Flugzeugen zu springen. Er zeigte wenig Interesse an Politik, und auch mit den Intrigen am Königshof konnte er kaum etwas anfangen – er bevorzugte lieber das Militär mit seinen klaren Befehlshierarchien. Nun wollte sein Vater ausgerechnet ihm eine Aufgabe aufs Auge drücken, die viele kaum absehbare Gefahren barg und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu führen würde, dass Abdullah sich mit nahen Verwandten überwarf, die seit Jahren darauf warteten, endlich das Land regieren zu dürfen.
»Was ist mit meinem Onkel?«, fragte er seinen Vater schließlich, wie er sich später erinnerte.
Aber die Entscheidung des Königs stand fest. Nur wenige Tage später machte er seinen Entschluss der Öffentlichkeit bekannt, in Form eines offenen Briefes an Hassan. In diesem Brief degradierte der König seinen Bruder offiziell und deutete an, wie enttäuscht er von den raffgierigen »Emporkömmlingen« innerhalb der Königsfamilie sei, die sich »einmischten« und es »an Loyalität fehlen« ließen. Nach seinem Tod, so der König, würde die Krone vom Vater auf den Sohn übergehen – in diesem Fall somit an denjenigen, der sich unter allen Brüdern, Neffen und den 11 Kindern des Monarchen dadurch hervorhob, dass er als Einziger gar nicht König werden wollte.
Eigentlich hätte Abdullah ohnehin Kronprinz sein müssen. Laut der jordanischen Verfassung und der jahrhundertealten Tradition der Haschemitendynastie fiel der Thron automatisch dem ältesten Sohn des Königs zu. Aber in den turbulenten 1960er-Jahren, als überall Krieg herrschte und der Monarch ständig damit rechnen musste, durch ein Attentat getötet oder durch eine Palastrevolution gestürzt zu werden, machte Hussein seinen Bruder zum Thronfolger – im Fall seines Todes brauchte das Land klare Verhältnisse.
Da Abdullah nun kein Thronanwärter mehr war, konnte er einen Großteil seiner Zeit als junger Erwachsener außerhalb Jordaniens verbringen. Er besuchte amerikanische und britische Hochschulen, wo er eine Menge weltliche Bildung genoss; was er dort aber nicht fand, waren tiefere Einblicke in die inneren Abläufe in seiner Heimat. Als er wieder zu Hause war, befasste er sich dafür eingehend mit der Kultur der jordanischen Unter- und Mittelschicht: Als Berufssoldat wohnte er anfangs in denselben armseligen Baracken und aß dieselben, mit Wüstenstaub bedeckten Feldrationen wie die übrigen Unteroffiziere. Er stieg bis zum Generalmajor auf, legte jedoch nie seine jugendliche Leidenschaft für schnelle Autos und Motorräder ab. Bei seiner Arbeit waren die schönsten Momente für ihn diejenigen, in denen er seine Sondereinsatzkräfte persönlich anführen konnte, um gegen Terroristen und andere Kriminelle vorzugehen, wie noch im Jahr zuvor, als seine Truppen den Unterschlupf von Gangstern gestürmt hatten – der Straßenkampf war live und in Farbe vom jordanischen Fernsehen übertragen worden.
Nun jedoch saß der junge Kommandant im Speisesaal des Palastes von Hummar und war von der Situation erst einmal völlig überwältigt. Ein einziger Satz seines Vaters hatte ausgereicht, um Abdullahs Welt komplett auf den Kopf zu stellen. Das privilegierte Leben, das er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern bisher so bequem geführt hatte, war dahin.
Obendrein hatte der König zum ersten Mal zugegeben, was er bis dahin nie laut gesagt hatte: Er würde bald sterben.
»Der Magen zog sich mir zusammen«, erinnerte Abdullah sich später. »Ich glaube, in jenem Moment habe ich mich zum ersten Mal völlig allein gefühlt.« Er verließ den Palast und fuhr sofort nach Hause. Dort fand er seine Frau Rania auf dem Fußboden des Wohnzimmers, um sich herum hatte sie zahlreiche Familienfotos ausgebreitet. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als er ihr die Neuigkeiten verkündete, und langsam wurde beiden klar, was da eigentlich gerade geschehen war. »Bald würden wir in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses katapultiert werden, und das auf eine Weise, wie wir es uns niemals hätten vorstellen können«, schrieb er später in seinen Memoiren. »Und da draußen gab es jede Menge Wölfe, die nur darauf warteten, dass wir stolpern würden.«
Bald hatte er jedoch keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. König Hussein beschloss, sich noch einmal einer Krebstherapie zu unterziehen und ließ sich zwecks einer weiteren Knochenmarktransplantation in die USA fliegen. So lange er sich nicht in Jordanien befand, musste Abdullah die Rolle des Regenten übernehmen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Trotz seiner geringen Erfahrung sah er sich sofort zahlreichen innen- und außenpolitischen Herausforderungen ausgesetzt. Er konnte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, doch zu all den dringenden Staatsgeschäften sollten bald noch die Vorbereitungen für ein Staatsbegräbnis und seine formale Krönung zum König hinzukommen.
Am 29. Januar fuhr Abdullah seinen Vater zum Flughafen, wo die Reise zur Mayo Clinic in Minnesota begann. Der König saß auf dem Beifahrersitz und sah still aus dem Fenster, während sich der Wagen durch die Straßen von Ammans wohlhabendem Westviertel mit seinen Hotelhochhäusern und Bürotürmen kämpfte. Dann wechselten sie auf die Schnellstraße zum Flughafen. Sie fuhren an den ärmeren Vororten vorbei und an Dörfern mit Märkten und kleinen, neonbeleuchteten Moscheen. Weiter ging es durchs offene Land, vorbei an schroffen Hügeln und mit Steinen übersäten Feldern. Schafe und Beduinenzelte wurden hier immer mehr von Satellitenschüsseln und Kleinlastwagen verdrängt. Abdullah legte seine Hand auf die seines Vaters. Dort ließ er sie, während sie schweigend weiterfuhren.
Der Abschied verlief reibungslos, bis sie das Flugzeug erreichten. Obwohl Abdullah versprochen hatte, ruhig und gelassen zu bleiben, verlor er für einen kurzen Moment die Fassung – er war überzeugt davon, dass er seinen Vater nie wiedersehen würde. Doch er hielt seine Tränen zurück und half seinem Vater ins Flugzeug. Dann standen beide einen Moment im Gang, um einander Lebewohl zu sagen. Der König sah seinem Sohn in die Augen, und offenbar hatte auch er mit seinen Gefühlen zu kämpfen, wie Abdullah sich später erinnerte. Statt einer Umarmung oder ein paar letzten Abschiedsworten nickte sein Vater nur. Dann wandte er sich um und ging allein den Gang hinunter. Wenige Minuten später befand sich der Kronprinz bereits auf dem Rückweg in den Palast in Amman, wo zahlreiche Pflichten auf ihn warteten.
Als Abdullah seinem Vater das nächste Mal wieder begegnete, war dieser schon nicht mehr bei Bewusstsein. König Hussein kehrte in das Land zurück, das er fast ein halbes Jahrhundert lang regiert hatte. Doch diesmal waren keine Kameras vor Ort, als man den Sterbenden vom Flugzeug aus in einen bereitstehenden Krankenwagen verfrachtete und nach Amman in das nach dem König benannten Gesundheitszentrum fuhr, wo Tausende Jordanier im kalten Regen Wache standen und sich weigerten heimzugehen – bis am 7. Februar 1999 kurz vor Mittag die Fernsehschirme im ganzen Land plötzlich dunkel wurden.
Abdullah saß während der letzten Stunden seines Vaters am Krankenbett. Er fühlte sich unendlich einsam, weil er seinen Vater weder trösten, noch ein letztes Mal um seinen Rat fragen konnte, wie man dieses Land denn bloß regieren solle – ein Land, das sich ständig in der Krise zu befinden schien und das genauso viele Feinde im Inland hatte wie im Ausland.
Seit der Gründung des Landes hatte Jordanien kein Ereignis erlebt, das mit solchem Aufwand begangen wurde wie die Beerdigung von König Hussein bin Talal. Noch nie hatten sich so viele Jordanier an einem Ort versammelt – schätzungsweise 800.000 Menschen (rund ein Viertel der Bevölkerung) verstopften die Gehwege und drängten sich in den Fenstern und auf den Dächern der Häuser entlang der Straße, die der in die Staatsflagge eingehüllte Sarg passieren würde. Stundenlang harrten sie in der feuchten Kälte aus, um den einzigen Herrscher zu ehren, den die meisten von ihnen jemals erlebt hatten: den lächelnden Monarchen mit der Hand zum Volkstümlichen, der das Land durch Kriege sowie innenpolitische Unruhen und am Ende dann, in seinen späten Jahren, auf einen historischen Pfad in Richtung Frieden geleitet hatte. Männer wie Frauen weinten hemmungslos, manche klagten und geißelten sich nach alter arabischer Tradition. Andere liefen neben dem Leichenzug her, und manch einer stürzte sich im Rausch der Trauer sogar vor die Wagenkolonne.
Ähnlich beeindruckend war die Ansammlung internationaler Würdenträger, die im Ragadan-Palast von Amman zusammenströmte. Keine 24 Stunden nach dem Tod des Königs hatten die Premiers und Potentaten von 75 Ländern den Kalksteinbogen am Eingang des Palastes durchschritten, was die Kommentatoren dazu veranlasste, das Ereignis als »wichtigste Beerdigung des 20. Jahrhunderts« zu feiern. Allein schon vier US-Präsidenten gehörten zu den Besuchern, darunter der damalige Bewohner des Weißen Hauses, Bill Clinton, der kurz innegehalten hatte, bevor er die Air Force One bestieg, um Hussein als »großartigen Mann« zu loben, der »nicht nur seinem Titel, sondern auch seinem Charakter nach« ein erhabener Mann gewesen sei. Prinz Charles und der britische Premierminister Tony Blair waren ebenso nach Amman gereist wie auch UN-Generalsekretär Kofi Annan und die Staatschefs von Japan, Frankreich, Deutschland und den anderen europäischen Großmächten. Auch der russische Präsident Boris Jelzin war da, blass und desorientiert und von zahlreichen Sicherheitsleuten begleitet, verabschiedete sich aber nach wenigen Minuten bereits wieder, weil er sich nicht wohlfühlte.
Die Gäste aus dem Nahen Osten zogen jedoch die meisten Blicke auf sich. Ein echter Überraschungsgast war darunter: der syrische Präsident Hafiz al-Assad, der jahrelang mit Hussein verfeindet gewesen war. Immer wieder hatte er seinen Nachbarn über die gemeinsame Grenze hinweg angegriffen und versucht, Husseins Regierung zu untergraben. Nun mischte sich der alternde Autokrat unter die anderen Emire und Diktatoren, die alle zu verschiedenen Zeiten gegen Jordanien, gegen die Syrer oder gegeneinander gekämpft hatten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die traditionelle hebräische Gebetskappe auf den ergrauten Locken, stand in einer Ecke der überwölbten Eingangshalle, umgeben von seinem Gefolge, dem Generäle, Leibwächter und ein bärtiger Rabbi angehörten. Jassir Arafat, der Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, seine 1,57 m in einen überdimensionalen Militärmantel gehüllt, unterhielt sich mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Husni Mubarak. Der womöglich ängstlichste Mann im ganzen Raum war Chaled Maschal, der Anführer der Hamas, der militanten Fraktion der Palästinenser, der bereits wiederholt das Ziel israelischer Mordanschläge gewesen war. Zwei Jahre zuvor hatten Angehörige des israelischen Mossad in Amman einen Giftanschlag auf Maschal verübt – wenige Kilometer von dort entfernt, wo er jetzt stand. Er überlebte nur, weil der erzürnte König Hussein die Israelis unter Druck gesetzt hatte, bis sie seinen Ärzten das Gegengift aushändigten.
Begrüßt wurden die hohen Gäste von einem Mann, der sich in seinem schwarzen Anzug und seiner rotkarierten Kufiya offenbar nicht sehr wohlfühlte und den man ab sofort als König Abdullah II. anzureden hatte. Der neue Monarch stand am Sarg in einer Reihe mit seinen Geschwistern und Onkeln, um sich von den angereisten Präsidenten und Ministern kondolieren zu lassen. Kaum einen von ihnen kannte er persönlich. Offiziell war er noch gar nicht König, da die formelle Vereidigung vor dem Parlament erst später an jenem Tag stattfinden sollte. Dennoch hatte er bereits wenige Augenblicke nach Husseins Tod einen Auftritt im jordanischen Fernsehen, um dem Volk die traurige Nachricht zu verkünden; als er vor der Kamera stand und vom Skript in seiner Hand ablas, hinter sich das Konterfei seines Vaters, da hatten die meisten Jordanier zum ersten Mal die Stimme ihres neuen Königs gehört.
»Das waren das Urteil und der Wille Gottes«, hatte er gesagt.
Jetzt schritt er an der Spitze der Trauernden hinter dem Sarg seines Vaters zur königlichen Grabstätte, flankiert von seinem Onkel und seinen Brüdern, hinter ihm der Lieblingshengst des verstorbenen Königs, ein Schimmel namens Amr, dessen Sattel nun leer war. An der Grabstelle, die sich neben den Gedenksteinen der ersten beiden Könige Jordaniens befand, wurde Husseins Leichnam aus dem Sarg genommen und in den Boden abgesenkt, lediglich von einem schmucklosen weißen Schleier bedeckt.
Die letzte Amtshandlung jenes Tages war die Vereidigung des neuen Königs vor den beiden Kammern des Parlaments. Nachdem Abdullah seinen Amtseid abgelegt hatte, stellte der Senatsvorsitzende der Nation ihren neuen Souverän vor mit den Worten: »Möge Gott Seine Majestät, König Abdullah, schützen und ihm großen Erfolg gewähren.«
Jetzt war es offiziell, und doch hatte die ganze Situation etwas Irreales. Als der neue König die Zeremonie verließ, erschrak er fast, als einer seiner Berater ihm zurief: »Majestät, hier entlang!«
»Aus reiner Gewohnheit sah ich mich nach meinem Vater um«, erinnerte er sich später.
Doch ab sofort trug der Sohn diesen Titel und regierte das Land – ein Land, dessen Wirtschaft schwächelte, das politisch und religiös zerstritten war und unter regionalen Konflikten litt.
Zugleich hatte er ganze Legionen von Feinden geerbt. Einige von ihnen lebten in seiner unmittelbaren Umgebung und wollten seinen Posten. Andere waren ausländische Potentaten, denen ein unabhängiges Jordanien nicht in ihre Pläne für die Region passte. Wiederum andere waren religiöse Extremisten, die ein säkulares Jordanien, das sich am Westen orientierte, generell ablehnten. In den ersten Monaten des Jahres 1999, als sich der haschemitische Thronerbe zögerlich an sein neues Amt gewöhnte, beobachteten sie ihn alle argwöhnisch und lauerten begierig auf seinen ersten Fehltritt.
Jeder, der im Nahen Osten ein Land regiert, kann sich von dem Gedanken verabschieden, an Altersschwäche zu sterben. Das gilt vor allem für Jordanien, wo das außerordentliche Gefahrenpotenzial dieser Aufgabe offenbar einen besonders großen Appetit auf gefährliche Hobbys hervorruft.
Hussein überlebte im Laufe seines Lebens mindestens 18 Attentate. Er war gerade einmal 15 Jahre alt, als sein Großvater, Jordaniens erster König Abdullah I., an einem Sommertag des Jahres 1951 von einem Palästinenser erschossen wurde, als die beiden die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem besuchten. Der junge Prinz verfolgte den Attentäter und wurde dabei selbst zur Zielscheibe, als dieser sich umdrehte und auf ihn feuerte. Glücklicherweise prallte die Kugel an einer Medaille an der Uniform des Jungen ab (so zumindest meldete es der Palast). Auch später versuchten Husseins Feinde immer wieder, ihn umzubringen: mit Angriffen aus dem Hinterhalt, Flugzeugabstürzen und sogar vergifteten Nasentropfen. Letztere entdeckte Hussein allein deshalb, weil er versehentlich das Fläschchen umgestoßen hatte; daraufhin hatte er entsetzt dabei zugesehen, wie sich die schäumende Flüssigkeit durch die verchromten Badezimmerarmaturen fraß. Der König entkam dem Tod so oft, dass es beinahe schien, als umgebe ihn eine Aura der Unverwundbarkeit. Viele Jordanier sagten, Hussein besitze baraka – die besondere Gunst Allahs. Dass einer der Söhne ebenso gesegnet sein würde wie der Vater, schien eher unwahrscheinlich.
Hussein ließ sich von den Anschlägen nicht einschüchtern. Wenn überhaupt, so beflügelten sie ihn darin, auch in der Freizeit das Risiko zu suchen: Begeistert fuhr er schnelle Sportwagen, flog Hubschrauber und Kampfjets. Einmal nahm er den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger und dessen Frau mit auf einen (buchstäblich) atemberaubenden Ausflug, um ihnen sein Land zu zeigen: Am Steuerknüppel eines Hubschraubers jagte der König mit seinen Gästen über die Hügel Jordaniens und flog dabei so niedrig, dass sie die Palmen unter sich streiften. Wie Kissinger sich später erinnerte, versuchte seine Frau den König höflich darum zu bitten, in einer etwas sichereren Höhe zu fliegen.
»Ich wusste gar nicht, dass Hubschrauber so niedrig fliegen können«, meinte sie.
»Oh! Die können noch viel niedriger fliegen!«, antwortete der König. Daraufhin sank er noch tiefer und schrammte mit den Kufen über den Erdboden.
»Da bin ich binnen Minuten um mehrere Jahre gealtert«, so Kissinger.
Als er sich für Abdullah als seinen Nachfolger entschied, wählte Hussein jemanden, der ihm – zumindest in dieser Hinsicht – stark ähnelte. Im Gegensatz zum vergeistigten und stets übervorsichtigen Prinz Hassan, dem Bruder des Königs, teilte Abdullah das oft betont informelle Auftreten seines Vaters sowie dessen Hang zu Aktivitäten, die das Adrenalin in Schwung brachten. Als er noch ein Kind war, quietschte Abdullah jedes Mal vor Vergnügen, wenn ihn sein Vater im Roadster mitnahm und auf seinem Schoß sitzen ließ, während sie eine Spritztour durch die Wüste machten – hinter ihnen riesige Staubwolken, vor ihnen die leere Schnellstraße und aus dem Autoradio der Titelsong der Zeichentrickserie »Popeye«. Er wurde zum Adrenalinjunkie, der von Motorrädern, Rennwagen, Flugzeugen und vom Fallschirmspringen nicht genug kriegen konnte.
Auf dem Internat in den USA tat sich Abdullah als Ringer und Leichtathlet hervor wie auch als Spaßvogel, der anderen gerne Streiche spielte. Auf der renommierten britischen Kadettenanstalt Sandhurst lehnte er den prestigereichen Posten des Infanterieoffiziers ab und entschied sich stattdessen für das Panzerfahren. Besonders mochte er den flinken, gepanzerten Fox, mit 30-Millimeter-Geschütz und Rädern statt Ketten. Einmal führte er eine ganze Fox-Kolonne an, die westlich von London neben der M4-Autobahn entlangfuhr und aus den kantigen Fahrzeugen das letzte Quäntchen an Leistung herauspressten, bis sie schneller waren als der zivile Verkehr ein paar Meter weiter. Nach ein paar Minuten Vollgas bemerkte er, wie ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht neben ihnen fuhr.
Der Polizeibeamte signalisierte ihm, die Kolonne anzuhalten. Dann näherte er sich kopfschüttelnd Abdullah im Leitfahrzeug. »Ich habe keine Ahnung, wie ich Ihnen hierfür ein Strafmandat geben soll«, gab der Polizist zu. Am Ende kamen die Kadetten mit einer Verwarnung davon.
Der Ruf des Prinzen als Gefahrensucher hätte beinahe sein Werben um die stilvolle und hübsche Rania al-Yasin beendet, noch bevor dieses offiziell begonnen hatte. Die zukünftige Königin war damals 22 Jahre alt und arbeitete in der Marketingabteilung von Apple, als die beiden einander bei einer Abendveranstaltung kennenlernten. Abdullah war sofort hingerissen von ihr, doch Rania gab ihm zunächst einen Korb. Abdullah war damals 30 Jahre alt und kommandierte ein Panzerbataillon. Seine Haut war von der Sonne gegerbt, und er führte einen eher zweifelhaften Ruf. Rania kam aus der palästinensischen Mittelschicht und hatte wenig Interesse daran, die neueste Eroberung des Prinzen zu sein, wie Abdullah Jahre später in seinen Memoiren schrieb.
»Ich habe einiges über dich gehört«, sagte Rania damals zu ihm.
»Ein Engel bin ich nicht«, gab Abdullah zu, »aber mindestens die Hälfte von dem, was du über mich gehört hast, ist nichts als Gerede.«
Schließlich kam es doch noch zu einem Rendezvous. Sechs Monate später nahm er allen Mut zusammen und fuhr mit Rania zu einem seiner Lieblingsorte in Jordanien. Dort, auf dem Gipfel eines Hügels, der ihm und seinem Vater öfter als Kulisse für waghalsige Autorennen gedient hatte, stellte Abdullah ihr die Frage aller Fragen. »Ich hatte gehofft, dass das Ganze etwas romantischer wird«, gab er später zu. Aber diesmal wurde er von Rania nicht abgewiesen. Am 10. Juni 1993 heirateten sie, gerade einmal zehn Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten.
Erstaunlicherweise war schon wenige Wochen, nachdem aus ihm König Abdullah II. geworden war, vom einst schnoddrigen Bataillonskommandanten und Adrenalinjunkie nichts mehr übrig. Der Mann, der sich aus Hunderten Flugzeugen gestürzt hatte, setzte nun alles daran, Risiken für sein Leib und Leben zu vermeiden. Er versuchte, die früheren Streitigkeiten mit anderen Angehörigen der Königsfamilie beizulegen. Seinem jüngeren Bruder Haschem, dem Sohn Husseins mit dessen äußerst beliebten vierten Frau, der in Amerika geborenen Königin Noor, bot er die Position des Kronprinzen an. Dafür entließ oder degradierte er mehrere Spitzenbeamte der Sicherheitsdienste, von denen er glaubte, dass sie allzu enge Beziehungen zu seinem Onkel, seiner Stiefmutter oder anderen Verwandten führten. Dann veranlasste er, dass seine eigene, betont nicht-adlige Frau Königin wurde. Daraufhin verließ Königin Noor Jordanien und kehrte nie wieder zurück.
Weitere Gefahren lauerten jenseits der Landesgrenzen. Schnell ging der neue König in die diplomatische Offensive: Er reiste nach Saudi-Arabien und in die anderen Emirate am Golf, um die beinahe zehn Jahre währenden Differenzen zur Neutralität Jordaniens im Ersten Irakkrieg zu beseitigen. Er lud Israels notorisch angriffslustigen Ministerpräsidenten Netanjahu zu einem gegenseitigen Kennenlernen beim Mittagessen nach Amman ein. Er versuchte sogar, die Beziehungen seines Landes zu Syrien zu verbessern, indem er zunächst mit Präsident Hafiz al-Assad Kontakt aufnahm und sich dann, nach dem Tod des Autokraten, mit dessen Sohn Baschar al-Assad anfreundete. Assad Junior war ebenfalls Anfang 30 und im Westen ausgebildet, und wie Abdullah war auch er als Nachfolger seines Vaters eine recht überraschende Wahl gewesen.
Dann endlich war die Zeit gekommen, mit den Islamisten Frieden zu schließen. Zumindest mit einigen von ihnen.
Schon lange hatten die jordanischen Könige versucht, im Land für Stabilität zu sorgen, indem sie wackelige Bündnisse mit den religiösen Fundamentalisten schmiedeten, ihnen eine Stimme im Parlament zubilligten. Darüber hinaus waren sie mit Reformen insgesamt eher vorsichtig, um zu vermeiden, in der nach wie vor äußerst konservativen Stammesgesellschaft für zu viel Unruhe zu sorgen. König Hussein hatte sich in den 1960er- und 1970er-Jahren auf die muslimischen Imame gestützt, die ihm halfen, akute Bedrohungen durch Marxisten und panarabische Nationalisten abzuwehren. Viele dieser Kleriker waren erzürnt, als Hussein 1994 mit Israel Frieden schloss; dennoch gelang es dem König, mit der prominentesten islamistischen Gruppe des Landes, der Muslimbruderschaft, geradezu herzliche Beziehungen zu pflegen. Wiederholt lobte er die Muslimbrüder als »Rückgrat des Landes«.
Der neue König suchte einen ganz ähnlichen Ansatz. Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt lud Abdullah die Führungsriege der Muslimbruderschaft zu einem informellen Treffen in seiner Residenz ein. Als die Geistlichen mit ihren flatternden Roben und wallenden Bärten im Palast eintrafen, überreichten sie dem Monarchen eine Liste von Beschwerden darüber, welche prominenten muslimischen Aktivisten ihrer Meinung nach schlecht behandelt wurden. Sie ereiferten sich über die angebliche Pressezensur und die obskuren Wahlgesetze des Landes, die, wie sie sagten, dafür sorgten, dass ihre politischen Kandidaten keine Sitze im Parlament gewinnen konnten. Abdullah hörte seinen Besuchern höflich zu, und als sich die Wogen langsam glätteten, wartete er mit einem unerwarteten Geschenk auf: Die Regierung würde umgehend 16 Aktivisten der Muslimbruderschaft auf freien Fuß setzen, die nach Straßenprotesten inhaftiert worden waren. Wie Journalisten hinterher erzählten, zeigten sich die Besucher begeistert, im neuen König einen Sympathisanten der Islamisten gefunden zu haben.
»Eure Majestät, wir sind bei Euch«, teilte der Anführer der Muslimbrüder Abdullah mit, »als ein Team, eine Körperschaft, die auf Euch vertraut.«
Wäre es doch nur so einfach gewesen. Trotz der gelegentlichen rhetorischen Seitenhiebe gegen die Monarchie gehörte die Muslimbruderschaft durchaus zum jordanischen Establishment. Andere Islamisten ließen sich nicht so einfach durch die Freilassung einer Handvoll Gefangener oder durch vage Versprechungen, das Wahlsystem zu ändern, beschwichtigen. Die Muslime wollten ein Mitspracherecht daran, wie das Land regiert wurde, auch wenn sie dabei unterschiedliche Ziele verfolgten. Abdullah war bereit, bis zu einem gewissen Punkt einzulenken. Der junge König hatte bereits in Interviews geäußert, aus Jordanien eine echte konstitutionelle Monarchie machen zu wollen, mit einem König als nominellem Staatsoberhaupt, aber regiert von einem Ministerpräsidenten, den die Volksvertreter im Parlament wählten. Abdullahs Berater indes bestanden darauf, die Reformen langsam und behutsam anzugehen. In einem Land mit wenig demokratischer Tradition, so argumentierten sie, konnten allzu rasche und umfassende Veränderungen schnell nach hinten losgehen. Die Islamisten hatten bereits eine große Zahl von Anhängern, zudem waren sie organisiert, motiviert und finanziell gut ausgestattet. Sie konnten im Handumdrehen eine Parlamentswahl gewinnen, durch welche die Zukunft des Landes in die Hände von Männern fiele, von denen zumindest einige eine radikal andere Vision für Jordanien hatten als die Muslimbrüder.
Die Männer mit den Turbanen, die mit Abdullah am Tisch saßen, ließen immerhin mit sich reden. In Jordanien und anderswo in der Region gab es aber durchaus auch Leute, die vernünftigen Argumenten (im westlichen Sinne) nicht zugänglich waren. Diese konnten nur bekämpft werden.
Bereits zu der Zeit, als die Monarchie eingerichtet wurde, musste sich Jordanien mit islamischen Extremisten auseinandersetzen, und die Nation hatte die damaligen Kämpfe noch immer nicht ganz überwunden. Für einige Islamisten war bereits die Existenz dieses Staates ein Gräuel, den die Kolonialmächte geschaffen hatten, um die Muslime zu spalten und schwach zu halten. Die jordanische Königsfamilie, die Haschemiten – die immerhin 900 Jahre lang über die heilige Stadt Mekka herrschten –, hatte eine zentrale Rolle bei diesem Verrat gespielt.
Tatsächlich gab es bis Anfang des 20. Jahrhunderts kein Land mit dem Namen Jordanien, und es gab auch keine Volksgruppe, die »Jordanier« geheißen hätten. 1000 Jahre lang hatte der wasserarme Landstrich östlich des Jordans einfach nur zum islamischen Kalifat gehört, das die gesamte Arabische Halbinsel und die Levante umfasste und sich mitunter bis in den Balkan und nach Nordafrika erstreckte. Die ersten Kalifen, die als Nachfolger des Propheten Mohammed galten, hatten ihren Regierungssitz in Damaskus und in Bagdad. Sie wurden später von den Osmanen verdrängt, die das Islamische Reich noch einmal erweiterten und ein osmanisches Kalifat einrichteten, an dessen Spitze ein mächtiger Sultan stand, der in Istanbul residierte. Immerhin ließen die türkischen Eroberer in Mekka eine begrenzte Selbstverwaltung zu, und so konnten die Haschemiten erneut die Kontrolle über die heiligen Stätten der Stadt übernehmen, über die sie bereits im 10. Jahrhundert geherrscht hatten. Doch dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, trat ein Haschemit auf, dessen Ehrgeiz und Kühnheit das Schicksal der Familie in eine neue Richtung lenken sollte und dafür sorgte, dass die Grenzen im Nahen Ostens neu gezogen wurden.
Als Scharif Hussein ibn Ali, der 78. Emir von Mekka und Urgroßvater von Jordaniens König Hussein, an die Macht kam, stand das Osmanische Reich kurz vor dem Zusammenbruch. Während sich die Türken gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf die Seite von Deutschland stellten, begann Hussein ibn Ali geheime Verhandlungen mit den Briten. Sein Ziel war es, einen Aufstand herbeizuführen, der den Arabern die Unabhängigkeit sichern sollte. 1916 erklärte er sich bereit, zusammen mit Großbritannien und seinen Verbündeten gegen die Türken zu kämpfen. Im Gegenzug versprachen ihm die Briten die zukünftige Anerkennung der arabisch-islamischen Nation. Vier von Hussein ibn Alis Söhnen – Ali, Faisal, Abdullah und Zeid – führten im Rahmen der folgenden Auseinandersetzungen, die als »Arabische Revolte« in die Geschichtsbücher einging, eigene arabische Armeen an. Mitunter kämpften sie Seite an Seite mit dem britischen Offizier Thomas Edward Lawrence, dem Hollywood in Lawrence von Arabien ein Denkmal setzte.
Die Araber trugen den Sieg davon, doch die Briten dachten überhaupt nicht daran, ihr Versprechen gegenüber Hussein ibn Ali zu halten. Mit dem geheimen Sykes-Picot-Abkommen von 1916 teilten Großbritannien und Frankreich die eroberten osmanischen Gebiete in ein britisches und ein französisches Protektorat auf. Nach dem Krieg wurden mehr oder weniger willkürliche Grenzen gezogen und neue Staaten gegründet – Staaten, die es so bisher nie gegeben hatte. Irak und Syrien gehörten dazu und auch der schmale Streifen Land zwischen Jordan und Mittelmeer – das Heimatland der Juden, wo später Israel entstehen sollte.
In der Wüste östlich des Jordans, wo die Beduinenstämme lebten, schufen die Briten eine Enklave für Hussein ibn Alis dritten Sohn, Abdullah I. Dies war immerhin ein kleiner Schritt in Richtung dessen, was die Briten dem Herrscher von Mekka ursprünglich zugesichert hatten, aber ihrer Neugründung – zunächst »Emirat Transjordanien« getauft und später in »haschemitisches Königreich Jordanien« umbenannt – fehlten ein paar wichtige Voraussetzungen, um sich zu einem richtigen Staat entwickeln zu können. Weder existierte ein historischer Präzedenzfall für ein solches Land noch gab es so etwas wie eine gemeinsame nationale Identität der verschiedenen Stämme, die in dieser Region lebten. Der neue Staat besaß nicht einmal nennenswerte Öl- oder Gasreserven, geschweige denn abbaubare Mineralien oder auch nur Wasser, um eine Agrarindustrie schaffen zu können. Selbst Emir Abdullah war ein Import aus dem Ausland. Viele politische Beobachter gingen damals davon aus, dass Transjordanien nicht lange als autonomer Staat bestehen würde. Wahrscheinlich würde früher oder später einer der mächtigeren Nachbarstaaten das künstliche Gebilde schlucken.
Die erste ernsthafte Gefahr für Jordanien stellten die Ichwan-Rebellen dar, die das Land in den 1920er-Jahren überfielen und zuletzt nur durch eine Intervention der Saudis besiegt werden konnten. Ende der 1960er-Jahre bedrohten dann palästinensische Guerillas Jordaniens Souveränität. 400.000 palästinensische Einwanderer waren innerhalb von drei Jahrzehnten Krieg nach Jordanien geflüchtet, und aus dieser Masse an Flüchtlingen heraus entstand ein Gemisch aus militanten Gruppen, die die jordanische Armee angriffen und immer wieder Mordanschläge auf König Hussein verübten. Der Monarch startete eine Offensive, die man später als Schwarzer September bezeichnete und bei der Tausende militanter Palästinenser getötet und noch weitaus mehr nach Syrien oder in den Libanon vertrieben wurden. Auch in der palästinensisch geprägten Stadt Zarqa wurde gekämpft, als dort ein Junge von vier Jahren lebte, der sich Jahre später Abu Mus‘ab az-Zarqawi nennen sollte.
In den 1980er-Jahren drohten regionale Unruhen über die Landesgrenzen auf das relativ friedliche Jordanien überzugreifen. Tausende palästinensische Jugendliche stießen bei der ersten Intifada mit israelischen Truppen zusammen, und zugleich meldeten sich Hunderte junge Jordanier freiwillig, um in Afghanistan gegen die Sowjets zu kämpfen. Einige brachten neue militärische Fertigkeiten und Ideen mit, als sie in ihre Dörfer und Flüchtlingslager zurückkehrten. Ein paar von ihnen, wie Zarqawi, bildeten Gruppen und machten sich auf die Suche nach Wegen, den Kampf gegen alle von ihnen wahrgenommenen Feinde des Islam fortzusetzen.
Dennoch waren diese radikalen Islamisten zahlenmäßig schlecht aufgestellt und für gewöhnlich nicht gut organisiert. Wie andere arabische Herrscher auch versuchten die jordanischen Monarchen, der Bedrohung dadurch zu begegnen, dass sie leistungsfähige und skrupellose Geheimdienste einrichteten, um die Extremisten in Schach zu halten. Zugleich kooperierten sie mit gemäßigteren Islamisten, denen sie eine privilegierte Position zugestanden und begrenzte politische Freiheiten gewährten. Genau wie sein Vater unterstützte Abdullah die Muslimbruderschaft als eine der gemäßigten oppositionellen Kräfte in Jordanien. Und genau wie seine Vorfahren suchte er Mittel und Wege, um die informelle Allianz immer wieder zu stärken. Gelegentliche Gefälligkeiten und Zugeständnisse, von denen die Führungsriege dieser Gruppe politisch profitierte, sorgten dafür, dass sie der Krone gewogen blieb.
Eine solche Gelegenheit bot sich im März 1999, gerade als die offizielle 40-tägige Trauerzeit für den verstorbenen König Hussein zu Ende ging. Seit der Staatsgründung Jordaniens war es üblich, dass ein neuer König bei Amtsantritt eine Generalamnestie verkündete und zahlreiche Häftlinge begnadigte, die für gewaltfreie oder politische Straftaten verurteilt worden waren. So konnte sich der Monarch von gewissen Altlasten befreien und bei einigen wichtigen Wahlkreisen punkten, von den Islamisten bis hin zu den mächtigen Stämmen in Ostpalästina. Um eine maximale politische Wirkung zu erzielen, übertrug der König dem Parlament die Aufgabe, eine Liste von freizulassenden Gefangenen aufzustellen und die rechtlichen Belange der Amnestie auszuarbeiten. Die Liste wuchs erst auf 500 Namen an, dann auf 1000 und schließlich auf 2000. Selbst dann noch schob die Legislative neue Namen hinterher.
Die Debatte über die Namen wurde schließlich sogar öffentlich. Verurteilte Gewaltverbrecher und Terroristen waren von vornherein von der Amnestie ausgenommen, doch einige Parlamentsmitglieder bestanden darauf, zahlreiche Gefangene zu begnadigen, die den Wehrdienst verweigert hatten oder Angriffe gegen Israelis mitgeplant hatten. Andere drängten auf die Begnadigung der sogenannten arabischen Afghanen, Veteranen des Heiligen Krieges gegen die Sowjets in Afghanistan, die nach ihrer Rückkehr nach Jordanien islamistische Zellen gebildet hatten.
»Jordanien befindet sich an der Schwelle zu einer neuen Phase in seiner Geschichte, und das bedeutet, dass die Regierung ein paar Dinge ändern sollte, vor allem was den Umgang mit politischen Gefangenen betrifft«, verkündete Saleh Armuti, der Vorsitzende der jordanischen Anwaltsvereinigung, in der Jordan Times, während sich die Verhandlungen dahinschleppten. Doch einige Vorsteher der jordanischen Strafverfolgungsbehörden sahen eine Katastrophe im Entstehen. »Die meisten von denen sind Wiederholungstäter, deren Gesichter wir immer wieder sehen werden«, kritisierte ein leitender Polizeibeamter in einem Interview mit selbiger Zeitung. »Das sind Schläger, die, einmal freigelassen, anderen schaden werden.«
Am Ende segnete das Parlament die mittlerweile über 2500 Namen umfassende Liste ab und schickte sie zur letzten Freigabe an den Palast. Der König war seit sechs Wochen in Amt und Würden und hatte gerade erst begonnen, sich durch das dreidimensionale Minenfeld aus Legislative, Stammes- und Königspolitik hindurchzukämpfen. Nun hatte er die Wahl: Entweder unterzeichnete er die Liste oder er schickte sie zum Parlament zurück, wo man wieder wochenlang darüber debattiert hätte.
Er unterzeichnete sie.
Mehrere Monate sollten vergehen, bis Abdullah erfuhr, dass auf der Liste mehrere arabische Afghanen aus dem Al-Dschafr-Gefängnis aufgeführt waren, deren an die Ichwan-Rebellen erinnernder Eifer, den islamischen Glauben »reinigen« zu wollen, sie eigentlich sofort für eine Amnestie hätte disqualifizieren müssen. Zu diesem Zeitpunkt war aus dem obskuren Dschihadisten namens Ahmad Fadil al-Chalaila bereits der Terrorist Abu Mus‘ab az-Zarqawi geworden. Nun aber konnte selbst der König von Jordanien nichts weiter tun, als sich zu ärgern und seine Mitarbeiter zu maßregeln, so sinnlos es auch war.
»Warum hat das bloß niemand überprüft?«, wollte er immer wieder wissen.
Am Abend des 29. März 1999 traf eine Karawane gepanzerter Fahrzeuge in Al-Dschafr ein, um die ersten der dort einsitzenden vom König begnadigten Islamisten fortzubringen und in die Freiheit zu entlassen. Laut Gesetz war (und ist) der Staat verpflichtet, einen Begnadigten dorthin zu überführen, wo er ursprünglich verhaftet worden war. Also nahmen Zarqawi und sein Mentor Abu Muhammad al-Maqdisi Platz in einem Kastenwagen, der sie nach Amman bringen würde. Bei sich hatten sie ihre wenigen Habseligkeiten und frisch gestempelte Entlassungspapiere, die ihnen die Bürgerrechte zurückgaben. Sie konnten nun wieder arbeiten, Freunde besuchen, sich mit Gleichgesinnten treffen und herumreisen, wie jeder andere jordanische Staatsbürger auch. Der Fahrer des Kastenwagens wartete, bis es dunkel war. Dann steuerte er sein Fahrzeug durch das Haupttor, an den Wachen und Maschinengewehrnestern vorbei, entlang der verdorrten Palmen, die die Köpfe hängen ließen und die Auffahrt säumten, und schließlich auf den rauen Asphalt der Schnellstraße, die zur Hauptstadt führte. Nach fünf Jahren waren die Insassen wieder freie Männer.
Aber ganz frei waren sie nicht. Beide hatten Frauen und Kinder, die sie kaum kannten, Familien, die mehr schlecht als recht die Zeit ihrer Gefangenschaft bewältigt hatten und von den Almosen der Verwandten hatten leben müssen. Beide würden bis auf Weiteres von der Geheimpolizei des Landes überwacht und hin und wieder gegängelt werden. Und beide waren an die islamistische Bruderschaft gebunden, die sie zusammen im Gefängnis geschmiedet hatten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.
Maqdisi hatte sich während der Monate in Al-Dschafr von den anderen Insassen immer weiter distanziert. Je näher der Tag der Entlassung gerückt war, desto öfter hatte er davon gesprochen, zu seiner Familie und seinen Schriften zurückzukehren. Er wollte in der gesamten muslimischen Welt immer mehr Leser finden, sich zugleich aber nichts zuschulden kommen lassen, um nicht wieder im Gefängnis zu landen.
Zarqawi indes war zwischen zwei Familien hin- und hergerissen – derjenigen in Zarqa und derjenigen, die er sich im Gefängnis aufgebaut hatte. Seine Al-Dschafr-Brüder waren ihm persönlich ergeben und bereit, ihm überallhin zu folgen. Doch jetzt, im Zuge der Amnestie, drohte diese neue Familie mit einem Mal zu zerfallen.
Sabha, der Gefängnisarzt, war an jenem Abend nicht vor Ort, als Zarqawi und die anderen nach Amman abreisten. Überhaupt gab es neuerdings Gerüchte, dass die gesamte Anstalt bald geschlossen werden sollte, jetzt, wo so viele Insassen begnadigt wurden und der Arbeitsaufwand für das Gefängnispersonal immer geringer wurde. Am Morgen nach der Freilassung traf Sabha etwas früher als gewohnt zu seiner Schicht im Gefängnis ein. Im Büro des Direktors bekam er einen Kaffee und erfuhr die neuesten Nachrichten.
Oberst Ibrahim begrüßte ihn mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. »Unser ganz spezieller Freund ist zurück«, sagte er.
Der Anstaltsleiter führte den Arzt durch den Hof in Richtung der Gemeinschaftszelle der Islamisten, wo jetzt nur noch eine Handvoll Männer einsaßen, die als Gewalttäter von der Amnestie ausgenommen waren. Als sie näherkamen, sah Sabha einen bärtigen Mann an der Tür stehen, der durch die Gitterstäbe mit den Gefangenen sprach. Es war Zarqawi.
»Seit heute Morgen um halb sechs ist er hier«, sagte der Direktor. Zarqawi war den ganzen Weg nach Amman gefahren und hatte ein paar Stunden bei seiner Mutter in Zarqa verbracht. Daraufhin hatte er sich von einem Freund ein Auto geliehen und war die ganze Nacht hindurchgefahren, um noch vor Tagesanbruch in Al-Dschafr einzutreffen. Und hier stand er nun, zurück im verhassten Gefängnis, um zu den restlichen Insassen zu predigen – wie ein Kommandant, der die Moral seiner Truppe überprüft.
Sabha sah einen Moment lang ungläubig zu. »In diesem Augenblick wusste ich: Er war der geborene Anführer«, sagte er später. »Mir war klar, dass man von ihm noch hören würde. Und entweder wäre er dann berühmt oder tot.«