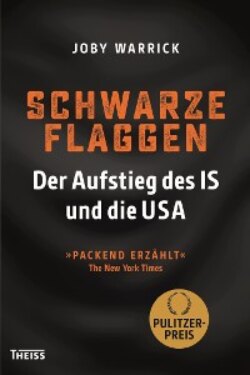Читать книгу Schwarze Flaggen - Joby Warrick - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
»Die Zeit der Ausbildung ist vorüber«
ОглавлениеAm 30. November 1999 hörten jordanische Ermittler einen militanten Islamisten ab, der schon zweimal im Gefängnis gesessen hatte, als in einem der täglichen Transkripte ein ominöser Satz auftauchte. Der verdächtige Anruf kam aus Afghanistan, und was der Anrufer sagte, klang wie eine codierte Anweisung oder ein Befehl.
»Die Zeit der Ausbildung ist vorüber«, hatte der Anrufer gesagt, auf Arabisch mit levantinischem Akzent.
Obwohl diese Worte mehr als vage waren, beschlossen die Chefs des Muchabarat, schnell gegen das zu handeln, was die Islamisten planten. Schon bald stellte sich heraus, dass etwas Großes im Gange war. Binnen weniger Tage nahmen die jordanischen Behörden 16 Personen fest, darunter den Angerufenen, Chadar Abu Hoschar, einen Palästinenser und Afghanistan-Veteranen mit Verbindungen zu verschiedenen extremistischen Gruppen. Sie konfiszierten Handbücher für den Bombenbau und Hunderte Kilogramm Chemikalien, die in einem geheimen unterirdischen Gang versteckt waren. Von einem der Verdächtigen erfuhren sie wichtige Details, nicht zuletzt das Datum des geplanten Anschlags – Silvester 1999 – und das »Motto« der Terroraktion: »Die Saison beginnt. Leichen werden sich in Säcken stapeln.«
Ein paar Tage später lud der stellvertretende Leiter des Muchabarat den Stationschef der CIA in Amman, Robert Richer, zum Abendessen ein. Sa’ad Cheir wirkte ungewöhnlich ängstlich. Er hatte ganz offensichtlich etwas auf dem Herzen. Erst nach ein paar Drinks rückte er mit der Sprache heraus.
»Rob, ich muss Ihnen etwas sagen, aber das dürfen Sie meinem Chef auf keinen Fall verraten«, sagte Cheir. »Wir haben gerade ein paar Leute festgenommen, die schwere Terroranschläge auf mehrere Ziele in Jordanien geplant haben.«
Der Geheimdienstler erzählte, wie die Jordanier quasi über die Verschwörung gestolpert waren und was sie bisher über die geplanten Ziele wussten. Ganz oben auf der Liste stand das Radisson-Hotel, ein Wahrzeichen von Amman, das zu Silvester voll sein würde mit Amerikanern und anderen Westlern sowie Hunderten Jordaniern. Man habe beim Muchabarat jedoch beschlossen, den US-Kollegen keine Einzelheiten mitzuteilen, bevor man nicht sicher sein konnte, alle Verschwörer in Gewahrsam zu haben.
»Sa’ad, ich kann nicht anders«, unterbrach ihn Richer, »ich muss diese Informationen verwenden. Ich muss mich mit Ihrem Vorgesetzten treffen und eine Freigabe dafür erhalten.« Richer war ein ehemaliger Angehöriger des US Marine Corps und absolvierte gerade seine zweite Amtszeit als Spionagechef der CIA in Jordanien. Selbstverständlich wusste er um die komplexen internen Abläufe und Beziehungen innerhalb des Muchabarat. Aber dieses Mal stand möglicherweise das Leben von Amerikanern auf dem Spiel.
Am folgenden Morgen marschierte er direkt in das Büro von Samih Battichi, dem amtierenden Direktor des Muchabarat, und teilte ihm mit, dass die CIA – unabhängig von den Jordaniern – von einem geplanten Anschlag erfahren habe, der am Vorabend des neuen Jahrtausends in Jordanien stattfinden solle. Battichi war überrascht, doch er hatte keine andere Wahl, als dem Amerikaner alles zu erzählen, was er wusste.
In den folgenden zwei Wochen trafen amerikanische Anti-Terror-Teams in Amman ein, um die Jordanier bei der Aufdeckung der Anschlagsserie zu unterstützen, die später als »Millennium Plot« in die Geschichte eingehen sollte. Sie verfolgten Hinweise, die sie in mindestens sechs Länder führten. Der Teil der Anschlagsserie, der sich in Jordanien abspielen sollte, war von einem Al-Qaida-Verbindungsmann in Ost-Afghanistan organisiert worden und sah mehrere Bombenanschläge und Überfälle mit Handfeuerwaffen vor. Zu den Angriffszielen gehörten neben dem Radisson in Amman ein Grenzübergang nach Israel sowie zwei bei Besuchern aus dem Westen beliebte christliche Heiligtümer. Außerdem war ein Anschlag auf den Los Angeles International Airport geplant; dieser wurde vereitelt, als US-Zollagenten den Attentäter verhafteten, der in einem mit Sprengstoff vollgepackten Auto die US-kanadische Grenze passieren wollte.
Man fand neue Dokumente und weitete die Internet-Überwachung aus, woraufhin immer mehr vermeintliche Verschwörer auftauchten. Die Zahl der Verdächtigen stieg auf 28. Von den Namen auf dieser Liste sorgte besonders einer für Aufsehen: ein Jordanier aus Zarqa, der mit seinem Geburtsnamen Ahmad Fadil al-Chalaila genannt war.
Zarqawi war wieder da.
Als er Jordanien zwei Monate zuvor verlassen hatte, war Abu Mus‘ab az-Zarqawi gerade einmal bis in den Westen Pakistans gelangt. Dort schien ihn irgendetwas aufgehalten zu haben. Der auf ihn angesetzte Informant hatte gemeldet, dass Zarqawi täglich an den Gebeten in einer arabischsprachigen Moschee in Peschawar teilnehme und sauber sei. Jetzt, nur Wochen später, tauchte sein Name plötzlich im Zusammenhang mit einer terroristischen Anschlagsserie auf, die alles in den Schatten stellen sollte, was Jordanien in den vergangenen Jahren erlebt hatte.
Auch wenn Zarqawi wohl nur eine untergeordnete Rolle als Berater spielte, ergaben abgehörte Gespräche genug belastendes Material, um ihn anzuklagen und in Abwesenheit schuldig zu sprechen. Er tauchte auch in einem Bericht auf, der auf Robert Richers Schreibtisch bei der CIA in Amman landete.
»Das war das erste Mal«, erinnerte sich der amerikanische Geheimdienstoffizier später, »dass wir Zarqawis Namen hörten.«
Durch das Aufdecken dieser Verschwörung hatten die Jordanier unzählige Leben gerettet und zugleich eine wirtschaftliche und politische Katastrophe abgewendet. Die Dschihadisten hatten bewusst Symbole der jordanischen Tourismusindustrie ins Visier genommen, und das zu einem Zeitpunkt, als das Land und sein junger Monarch nach König Husseins Tod noch nicht ganz zum alten Gleichgewicht wiedergefunden hatten. Seit neun Monaten regierte Abdullah II., und er hatte alle Hände voll damit zu tun, wirtschaftliche und politische Reformen gegen den heftigen Widerstand der alten Garde Jordaniens durchzusetzen. Dazu zählten Generäle der Armee, Geheimdienstchefs und Stammesführer, die unter seinem Vater besondere Privilegien genossen hatten. Ein erfolgreicher Anschlag hätte das Antlitz Jordaniens komplett verändert und ausgereicht, um die Wirtschaft des Landes zu lähmen und den Einfluss des neuen Königs zu schwächen.
Beim Muchabarat gab es daher trotz der vereitelten Anschlagsserie wenig Grund zur Freude. Die Islamisten hatten ihre Entschlossenheit demonstriert, Jordanien zu attackieren, und sie hätten ihren Plan beinahe in die Tat umgesetzt. Auch wenn jetzt einige der Verschwörer im Gefängnis saßen, hielten sich die Drahtzieher in Afghanistan und Pakistan auf und waren nach wie vor auf freiem Fuß.
Das galt auch für Zarqawi. Doch immerhin wusste man jetzt, woran man bei ihm war. Noch im September hatte Zarqawi im Büro von Kommandant Abu Haytham gesessen und darum gebettelt, für den Beginn seines neuen Lebens Jordanien verlassen zu dürfen. Keine drei Monate später musste der Muchabarat eingestehen, dass es ein schwerer Fehler gewesen war, Zarqawi ziehen zu lassen.
»Trotz allem, was passiert war«, beklagte sich Abu Haytham, »hatte er Jordanien nicht vergessen.« Auch später sollte sich Zarqawi immer wieder an sein Heimatland erinnern, selbst dann, als er längst größere Ziele verfolgte. »Der Weg nach Palästina führt über Amman«, sagte Zarqawi oft zu seinen Freunden.
Der Muchabarat erfuhr schon bald von neuen geplanten Anschlägen in Jordanien. Der nächste, bei dem Zarqawis Namen auftauchen sollte, wurde von ihm allein organisiert und vorbereitet.
Zarqawis Aufenthalt in Pakistan verlief nicht ganz so, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte. Im September war er in Peschawar eingetroffen und wollte dann weiter in den Nordkaukasus reisen; dort begann gerade ein neuer Krieg, bei dem tschetschenische Separatisten und Islamisten gegen die Russische Föderation kämpften. Falls es ihm gelang, sich der dortigen Islamischen Internationalen Brigade anzuschließen, konnte Zarqawi endlich gegen die Russen kämpfen, was ihm im afghanischen Bürgerkrieg verwehrt gewesen war. Aber es sollte nicht so sein. Die pakistanische Regierung, die in den 1980er-Jahren mitgeholfen hatte, die afghanischen Rebellen zu finanzieren, war 1999 weit weniger tolerant gegenüber umherpilgernden arabischen Dschihadisten. Zarqawi hatte große Schwierigkeiten, Verbindungen aufzutun und sich Reisedokumente zu verschaffen. Während er untätig in Pakistan saß, wurde in Tschetschenien ein Großteil der islamistischen Armee durch Aerosolbomben vernichtet, die die russische Luftwaffe über den tschetschenischen Gebirgspässen an der Grenze zu Dagestan abgeworfen hatte.
Ein halbes Jahr nach seiner Einreise teilten die pakistanischen Behörden Zarqawi mit, dass sein Visum abgelaufen war und er das Land verlassen musste. Nun stand er vor der Wahl: Entweder kehrte er nach Jordanien zurück, wo er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für seine Rolle beim Millennium Plot hinter Gitter wandern würde. Oder er machte sich auf eigene Faust über die Berge nach Afghanistan auf. Doch Afghanistan war als Aufenthaltsort nicht mehr annähernd so verlockend wie bei seinem letzten Besuch dort: Nicht nur hatten die letzten sechs Jahre Bürgerkrieg das Land regelrecht verwüstet, der aktuellen Phase des Konflikts fehlte zudem auch die moralische Klarheit, die in den 1980er- und 1990er-Jahren Zarqawi und Zehntausende andere arabische Freiwillige angelockt hatte. Bei der damaligen Auseinandersetzung hatten Islamisten gegen Kommunisten gekämpft; inzwischen waren die Russen fort, und stattdessen gab es eine Vielzahl von muslimischen Warlords und Taliban-Generälen, die in ständig wechselnden Allianzen gegeneinander antraten.
Trotz allem entschied sich Zarqawi für Afghanistan. Zusammen mit zwei Bekannten brach er auf nach Kandahar; dort landeten sie am Ende im Hauptquartier eines ehemaligen afghanischen Arabers, von dem man hätte erwarten können, dass er Zarqawi mit offenen Armen empfangen würde: Osama bin Laden. Aber statt einer warmherzigen Begrüßung des alten Mudschaheddin-Kameraden wurde Zarqawi schroff abgewiesen. Der Al-Qaida-Gründer weigerte sich, Zarqawi persönlich zu empfangen und schickte einen seiner Helfer vorbei, um die Jordanier zu überprüfen. Bin Ladens Vorsicht gegenüber Besuchern hatte einen guten Grund: Die Anschläge auf zwei US-Botschaften in Afrika im Jahr zuvor, bei denen Hunderte Menschen getötet wurden, hatten bin Laden einen Platz auf der FBI-Liste der meistgesuchten Verbrecher gesichert. Besonders wachsam ging er bei Leuten aus dem Umfeld von Muhammad al-Maqdisi, Zarqawis ehemaligem Mithäftling und Mentor, vor. Maqdisi hatte die Herrscher von bin Ladens Heimat Saudi-Arabien gegen sich aufgebracht, nachdem er in mehreren Abhandlungen den gewaltsamen Sturz abtrünniger arabischer Regimes gefordert hatte. Bin Laden hatte selbst schon genug Probleme mit den Saudis – jeder Umgang mit Maqdisi oder dessen Anhängern hätte alles nur noch verschlimmert.
Zarqawi saß zwei Wochen lang in einem Gästehaus herum und langweilte sich, bis endlich einer von bin Ladens ranghohen Stellvertretern, ein ehemaliger ägyptischer Armeeoffizier namens Sayf al-Adel, auftauchte, um sich mit ihm zu unterhalten. Jahre später schrieb al-Adel über die damaligen Ereignisse. Weil Zarqawi der Ruf vorauseilte, verbohrt und aggressiv zu sein, misstraute ihm auch al-Adel.
»Kurz gesagt: Abu Mus‘ab war ein Hardliner, wenn es um Meinungsverschiedenheiten mit anderen Mitgliedern der Bruderschaft ging«, schrieb er, »Deshalb hatte ich Vorbehalte.« Nach der traditionellen Begrüßung und Umarmung nahm sich al-Adel einen Moment, um den Jordanier einzuschätzen. Sein erster Eindruck war nicht besonders ermutigend.
»Abu Mus‘ab war ein kräftiger Mann, aber mit Worten war er nicht so gut«, erinnerte sich al-Adel. »Seine Äußerungen kamen spontan und waren immer recht knapp. Von seinen Überzeugungen rückte er keinen Zentimeter ab.«
Die eine große Idee, die Zarqawi offenbar hatte, war »den Islam wieder in der Gesellschaft zu verankern«, und er hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, wie das aussehen sollte. Doch schien er laut al-Adel nicht zu wissen, wie er anfangen sollte, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Als der Al-Qaida-Vertreter Zarqawi darüber befragte, was sich in letzter Zeit in dessen Heimat ereignet hatte, stellte er fest, dass der Jordanier erschreckend schlecht informiert war.
»Was Jordanien betraf, kannte er sich einigermaßen aus, aber über Palästina war er überhaupt nicht auf dem Laufenden«, so al-Adel. »Wir hörten ihm zu und widersprachen ihm nicht, schließlich wollten wir ihn für unsere Seite gewinnen.«
Trotz Zarqawis Schwächen entwickelte al-Adel allmählich eine gewisse Sympathie für den Besucher. Sein ungelenkes und wenig eloquentes Auftreten erinnerte al-Adel an die Zeit, als er selbst ein junger Mann war. Für jemanden, der so hartnäckig auf seiner Meinung beharrte wie Zarqawi, gab es bei Al-Qaida keinen Platz, und al-Adel bot ihm zu keinem Zeitpunkt an, sich der Organisation anzuschließen. Aber er hatte bereits eine Idee, wie Zarqawi Al-Qaida auf andere Weise nützen könnte. Am nächsten Morgen besprach er sie mit bin Laden.
Schon Ende 1999 verfügte Al-Qaida über ein leistungsstarkes Netzwerk aus Helfern in Afghanistan, in Nordafrika und in den Ländern am Persischen Golf. Nur in der Levante war Al-Qaida noch nicht präsent. Obwohl die Vernichtung Israels zum erklärten Ziel der Terrororganisation gehörte, hatte sie es bislang nicht geschafft, in Jordanien oder den Palästinensergebieten ihre Kader zu platzieren. Doch genau das war dringend nötig – schließlich musste an allererster Stelle Jordaniens pro-westliche Regierung gestürzt werden. Und hier kam Zarqawi ins Spiel, mit seinen jordanischen Wurzeln und den Verbindungen zu palästinensischen Islamisten, die er im Gefängnis kennengelernt hatte.
»Können wir uns eine solche Gelegenheit, in Palästina und Jordanien präsent zu sein, entgehen lassen?«, fragte al-Adel bin Laden. »Können wir auf die Chance verzichten, mit Abu Mus‘ab und ähnlichen Leuten in anderen Ländern zu kooperieren?«
Es blieben jedoch gewisse Zweifel, ob man Zarqawi wirklich trauen konnte, daher schlug al-Adel ein Experiment vor: Der Jordanier sollte ein eigenes Ausbildungscamp leiten, speziell für Islamisten aus Jordanien und den anderen Ländern der Levante, aus dem Irak und der Türkei. Al-Qaida würde das Startkapital zur Verfügung stellen und dann aus einiger Entfernung beobachten, wie Zarqawi sich machte. Genau genommen betrug die Entfernung fast 600 Kilometer – so weit war das Lager für die Kämpfer aus der Levante in Herat nahe der Grenze zum Iran von der Al-Qaida-Zentrale entfernt. Zarqawi musste weder bin Laden die Treue schwören, noch musste er sich in allen Punkten der Ideologie von Al-Qaida unterwerfen. Aber es gab jede Menge Geld von reichen Gönnern vom Golf und, wie al-Adel schrieb, eine umfassende »Koordination und Kooperation, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen«.
Zarqawi bat um zwei Tage Bedenkzeit. Dann nahm er das Angebot an.
Sein erstes Ausbildungscamp wurde zunächst nur von einer Handvoll seiner engeren Freunde aus Jordanien und deren Familien besucht. Aber über seine alten Mudschaheddin-Kameraden und seine früheren Mithäftlinge gelang es Zarqawi nach und nach, immer mehr Kämpfer zu rekrutieren, die sich auf den Weg in den Westen Afghanistans machten. Als al-Adel das erste Mal in das Lager in Herat reiste, um sich einen Eindruck von Zarqawis Arbeit zu verschaffen, zählte er 18 Männer, Frauen und Kinder. Zwei Monate später lebten bereits 42 Personen im Camp, darunter mehrere Syrer und Europäer. Der Syrer Abu al-Ghadija, ein Kamerad von Zarqawi aus dessen Mudschaheddin-Zeit, war ein gelernter Zahnarzt, der vier Sprachen sprach und als eine Art Reise- und Logistikchef fungierte. Später sollte er die Versorgungslinie für Zarqawis Netzwerk durch Syrien hindurch und in den Irak hinein überwachen. Momentan erreichten die meisten Rekruten Afghanistan über den Iran. Obwohl Zarqawi Schiiten verachtete und die iranische Staatsführung als Ketzer ansah, gehörten mehrere Iraner zu seinen Kontaktmännern, die konspirative Wohnungen unterhielten und halfen, Männer und Versorgungsgüter zur afghanischen Grenze zu schmuggeln.
Der Leiter des Ausbildungscamps hatte sich inzwischen in einen enthusiastischen Kommandanten verwandelt. Er hatte nun auch eine zweite Ehefrau, Asra, die 13 Jahre alte Tochter eines palästinensischen Lagerkameraden. Einige der Al-Qaida-Finanziers sahen das gar nicht gerne, weil sie Ehen mit Minderjährigen generell ablehnten. In seiner Freizeit las er Bücher, eignete sich grundlegende Computerkenntnisse an und arbeitete an seinen rhetorischen Fähigkeiten – er wollte seinen Zarqa-Slang loswerden und sich stattdessen am klassischen Arabisch des Korans orientieren. Ansonsten beaufsichtigte er die komplette Ausbildung seiner Rekruten, von Schießübungen bis hin zum Unterricht in islamischer Geschichte und Theologie.
»Sie schufen die Miniaturausgabe einer islamischen Gesellschaft«, erklärte al-Adel stolz.
Aber das alles war nicht von Dauer. In Kandahar gab bin Laden seine endgültige Zustimmung für die Anschläge am 11. September 2001, die die USA in einen Krieg gegen Al-Qaida führen würden – und gegen die Taliban, die Al-Qaida Unterschlupf gewährten. Laut al-Adel erfuhr Zarqawi erst hinterher von den Anschlägen auf New York und Washington. Dennoch wurde Zarqawis Camp in Herat in den folgenden Wochen von den Amerikanern ebenso angegriffen wie der Stützpunkt von bin Laden.
Schließlich organisierten Zarqawis Jünger und ihre Familien einen Konvoi ans andere Ende Afghanistans, um Al-Qaida bei der Verteidigung von Kandahar zu helfen. Dank der Unterstützung durch US-Bodentruppen und Luftangriffe der Air Force hatte die Nordallianz bereits die Hauptstadt Kabul erobert und bereitete sich nun darauf vor, in die letzte Hochburg der Taliban-Regierung einzumarschieren. Kurz nach der Ankunft der Gruppe aus Herat in Kandahar traf ein US-Bomber ein Haus, in dem sich gerade die Anführer von Al-Qaida versammelten. Einige von ihnen wurden verwundet, andere, darunter auch Zarqawi, lagen unter Schutt begraben. Später wurde der Jordanier mit schlimmen Verletzungen, darunter mehreren gebrochenen Rippen, aus den Trümmern gezogen. Noch während der Zeit seiner Behandlung floh bin Laden in sein privates Refugium in den Bergen im Osten des Landes, den Höhlenkomplex Tora Bora, und ließ die Taliban im Stich.
Zarqawi versammelte seine Anhänger und ein paar Al-Qaida-Nachzügler um sich, und gemeinsam brachen sie auf nach Westen, in Richtung Iran. In den dortigen Grenzstädten, über die seine Rekruten einst ins Land gekommen waren, glaubte er sich in Sicherheit. Hier fanden sich die Flüchtigen in kleinen Gruppen zusammen, wie al-Adel später erzählte, und überlegten, welche Möglichkeiten ihnen blieben. Im Osten Afghanistans wurde bin Ladens Versteck von den USA bombardiert. Im Iran war die Regierung, die noch bis vor Kurzem Al-Qaida-Flüchtlingen Unterschlupf gewährt hatte, auf einmal umgeschwenkt und verhaftete zahlreiche Neuankömmlinge, die meisten von ihnen aus dem Camp in Herat. Wohin sollten sich die übrig gebliebenen Al-Qaida-Angehörigen jetzt wenden? Gab es einen Ort, der ihnen physischen Schutz bot und wo sie sich neu organisieren konnten?
Den gab es – in den Bergen im Nordosten des Irak. Hier, nur ein paar Kilometer von der iranischen Grenze entfernt, hatten sich eine Handvoll kurdischer Dörfer und Städte innerhalb der Grenzen der irakischen Diktatur eine wertvolle Autonomie bewahrt. Diese kurdischen Provinzen lagen in der gegen Ende des ersten Golfkrieges im Jahre 1991 von den USA eingerichteten Flugverbotszone. Seither hatten sich hier eine ganze Reihe unterschiedlicher politischer Fraktionen gebildet. Eine der kurdischen Gruppen war eine talibanähnliche Bewegung, die viele afghanische Kriegsveteranen aufgenommen hatte und sich selbst Ansar al-Islam nannte, »Helfer des Islam«. Die Anführer dieser Gruppe, sunnitische Extremisten, hatten über die von ihnen kontrollierten Dörfer das harte Gesetz der Scharia verhängt: Musik in jeder Form war verboten, Frauen mussten in der Öffentlichkeit ihr Gesicht bedecken, die Schulbildung für Mädchen wurde abgeschafft. Außerdem entwickelten sie eine seltsame Vorliebe für Gift und richteten sich ein behelfsmäßiges Labor ein, wo sie streunende Hunde mit Zyanid und selbst hergestelltem Rizin vergifteten.
Abgesehen davon bot der Nordirak einem Jordanier auf der Flucht noch weitere Vorteile: Hier würde sich Zarqawi viel leichter unter die örtliche Bevölkerung mischen können als in Afghanistan, wo er die Sprache nicht beherrschte. Außerdem war die Gegend so einsam und abgelegen, dass er ungestört zur Ruhe kommen konnte.
Nachdem er das Basislager von Ansar al-Islam erreicht hatte, ließ sich Zarqawi in dem kleinen Dorf Sargat nieder, das aus kaum mehr bestand als einer Ansammlung steinerner Hütten an einer Gasse, die in die Berge führte. Mit einer Handvoll seiner Anhänger aus Herat und den letzten paar Tausend Dollar von Al-Qaida fing er an, sein altes Ausbildungscamp wieder aufzubauen. Die Bedingungen waren diesmal allerdings anders; vor allem fehlte jetzt, wo bin Laden 3000 Kilometer entfernt in seinem Versteck hockte, der Einfluss von Al-Qaida. Zarqawi würde sich neue Verbündete und neue Finanziers suchen müssen. Ein paar gab es immerhin schon, so die Islamisten in Bagdad, die ihn aufgenommen hatten, als er dort inkognito seine gebrochenen Rippen hatte behandeln lassen. Gleichzeitig machte sich Zarqawi auch Gedanken über die Ausrichtung seiner Organisation und die Ziele seines Dschihad. Bis 2001 hatte Zarqawis zwei große Feindbilder: Israel und die jordanische Regierung. Jetzt erinnerten ihn die gebrochenen Rippen in seiner Brust immer wieder schmerzhaft daran, wie sehr er sich an den Vereinigten Staaten rächen wollte. Das erzählte er al-Adel an einem der letzten Tage, bevor er den Iran verließ, um sich Ansar al-Islam anzuschließen. Es war das letzte Mal, dass die beiden Männer miteinander sprachen. »Als er kam, um sich zu verabschieden, bevor er den Iran verließ«, erinnerte sich al-Adel, »betonte er noch einmal, wie wichtig es sei, sich an den Amerikanern für deren Verbrechen bei der Bombardierung Afghanistans zu rächen, die er mit eigenen Augen gesehen hatte.«
Drei Faktoren hatten Zarqawis Charakter entscheidend geprägt: der Krieg, die Zeit im Gefängnis und die Verantwortung als Kommandant seines eigenen Ausbildungscamps. Er sah sich nicht mehr nur als Führungspersönlichkeit, sondern als Mann mit einem bestimmten Schicksal. Laut al-Adel hatten sich seine Energie und sein Denken nun erneut verändert, diesmal »durch seinen Hass auf die Amerikaner«. Im Westen begann die Presse damals gerade darüber zu spekulieren, ob die US-Regierung von Präsident George W. Bush möglicherweise einen zweiten Krieg gegen den Irak und Saddam Hussein plante. Zarqawi glaubte den Gerüchten sofort. In Gesprächen mit entmutigten Islamisten in den düsteren Monaten des Jahres 2002 sprach er immer wieder davon, dass ein epischer Konflikt bevorstehe und wie ihn das Schicksal genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gelenkt habe, damit er es mit dem größten Feind Allahs aufnehmen könne. So zumindest beschreibt es Fu’ad Husayn, ein jordanischer Journalist, der Zarqawi im Gefängnis kennengelernt hatte und später eine Biografie über die frühen Jahre des Terroristenführers veröffentlichte. Zu jener Zeit befand sich bin Laden in Pakistan auf der Flucht, und US-Spezialkräfte jagten die Nachhut der Taliban durch die Berge im Osten Afghanistans. Der eigentliche Showdown, wie Zarqawi vorhersagte, stand noch aus. Er würde sich in einem Land ereignen, in dem es seit mindestens 100 Jahren keine nennenswerten religiös motivierten Kampfhandlungen mehr gegeben hatte.
»Die nächste Schlacht gegen die Amerikaner«, sagte Zarqawi zu seinen Freunden, »wird im Irak stattfinden.«