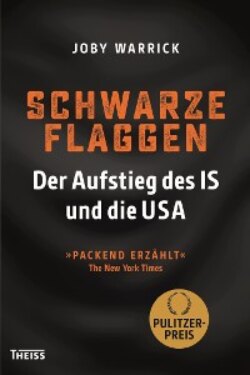Читать книгу Schwarze Flaggen - Joby Warrick - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
»Was ist das für ein Mensch, der nur mit seinem Blick Befehle erteilt?«
ОглавлениеDie alte Festung Al-Dschafr ist die wohl bekannteste Justizvollzugsanstalt Jordaniens. Viele Jahrzehnte lang sperrte man dort Störenfriede ein, um sie von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sie liegt in der Nähe eines gleichnamigen Beduinendorfes, und die Straße, die zum Gefängnis führt, markiert die Grenze zwischen den bewohnten Gebieten und der unwirtlichen Wüste im Südosten des Landes. Hinter dem Bau flacht das Gelände ab und geht über in einen Talkessel aus gebranntem Lehm, der sich ohne Hügel, Felsen oder Grasstoppeln bis zum Horizont erstreckt. In Urzeiten gab es hier ein Meer, das längst ausgetrocknet ist und eine große Einöde hinterlassen hat, die wie eine fehlende Gliedmaße wirkt, eine so unnatürliche Lücke, dass sie bei jedem der wenigen Reisenden, die hier vorbeikommen, ein mulmiges Gefühl hinterlässt. »Die Einsamkeit hier ist fürchterlich«, schrieb Filmemacher David Lean, der im Jahr 1962 in der Ebene einige Szenen von Lawrence von Arabien drehte. Lean nannte diesen Ort »einsamer als jede Wüste, die ich je gesehen habe«. Sein damaliger Schnittassistent Howard Kent bezeichnete Al-Dschafr als einen »Vorgeschmack auf die Hölle«.
Genau hier beschlossen die britischen Militäraufseher, ein imposantes Gefängnis zu errichten, mit Kalksteinwänden und hohen Türmen für Häftlinge, die für gewöhnliche Strafanstalten als zu gefährlich galten. Und genau hier begannen die Jordanier viele Jahre später, militante Palästinenser und andere Radikale wegzusperren, die als Bedrohung für den Staat wahrgenommen wurden. Hunderte Männer saßen hier ein, von denen viele niemals formal angeklagt worden waren. Sie vegetierten in stickigen, von Ungeziefer befallenen Zellen dahin, bekamen ranziges Essen vorgesetzt und mussten nicht nur extreme Temperaturen ertragen, sondern auch eine ganze Reihe von Misshandlungen, die später von Ermittlern der Vereinten Nationen dokumentiert wurden. Regelmäßig wurden Neuankömmlinge bewusstlos geschlagen. Andere wurden mit Elektrokabeln ausgepeitscht, mit brennenden Zigaretten gepeinigt oder an einem Stock in den Kniekehlen kopfüber aufgehängt – Wachen sprachen bei dieser Position hämisch vom »Grillhähnchen«. Irgendwann jedoch kam der Punkt, an dem die Monarchie die Kosten für den Unterhalt einer so abgelegenen Justizvollzugsanstalt nicht mehr tragen wollte, die darüber hinaus den Ruf des Landes gefährdete. 1979 wurden die letzten Insassen in andere Anstalten überführt. Al-Dschafr überließ man den Skorpionen und den Geistern der dort Verstorbenen.
Doch wiederum viele Jahre später geschah etwas, das die Behörden dazu veranlasste, das alte Gefängnis wieder zu eröffnen. Das Direktorat für öffentliche Sicherheit musste sich schon eine ganze Weile mit einer Gruppe regierungsfeindlicher Fanatiker herumschlagen, die im Zentralgefängnis des Landes in Swaqa einsaßen. Um zu verhindern, dass sich die Unruhen weiter ausbreiteten, beschlossen sie 1998, die Gruppe zu isolieren. Und so schickten die Beamten ein ganzes Heer an Arbeitern in einen der verstaubten, leeren Flügel von Al-Dschafr, ließen die Gänge durchfegen und eine große Zelle vorbereiten, wo alle Häftlinge zusammen untergebracht werden konnten. In engen Reihen wurden 25 Etagenbetten aufgestellt; am Zelleneingang wurde eine nagelneue Stahlgittertür installiert. Abgesehen von dieser Tür waren die einzigen Öffnungen der Zelle ein paar schmale Luftschlitze, die auf Kniehöhe in die Wände gehauen waren. Als die Anlage bezugsfertig war, ernannte das Direktorat einen Gefängnisdirektor und stellte das übliche Personal von Vollzugsbeamten zusammen – Wachen, Köche, Wäscher. Für die wenigen Insassen lohnte es sich allerdings nicht, einen eigenen Gefängnisarzt zu beschäftigen. Zum Glück hatte die Gesundheitsbehörde erst vor Kurzem dem nahe gelegenen Dorf einen jungen Mann namens Basel al-Sabha zugewiesen, einen frischgebackenen Absolventen der medizinischen Hochschule. In dessen Zuständigkeitsbereich fiel auch das Gefängnis, und so kam es, dass ein schlaksiger 24-Jähriger mit eher jungenhafter Ausstrahlung die medizinische Versorgung der 50 gefährlichsten Männer Jordaniens zu verantworten hatte.
Sabha war alles andere als begeistert und legte sofort Beschwerde ein. In Jordanien galten Gefängnisse ohnehin als besonders üble Orte, und dieses hier war (zumindest seinem Ruf nach) schlimmer als alle anderen. Der junge Mann hatte Angst, die noch größer wurde, als bei seinem ersten Besuch in Al-Dschafr der Gefängnisdirektor mit ihm eine lange Liste an Sicherheitsvorkehrungen durchging. Der Gefängnisdirektor, ein Oberst mittleren Alters namens Ibrahim, warnte Sabha, dass man bei solchen Insassen unter allen Umständen auf der anderen Seite der Gitterstäbe bleiben müsse. Das gelte auch und gerade für ärztliche Untersuchungen; Sabha solle bloß nicht glauben, eine Metalltür sei Schutz genug.
»Diese Leute sind äußerst gefährlich«, sagte Ibrahim. »Selbst wenn sie physisch nicht gefährlich sind, so sind sie in der Lage, einen mental zu beeinflussen. Sogar ich muss ständig auf der Hut sein, mich nicht von ihnen einlullen zu lassen.«
Dann ging der Direktor auf die Besonderheiten der Neuankömmlinge ein, angefangen bei ihrer seltsamen Kleidung – die meisten bestanden darauf, eine Robe im afghanischen Stil über ihrer Gefängnisuniform zu tragen, weil sie die eng anliegenden Hosen für unzüchtig hielten – bis hin zu ihrem Talent, die schlimmsten Gewaltverbrecher und sogar Angehörige der Vollzugsbeamten zu Konvertiten zu machen. In Swaqa standen am Ende so viele Wachen unter ihrem Bann, dass die Gefängnisleitung in jedem Sektor, wo sich diese Insassen gerade aufhielten, alle 90 Minuten eine Wachablösung anordnen musste.
Am Ende seiner Ausführungen wiederholte der Direktor noch einmal seine Warnung vor den Gefangenen. Besonders ein Insasse – offensichtlich der Anführer der Sekte – verfüge über eine wirklich außergewöhnliche Verführungskraft. Er heiße Maqdisi und sei ein religiöser Gelehrter sowie ein sehr begabter Prediger, der in die Köpfe seiner Gegenüber eindringen und sie mit seinen Irrlehren infizieren könne wie ein muslimischer Rasputin.
»Er ist sehr klug, eine wandelnde Bibliothek islamischen Wissens«, sagte Ibrahim. »Das werden Sie selbst feststellen, wenn Sie ihn sehen. Ein gutaussehender Mann, groß und schlank, mit hellbraunem Haar und blauen Augen. Lassen Sie sich nicht von ihm einwickeln!«
Kurz darauf wurde Basel al-Sabha ins Gefängnisinnere geleitet, vorbei an Wachtürmen und bewaffneten Aufsehern, bis zu dem Bereich, wo die Gefangenen eingesperrt waren. Es war längst dunkel, und durch die Gitterstäbe der Tür fiel nur ein schwacher Lichtschein, als sich der junge Arzt der Zelle näherte. Als er die Umrisse der Etagenbetten wahrnahm, erblickte er auch zum ersten Mal die Gefangenen.
48 Insassen saßen aufrecht auf ihren Pritschen oder Gebetsteppichen. Sie waren allesamt in gespannter Aufmerksamkeit der Tür zugewandt, wie Gefreite, die darauf warten, dass der Spieß ihre Stube inspiziert. Alle trugen sie die gleiche eigentümliche Uniform, eine locker sitzende Robe über der blauen Standard-Gefängniskleidung, Hemd und Hose, genau wie der Direktor es ihm angekündigt hatte. Doch dann merkte Sabha, dass sie gar nicht zur Tür schauten: Ihre Augen waren auf etwas oder jemanden neben der Tür gerichtet. Sabha ging noch näher heran, um zu sehen, wer oder was sich dort befand.
An der Stirnseite der Zelle standen zwei Männer. Der eine war groß und schlank und trug eine Brille, die ihm eine intellektuelle Ausstrahlung gab, seine Gebetskappe saß auf einem wirren Schopf hellbrauner Haare. Das musste Maqdisi sein, der charismatische Anführer des Zellenblocks, von dem der Direktor gesprochen hatte. Trotzdem schien eher der andere alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Er hatte dunkleres Haar und war von gedrungener, kräftiger Statur, hatte einen Stiernacken und Schultern, die zu einem Ringer oder Turner gepasst hätten. Nur wenige Meter von dem Mann entfernt, fiel Sabha auf dessen rechtem Arm eine ungewöhnlich gezackte Narbe auf, dunkel verfärbt wie ein altes Hämatom. Die faltige Haut um die Narbe herum ließ vermuten, dass ein Amateur die Wunde genäht hatte.
Der Träger der Narbe ließ seinen Blick eine Weile stumm über die Reihen der Etagenbetten schweifen. Dann drehte er sich um und fixierte den Besucher. Sein fleischiges Gesicht wirkte an sich eher gewöhnlich, die vollen Lippen umrahmte ein dünner Bart. Doch als Sabha ihm in die Augen sah, wusste er: Diese Augen würde er nie wieder vergessen. Sie lagen tief in ihren Höhlen und wirkten im gedämpften Licht der Zelle fast schwarz, und doch offenbarten sie eine kalte Intelligenz. Wachsam und ohne eine Spur der Gefühlsregung sondierte er seine Umgebung. Sein Blick wirkte weder einladend noch feindlich, eher wie der Blick einer Schlange, die eine fette Maus betrachtet, die man ihr gerade in den Käfig geworfen hat.
Schließlich unterbrach der Gefängnisdirektor die Stille. Er murmelte ein paar Worte, um den Häftlingen den neuen Arzt vorzustellen, und verkündete, dass sie sich ab sofort untersuchen lassen können. »Alle Gefangenen mit medizinischen Beschwerden vortreten«, befahl er.
Sabha näherte sich der Tür noch ein Stück und rechnete mit dem unvermeidlichen Ansturm. Er hatte sich auf diesen Moment vorbereitet und eine Auswahl an Pillen und Salben dabei, zur Behandlung von Hautausschlägen, kleineren Wunden, Allergien und Magen-Darm-Beschwerden, wie sie meistens auftraten, wenn so viele Menschen in enger Gefangenschaft zusammenlebten. Doch zu seiner Überraschung rührte sich niemand. Die Insassen blieben regungslos sitzen. Offensichtlich warteten sie auf ein Zeichen von dem Mann mit der Narbe. Jener schaute schließlich einen Mann an, der auf einem Bett im vorderen Bereich der Zelle saß und nickte kurz. Der Häftling stand auf und ging, ohne einen Ton von sich zu geben, zur Tür. Der Narbige nickte ein zweites und ein drittes Mal, und weitere Insassen erhoben sich.
Fünf Männer stellten sich hintereinander vor dem Arzt auf, nur fünf, und der Mann mit der Narbe hatte noch immer kein einziges Wort gesprochen. Dann wandte er sich um und sah wieder den Arzt an, mit demselben reptilienhaften Blick wie zuvor – dem Blick eines Mannes, der selbst hier, in Jordaniens schlimmstem Gefängnis, absolute Macht besaß.
Sabha fühlte sich unwohl. Ihm war, als spüre er, wie das Fundament der alten Festung unter seinen Füßen leicht zu zittern begann. »Was ist das für ein Mensch«, fragte er sich, »der nur mit seinem Blick Befehle erteilt?«
In den folgenden Tagen ging der junge Arzt die Akten seiner neuen Patienten durch. Vor allem wollte er wissen, weshalb sich die Vollzugsbeamten so sehr vor ihnen fürchteten. Der Kern der Gruppe bestand, wie er herausfand, aus etwa zwei Dutzend Männern, die einer Anfang der 1990er-Jahre in Jordanien entstandenen radikal-islamischen Sekte angehörten. Mit Ausnahme ihres Anführers Abu Muhammad al-Maqdisi – einem Hassprediger, der bekannt dafür war, gegen arabische Staatsmänner zu wettern – wirkte der Hintergrund der Männer eher uninteressant. Einige waren Kleinganoven und Schläger gewesen, die zur Religion gefunden hatten und von den Eiferern mit offenen Armen empfangen worden waren. Andere waren Angehörige der arabischen Freiwilligen-Armee gewesen, die in den 1980er-Jahren in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft hatte. Wieder daheim im sicheren, politisch stabilen Jordanien fühlten sich diese Männer zu bestimmten Organisationen hingezogen, die ihnen die Möglichkeit boten, ihren glorreichen Kampf gegen die Russen fortzusetzen – als heiligen Krieg gegen die Feinde des Islam.
Ihre Bemühungen, in Jordanien einen Dschihad zu entfachen, waren alles andere als glorreich. Die Anführer von Maqdisis kleiner Gruppe waren verhaftet worden, noch bevor sie ihre erste Aktion, den Angriff auf einen israelischen Grenzposten, durchführen konnten. Zu den Zielen der anderen Gruppen gehörten eher unbedeutende Symbole westlicher Korruption, von Videotheken über Spirituosengeschäfte bis hin zu Pornokinos. Schon früh war ein geplanter Sprengstoffanschlag auf spektakuläre Weise gescheitert: Ein Mitglied der Gruppe hatte sich bereit erklärt, in einem örtlichen Kino namens Salwa, das Filme »nur für Erwachsene« zeigte, eine Bombe zu legen. Der Attentäter nahm im Zuschauerraum Platz, doch nach ein paar Minuten war er so versunken in das, was sich auf der Leinwand abspielte, dass er seine Bombe komplett vergessen hatte. Als sie detonierte, saß er immer noch darauf. Andere Kinogäste wurden nicht verletzt, nur der Attentäter verlor beide Beine. Jetzt, sechs Jahre später, gehörte der Amputierte zu Sabhas Patienten im Gefängnis. Gleich beim ersten Besuch war er dem Arzt aufgefallen, wie er auf seinem Bett saß, die Hosenbeine ordentlich an den Knien festgesteckt.
Inzwischen befanden sich fast alle Häftlinge seit mindestens vier Jahren in Al-Dschafr. Doch falls jemand geglaubt hatte, die Dschihadisten durch den Aufenthalt im Gefängnis brechen und ihre Organisation schwächen zu können, wurden seine Erwartungen enttäuscht. Zumeist in denselben Zellen eingepfercht, wurden sie durch die gemeinsamen Entbehrungen sowie den täglichen Kampf, sich unter Drogendealern, Dieben und Mördern als religiöse Puristen zu behaupten, noch mehr zusammengeschweißt. Sie verfolgten ein gemeinsames Credo, eine besonders strenge Ausrichtung des Islam, die Maqdisi initiiert und seinen Anhängern während ihrer schier endlosen Haft eingeimpft hatte. Außerdem besaßen sie eine ungewöhnlich strenge Disziplin. Die Gruppe verhielt sich wie eine militärische Einheit, es gab eine klare Hierarchie, und alle gehorchten blindlings Maqdisis rechter Hand: dem Mann mit der breiten Brust und der Narbe, der Sabha bei seinem ersten Besuch im Gefängnis so beeindruckt hatte. Während Maqdisi den Männern sagte, was sie zu denken hatten, kümmerte sich sein Vollstrecker um alles andere – darum, wie die Männer sprachen und wie sie gekleidet waren, welche Bücher sie lasen und was sie sich im Fernsehen ansahen, ob sie sich an die Vorschriften des Gefängnisses hielten oder dagegen verstießen, wann und auf welche Weise sie gegen wen kämpften. Dieser Mann hieß Ahmad Fadil al-Chalaila, aber er ließ sich lieber »al-Gharib«, »der Fremde«, nennen, ein Spitzname, den er sich während seiner Zeit als Kämpfer im afghanischen Bürgerkrieg zugelegt hatte. Einige sprachen jedoch bereits damals von dem »Mann aus Zarqa«, einer Industriestadt im Norden von Jordanien, wo er aufgewachsen war, auf Arabisch: »az-Zarqawi«.
Sabha konnte die beiden Anführer der Gruppe aus nächster Nähe beobachten. Der Maqdisi, dem er begegnete, war nett und freundlich, wirkte eher wie ein liebenswürdiger Professor als wie ein mitreißender Mystiker. Er war fast 40 und machte den Eindruck eines Intellektuellen, der den Umgang mit den vielen rückwärtsgewandten Männern in seiner Zelle leid war und glaubte, eigentlich etwas Besseres zu verdienen. Großzügig verteilte er religiöse Ratschläge und die gelegentliche Fatwa (eine religiöse Rechtsauskunft), aber die meiste Zeit über zog er es vor, allein zu sein. Dann schrieb er Aufsätze oder las im Koran. Auf den gedruckten Seiten erschien Maqdisi als furchtloser Kämpfer: Er war in der gesamten muslimischen Welt als Autor von reißerischen Büchern mit Titeln wie ad-Dimuqratiya din (»Demokratie ist eine Religion«) bekannt, worin er die säkularen arabischen Staaten als anti-islamisch brandmarkte und zu ihrer Vernichtung aufrief. Seine Arbeit stieß unter Islamisten auf eine derart große Resonanz, dass eine 2006 vom Pentagon in Auftrag gegebene Studie Maqdisi als »wichtigsten zeitgenössischen Ideologen im Universum der intellektuellen Dschihadisten« bezeichnete.
Natürlich hatte es schon früher islamistische Vordenker gegeben, die einzelne Staatenlenker der arabischen Welt als korrupt und abtrünnig denunzierten. Ein gutes Beispiel ist Sayyid Qutb, ein einflussreicher ägyptischer Autor, dessen Schriften die Gründer von Al-Qaida inspirierten. Anders als Qutb war Maqdisi jedoch der Ansicht, dass jeder Muslim zum persönlichen Handeln verpflichtet sei, wenn er Zeuge staatlicher Ketzerei wurde. Seiner Meinung nach reichte es für einen gläubigen Menschen nicht aus, korrumpierte Herrscher einfach nur als solche bloßzustellen. Allah wolle, dass sie sterben.
»Seine radikale Schlussfolgerung war, dass die politischen Anführer Ungläubige seien und Muslime sie töten müssen«, so Hasan Abu Hanieh, ein jordanischer Schriftsteller und Intellektueller, der mit Maqdisi in der Zeit befreundet war, als bei jenem die radikalen Ideen langsam Gestalt anzunehmen begannen. »Das ›Töten‹ war der Wendepunkt. Diese Botschaft fand großen Anklang bei Muslimen, die das Gefühl hatten, die Regime seien dumm und hätten Ausländern die Besetzung der arabischen Länder erlaubt. Diesen Menschen machte Maqdisi klar, dass sie nicht nur richtig lagen mit ihren Ansichten, sondern dass sie auch die Pflicht hatten, an der gegenwärtigen Situation aktiv etwas zu ändern.«
Doch eines war seltsam: Eben dieser Mann, der so schamlos zum Kampf gegen die Feinde des Islam aufrief, ging persönlich allen Konflikten aus dem Weg. Sabha beobachtete, wie Maqdisi Vernehmungsbeamte oder Agenten vom Geheimdienst, die das Gefängnis besuchten, stets höflich grüßte und sich nach ihren Familien erkundigte – sehr zum Entsetzen anderer Insassen, die von diesen Männern misshandelt worden waren. Ganz geduldig erklärte er Wachen und Vollzugsbeamten, warum sie und ihre Regierung Ketzer seien, und unterfütterte seine Argumente mit Zitaten aus dem Koran. Doch wenn ihm jemand Kontra bot, strich er ganz schnell die Segel und gab zu, auch weniger strenge Interpretationen der Heiligen Schrift könnten gültig sein.
»Sie können sogar Parlamentarier sein und trotzdem ein guter Muslim«, sagte er einmal zu Sabha – eine Aussage, die seiner zentralen These über die Übel nicht-theokratischer Regierungsformen direkt zu widersprechen schien. »Wenn sich jemand wählen lässt, weil er den Menschen dienen will, dann ist er ein guter Muslim. Aber wenn er an die Demokratie glaubt – daran, dass von Menschen erdachte Grundsätze das Zusammenleben regeln sollen – dann ist er ein Ungläubiger.«
Maqdisi wirkte durchaus angetan von dem jungen Arzt. Auch wenn jener kein Mann des Glaubens war, so war er doch die einzige weitere Person in Al-Dschafr mit einem höheren Bildungsabschluss. Die entscheidende Wende nahm ihre Beziehung, als eines Tages die jüngste von Maqdisis Ehefrauen bei einem Besuch im Gefängnis erkrankte. Die Frau erlitt eine ungewöhnliche Menstruationsblutung, und Sabha ließ sie zur Untersuchung in seine Praxis im Dorf bringen. Das allein hätte schon für einen Skandal sorgen können – viele ultrakonservative muslimische Männer lassen ihre Frauen niemals von männlichen Ärzten untersuchen. Maqdisi hingegen war ehrlich dankbar. Ab diesem Tag wurde der Arzt bei seinen Besuchen im Zellentrakt viel freundlicher begrüßt.
Doch Höflichkeit und Intellekt sind denkbar ungeeignete Mittel, um an einem so extremen Ort wie Al-Dschafr eine Horde Männer zu kommandieren. Maqdisi brauchte jemanden, der die anderen zum Spuren brachte: einen Vollstrecker. Und in Zarqawi hatte er den perfekten Helfer gefunden – jemanden, der sich durch sklavische Ergebenheit gegenüber Maqdisi und völlige Skrupellosigkeit gegenüber allen anderen auszeichnete. »Er ist ein harter Typ«, sagte Maqdisi voller Bewunderung über seinen Stellvertreter, »und er ist ein echter Jordanier – einer von unserem Stamm«.
Ihre Persönlichkeitsstruktur hätte kaum unterschiedlicher sein können. Zarqawi hatte für zwischenmenschliche Nähe nichts übrig. Der Mann mit der Narbe lächelte nie. Wenn man ihn im Gefängnis grüßte, dann grüßte er nicht zurück, jeden Smalltalk lehnte er ab. Wenn er überhaupt sprach, dann in der Gossensprache eines Raufbolds und Kleinkriminellen, der in einem von Zarqas rauesten Stadtvierteln aufgewachsen war und früh die Schule abgebrochen hatte. Seit seiner Kindheit galt er als Unruhestifter, und seine rohen Umgangsformen sowie die Verweigerung jeder Art von Konvention trugen dazu bei, dass Zarqawi schon mit etwa 30 Jahren einen besonderen Ruf genoss und sich die ersten Legenden um ihn bildeten.
Während Maqdisi sich lieber mit Bücher und Ideen beschäftigte, war Zarqawi ein rein physischer Mensch. Seinen stämmigen, muskulösen Körper stählte er durch das Heben improvisierter Langhanteln, die aus mit Steinen gefüllten Eimern bestanden. Die hinter vorgehaltener Hand kursierenden Geschichten über seine kriminelle Vergangenheit – Messerstechereien und Schlägereien, Zuhälterei und Drogenhandel – ließen ihn gefährlich und unberechenbar erscheinen. Er war ein Mann der Tat, der vor nichts zurückschreckte.
In Afghanistan hatte er tapfer, aber mitunter auch recht rücksichtslos gekämpft, und sein Ruf als jemand, der impulsiv Gewalt einsetzte, begleitete ihn bis in seine Haft. In den ersten Gefängnissen, wo er und die anderen einsaßen, hatte er es sich angewöhnt, sich, wo es nur ging, der Obrigkeit zu widersetzen, und er hatte jeden, der ihm im Weg stand, seine Brutalität spüren lassen: mit Fäusten oder primitiven Waffen und manchmal sogar, wie man sich des Öfteren erzählte, auf sexuelle Weise. Einmal hatte er in seiner Wut einen Gefängniswärter am Uniformkragen gepackt und an einem Kleiderhaken aufgehängt. Ein anderes Mal war er der Rädelsführer von Ausschreitungen, bei denen die Insassen sich mit aus Bettrahmen gebauten Knüppeln bewaffnet hatten. »Wir sind hergekommen, um zu sterben!«, hatten die Gefangenen geschrien, und einige hätten damit sicherlich auch Recht gehabt, hätte die Anstaltsleitung nicht rechtzeitig eingegriffen und zahlreichen Forderungen der Dschihadisten nachgegeben.
Unter Maqdisis schützender Hand schien Zarqawi ruhiger zu werden, doch seine gewalttätige Energie blieb und änderte einfach nur ihre äußere Form. Zarqawi begann, den Koran auswendig zu lernen; Stunde um Stunde las er nun, manchmal starrte er auch einfach nur mit leerem Blick das aufgeschlagene Buch in seinem Schoß an. Seine zuvor so diffuse Wut richtete sich jetzt auf ein konkretes Ziel: Sie wurde zum Hass auf alle, die er für Feinde Allahs hielt. Und die Liste war lang. Ganz oben stand Jordaniens König Hussein, den Zarqawi für den illegitimen Anführer eines Landes mit künstlich gezogenen Grenzen hielt und der für ein unaussprechliches Verbrechen verantwortlich war: Er hatte Frieden mit Israel geschlossen. Es folgten die Schergen des Regimes wie Wachen, Soldaten, Politiker, Bürokraten und unzählige weitere Personen, die vom aktuellen System profitierten. Sogar manche Gefängnisinsassen denunzierte er als kuffar (»Ungläubige«). Für Muslime ist dieser Begriff mehr als bloß ein Epitheton: Wird er in einer Fatwa verwendet, so bedeutet dies, dass die betreffende Person den Schutz des islamischen Rechts verloren hat und ungestraft getötet werden darf. Im Gefängnis nannten die Wachen Zarqawi und seine engsten Anhänger schon bald »al-takfiris« – »die Exkommunikatoren«. Zugleich begann Zarqawis Aufstieg zu einem einflussreicheren Anführer unter den inhaftierten Islamisten. Er forderte von den Männern absoluten Gehorsam, und er beschimpfte sie, wenn sie ein Gebet ausließen oder sich im Fernsehen Nachrichtensprecherinnen ansahen, die nicht verschleiert waren. Dass er trotz seines rüden Umgangstons so viele Bewunderer hatte, lag an seiner unerschrockenen Haltung gegenüber der Strafvollzugsbehörde. Wenn irgendwelche offiziellen Besucher nach Al-Dschafr kamen, ignorierte Zarqawi sie oft und verweigerte ihnen den Gruß. Dasselbe befahl er seinen Männern.
Als die jordanische Regierung zugestimmt hatte, die Strafvollzugsanstalten des Landes für die Inspektion durch internationale Menschenrechtsorganisationen zu öffnen, traf eines Tages ein ranghoher Beamter des Innenministeriums in Al-Dschafr ein, um sich über die dortigen Haftbedingungen zu informieren und die Insassen zu bitten, den Ausländern gegenüber nichts Negatives zu äußern. Die Islamisten weigerten sich, seine Fragen zu beantworten, geschweige denn ihn auch nur anzuschauen.
Zuerst wies der entrüstete Beamte die Männer zurecht, dann versuchte er, sich bei ihnen einzuschmeicheln und sagte, wenn sie sich kooperativ zeigten, könne sich das strafmindernd für sie auswirken.
»So Gott will, wird König Hussein euch begnadigen!«, sagte er.
Plötzlich stand Zarqawi auf und streckte seinen Finger aus bis knapp vor das Gesicht des Bürokraten. »Dein Herr ist nicht unser Herr«, fauchte er. »Unser Herr ist Allah, der Allmächtige.«
Der Besucher wurde fuchsteufelswild. »Ich schwöre bei Gott, ihr kommt hier nicht mehr heraus!«, rief er. »Ihr werdet für immer in diesem Gefängnis bleiben!«
»Bei Allah«, antwortete Zarqawi kalt. »Wir kommen hier heraus. Mit Gewalt, so Gott will.«
Manchmal zeigte Zarqawi auch eine ganz andere Seite. Sabha bekam während seiner Besuchszeiten im Gefängnis gelegentlich etwas davon mit. Diese Seite passte kaum zu Zarqawis sonstigem Verhalten; fast schien es, als litte er unter einer gespaltenen Persönlichkeit.
Jeder in Al-Dschafr wusste, wie sehr Zarqawi seine Mutter verehrte und dass er sich immer wie ein kleiner Junge benahm, wenn sie ihn besuchte. Schon Tage vorher schrubbte er im Spülstein seine Kleidung und räumte in der Gemeinschaftszelle seinen Bereich auf. Einige Insassen kannten seine gefühlvollen Briefe an sie und seine Schwestern. Zarqawis Ehefrau Intisar und ihre zwei gemeinsamen kleinen Kinder kamen bei ihm nur selten zur Sprache; seiner Mutter und seinen Schwestern dagegen schrieb er überschwängliche Zeilen, ausgeschmückt mit Gedichten und umrahmt von gezeichneten Blumen.
»Oh Schwester, wie viel hast du gelitten durch meine Inhaftierung wegen meines Glaubens«, schrieb er an Umm Qadama in einem abwechselnd mit blauer und roter Tinte geschriebenen Brief mit sorgfältig gemalten Schriftzeichen. Seinen Brief schloss er mit einem Gedicht:
»Ich schrieb Dir einen Brief, meine Schwester,
Aus dem Wunsch meines Herzens heraus.
Das Erste, das ich Dir schreibe, ist meines Herzens Feuer,
Das Zweite sind meine Liebe und Sehnsucht.«
Die zweite Personengruppe, die von Zarqawi übertriebene Aufmerksamkeit erhielt, waren die Kranken und Verletzten unter seinen Männern. Erkrankte einer der Islamisten, verfiel Zarqawi in die Rolle des heroischen Krankenpflegers, der seine eigene Decke und seine Vorräte spendete, damit es dem Kranken besser ging. Ständig schaute er Sabha und einem zweiten Arzt, den die Vollzugsanstalt inzwischen angestellt hatte, über die Schulter und beschimpfte sie, wenn er das Gefühl hatte, sein Untergebener werde nicht so gut versorgt, wie er es verdiene. »Wo ist das Medikament, das Sie dem hier versprochen haben?«, brüllte er sie dann an, wie sich Sabha später erinnerte. Als einmal einer der Insassen Al-Dschafr für ein paar Tage verlassen hatte, um in der Klinik behandelt zu werden, führte sich Zarqawi wie ein nervöser Elternteil auf und nervte Sabha ununterbrochen mit der Frage, ob es etwas Neues über den Zustand des Mannes gäbe.
Vor allem aber staunte Sabha darüber, wie mitfühlend der Mann mit der Narbe mit dem Schwächsten der Insassen umging: Eid Dschahalin, jener Pechvogel, der beim missglückten Anschlag auf das Pornokino beide Beine verloren hatte. Dschahalin, der neben seiner körperlichen Versehrtheit auch noch unter einer psychischen Störung litt, hatte trotz seiner extremen Behinderung stets mit den anderen Islamisten die Zelle geteilt. Zarqawi kümmerte sich aufopfernd um ihn, er half ihm beim Waschen, beim An- und Auskleiden, beim Essen. Fast täglich konnte man zusehen, wie er den Beinlosen kurzerhand hochhob und zur Toilette trug. Sabha vermutete, dass dieses tägliche Ritual mindestens so viel mit Zarqawis sehr spezieller Auffassung von Anstand zu tun hatte wie mit echtem Mitgefühl für seinen Kameraden.
Nach dem strengen Moralkodex der Islamisten war es eine Demütigung und zugleich eine Sünde, den Körper eines Mannes im Beisein anderer Männer zu entblößen. Eines Abends besuchte Sabha die Zelle, gerade als Dschahalin einen seiner gelegentlichen Schreikrämpfe hatte, die man meist nur mit antipsychotischen Arzneimitteln in den Griff bekommen konnte. Sabha hatte schon seine Spritze ausgepackt und bereitete die Injektion vor, als sich auf einmal Zarqawi vor ihm aufbaute. Ohne ein Wort nahm Zarqawi aus einem der Betten eine Decke und legte sie über Dschahalins Unterkörper. Er hielt die Decke mit einer Hand fest und zog mit der anderen den elastischen Bund der Hose des Behinderten ein Stück weit herunter – gerade so viel, dass ein schmaler Streifen Haut zum Vorschein kam. Dann winkte er dem Arzt.
»Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Stelle erwischen«, wies er ihn an.
Sabha fühlte durch Dschahalins Kleidung nach dem Beckenknochen, fand ihn und schob die Nadel in das blasse Fleisch.
Als er fertig war und Dschahalin wieder ruhig, bemerkte Sabha, wie Zarqawis Blick auf ihm ruhte. Er sah zufrieden aus, doch da war noch etwas anderes in seinen Reptilienaugen – etwas, das dem Arzt vorher noch nie aufgefallen war. Fast glaubte Sabha, es könne der Ansatz eines Lächelns sein.
Mit den Minusgraden des Winters 1998 trafen ganze Scharen von Neuankömmlingen ein, die aus verschiedenen überfüllten Gefängnissen in anderen Landesteilen nach Al-Dschafr verlegt wurden. Die Islamisten blieben nach wie vor zusammengepfercht, doch allmählich zeigten sich ein paar kleine Risse im Gefüge. Einige der Dschihadisten bekannten offen, sich Zarqawi als Anführer zu wünschen. Sie waren Maqdisi und sein professorenhaftes Gebaren langsam leid.
Auch wenn Zarqawi keinerlei Anstalten machte, sich gegen seinen Mentor aufzulehnen, trat die Haltung vieler Insassen immer deutlicher zutage. Mit Maqdisis nuancierten theologischen Argumenten konnten die Schulabbrecher und Kleinkriminellen, aus denen die Gruppe größtenteils bestand, wenig anfangen. Sie wollten einen robusten Typen, der sich auf der Straße behaupten konnte, einen Streithahn, der stets deutliche Worte fand und keine Kompromisse einging – kurz: einen wie Zarqawi. Maqdisi gab selbst zu, kein Krieger zu sein. Damals, in den arabischen Ausbildungscamps in Afghanistan, war es ihm einfach nicht gelungen, zu lernen, wie man eine Waffe benutzt.
»Er war kein Kämpfer, der zwischen Kugeln, Raketen und Panzern leben konnte«, erklärte später einer der Afghanistanveteranen. »Nicht einmal einen Tag lang.«
Augenscheinlich gefiel es Zarqawi, den Ton anzugeben. Während Maqdisi für die geistlichen Belange zuständig blieb, übernahm er mit dem Segen seines Mentors allmählich eine dominantere Rolle. Zum ersten Mal wurden nun einflussreiche Menschen außerhalb des Gefängnisses auf ihn aufmerksam. Maqdisi hatte unter den Islamisten in der Diaspora, von London bis hin zu den palästinensischen Städten der Westbank, zahlreiche Bewunderer. Einige von ihnen verfügten über stattliche Ressourcen und waren im gesamten Nahen Osten, in Nordafrika und Europa gut vernetzt. Ihnen blieb nicht verborgen, dass Maqdisis rechte Hand im Gefängnis ein Afghanistanveteran war, der als außergewöhnlich mutig sowie als echte Führernatur galt.
Inzwischen hatte Sabha immer mehr mit Zarqawi zu tun. Ihre Beziehung wurde zunehmend herzlicher, auch wenn sie nicht direkt freundschaftlich miteinander umgingen.
Eines Abends, als Sabha seine gewöhnliche Runde machte, zog Zarqawi den Arzt beiseite. Er hatte eine Bitte, bei der es zum ersten Mal nicht um einen seiner Männer, sondern um ihn selbst ging.
»Ich glaube, ich habe hohe Blutzuckerwerte«, begann er. »Meine Mutter hat Diabetes, vielleicht liegt das in der Familie. Können Sie das testen?«
Sabha half natürlich gerne, aber die Sache war nicht ganz einfach. Der entsprechende Test konnte nicht im Gefängnis durchgeführt werden, denn die von Ratten verseuchten Zellen in Al-Dschafr waren so schmutzig, dass man dort kein Blut abnehmen konnte – das Infektionsrisiko war zu hoch. Man würde Zarqawi zur Arztpraxis im Dorf bringen müssen.
Damit stellte sich ein weiteres Problem: die behördliche Genehmigung, die nötig war, wenn ein so gefährlicher Häftling wie Zarqawi die Anstalt kurzzeitig verlassen sollte. Wie zu erwarten, war der Gefängnisdirektor alles andere als begeistert. Was, wenn das Ganze nur ein Trick war, um Zarqawi zu befreien? Was, wenn sie im Ort von seinen Verbündeten in einen Hinterhalt gelockt wurden? Doch schließlich willigte Ibrahim ein, und man bereitete eine bewaffnete Eskorte vor, die den Gefangenen in die Arztpraxis und wieder zurück begleiten würde.
Am Tag der Untersuchung blieb Sabha in seiner Praxis, um auf seinen Patienten zu warten. Erst weit nach Einbruch der Dunkelheit fuhr ein Konvoi von zehn Fahrzeugen vor, umringt von Dutzenden mit Sturmgewehren bewaffneten Wachen. Es war die größte Militäreskorte, die Sabha je gesehen hatte, sodass er zunächst glaubte, jemand vom Königshof hätte sich in sein Dorf verirrt. Stattdessen stolperte ein einziger Gefangener aus einem der Kastenwagen und verschwand sofort wieder in einem Kokon bewaffneter Soldaten, der sich langsam auf das Haus zubewegte.
Zarqawi wurde in den Behandlungsraum geführt. Er trug seine Sträflingskleidung und war mit Handschellen gefesselt.
»Bitte nehmen Sie die ab«, bat Sabha und deutete auf die metallenen Armbänder.
»Aber der Mann ist gefährlich«, protestierte einer der Begleiter.
»Sie sind mit 50 Soldaten hier, die jede seiner Bewegungen beobachten«, gab der Arzt zurück. »Ich bestehe darauf, dass Sie dem Patienten die Handschellen abnehmen.«
Man befreite Zarqawi von seinen Fesseln, und Sabha begann mit der Untersuchung. Als er einen der Ärmel des Gefangenen hochkrempeln wollte, um die Blutprobe zu nehmen, wurde er jedoch schon wieder aufgehalten, diesmal von Zarqawi.
»Es tut mir leid.« Zarqawi rollte seinen Ärmel wieder herunter. Dann rollte er ihn wieder nach oben, diesmal ohne Hilfe. Sabha hatte abermals gegen eine von Zarqawis schwer nachvollziehbaren Regeln verstoßen und die nackte Haut des Mannes berührt.
Nach der Blutprobe brachte Sabha zum ersten Mal den Mut auf, Zarqawi zu fragen, woher die mysteriöse Narbe auf seinem Arm stamme.
»Das war eine Tätowierung«, gab er zurück. »Ein Anker.«
»Was ist passiert?«
Zarqawi erzählte, wie er sich mit 16 Jahren habe tätowieren lassen, zu einer Zeit, als er, wie er es ausdrückte, »nicht sehr islamisch gesinnt« war. Nachdem er sich der Dschihad-Bewegung angeschlossen hatte, schämte er sich so sehr für seine Tätowierung, dass er mit diversen Mitteln versuchte, sie zu entfernen, unter anderem mit Bleichmittel. Davon wurde zwar die Haut rot und entzündete sich, doch das Tattoo blieb, wo es war.
Schließlich ließ er sich von einem seiner Verwandten aus Zarqa eine Rasierklinge in das Gefängnis schmuggeln, in dem er damals inhaftiert war. Der Verwandte schnitt Zarqawi um die Tätowierung herum zwei elliptische Linien in den Arm und schälte dann die oberen Hautschichten ab. Als das meiste vom Tattoo fort war, nähte er die Wunde mit ein paar groben Stichen zu.
Man konnte Sabha sein Entsetzen über diese Geschichte ansehen, aber Zarqawi zuckte nur mit den Schultern, als sei der Schnitt eines Fleischstücks aus dem eigenen Leib so normal wie das Zertreten einer Kakerlake. Schließlich gebot es der Islam – oder besser: seine Auffassung vom Islam. Das war eine unbestreitbare Tatsache, der Rest war nichts als Willenskraft.
»Tätowierungen«, erklärte er ungerührt, »sind haram. Verboten.«
Sabha beendete seine Untersuchung, und Zarqawi, der keinerlei Anzeichen eines körperlichen Gebrechens zeigte, wurde von seinen Begleitern wieder ins Gefängnis gebracht. Der Arzt blieb zurück und grübelte vor sich hin, in seiner kleinen Praxis an der Straße am Rande eines toten Sees, der mit der riesigen arabischen Wüste im Hintergrund geradezu winzig erschien.
70 Jahre zuvor war eine islamische Armee auf eben jener Straße in Richtung Norden unterwegs, auf Pferden und Kamelen, um das Land, das man Jordanien nannte, im Namen Allahs auszulöschen. Die Armee bestand aus Beduinen, die sich als Ichwan, »Brüder«, bezeichneten. Saudi-Arabiens erster Monarch, Ibn Saud, hatte sie ausgebildet und bewaffnet, um mit ihrer Unterstützung seine politischen Rivalen zu erledigen. Aber die Ichwan hatten eigene Pläne, und die beschränkten sich längst nicht nur auf die Arabische Halbinsel. Sie waren blutrünstige Fanatiker, die alle Erfindungen und Praktiken des Westens als Teufelswerk ansahen und sich selbst für die Vollstrecker Gottes hielten; die die Region von allen Subjekten säubern wollten, die sich mit Ausländern verbündeten oder in anderer Weise von ihrer engstirnigen Auslegung des Islam abwichen. Vom unwirtlichen Ödland im Binnenland aus fielen sie Anfang der 1920er-Jahre in die neuen Länder Jordanien und Irak ein, um deren Regierungen zu stürzen und eine einheitliche islamische Theokratie zu schaffen: ein Kalifat, das den gesamten Nahen Osten umfassen sollte. Auf ihrem Weg überrannten sie ganze Dörfer und schnitten allen überlebenden Männern die Kehle durch. So wollten sie sicherstellen, dass auch die letzten Spuren westlicher Moderne vernichtet sind.
Während der saudische Monarch vergeblich versuchte, die Kontrolle über sie zu behalten, arbeitete sich die rund 1500 Kämpfer umfassende Ichwan-Armee immer weiter vor. Erst 10 Meilen vor Amman, der jordanischen Hauptstadt, konnte sie aufgehalten werden – britische Kampfflugzeuge hatten die heranrückenden Horden entdeckt und mähten sie mit Maschinengewehren nieder. Nur etwa 100 der Angreifer überlebten.
Noch bis in die 1950er-Jahre hinein beherrschten kleinere militante Gruppen Teile des saudi-arabischen Binnenlands. Fremde, die in der Nähe ihrer Dörfer auftauchten, wurden bedroht und mitunter auch getötet. Schließlich verschwanden die Ichwan, doch der unbändige Hass, der sie angetrieben hatte, starb nicht mit ihnen – im Gegenteil.
Die unerschütterliche Intoleranz der Ichwan und ihre extreme, unbarmherzige und gewalttätige Auffassung vom Islam als eine Art reinigendes Feuer setzte sich bis ins späte 20. Jahrhundert und noch weiter fort. Der Hass überlebte in den abgelegenen Dörfern im Inneren der Arabischen Halbinsel, aber auch in den ölreichen Städten an der Küste des Golfs, im zerklüfteten Gebirge im Osten Afghanistans und nicht zuletzt in den überfüllten Zellen eines berüchtigten jordanischen Gefängnisses.
In Al-Dschafr blieb der Hass hinter dicken Gefängnismauern eingeschlossen – zumindest vorerst. Nach dem Urteil des Richters in Amman hatte Zarqawi hier noch weitere 10 Jahre abzusitzen, bis 2009. Dann würde der muskulöse, vitale Mann nicht mehr ganz so jung sein. Doch wie Sabha wusste, blieb in Jordanien nur selten jemand so lange hinter Gittern, wie es der Richterspruch ursprünglich vorsah. Schon oft waren Haftstrafen aufgrund eines Regierungswechsels drastisch verkürzt worden; mitunter reichte es sogar, dass sich die Obrigkeit die Gunst einer bestimmten religiösen Partei oder eines Stammes sichern wollte. In einem solchen Fall könnten Zarqawi und seine persönliche Armee von Anhängern plötzlich wieder auf freiem Fuß sein.