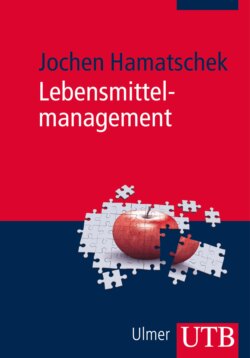Читать книгу Lebensmittelmanagement - Jochen Hamatschek - Страница 20
3.1.2 Ernährung 2.0: Die Neolithische Revolution vor 10 000 Jahren
ОглавлениеVor rund 10 000 Jahren, in der Tagesbetrachtung gerade sechs Minuten vor Mitternacht, folgte nach der Machtergreifung über das Feuer die zweite Revolution. War die erste Phase noch von einer physiologischen Anpassung geprägt, wälzte die zweite Phase die kulturelle Situation des Menschen um: Homo sapiens wurde sesshaft, wandelte sich vom Jäger und Sammler allmählich zum Ackerbauern und Viehzüchter und konnte sich von den zufälligen Produkten des Landes emanzipieren. Statt sich Nahrung nur anzueignen, produzierte er sie. Über die Gründe für diesen Schritt wird intensiv diskutiert. Als einen möglichen Grund sehen Archäologen die Gier des Menschen nach alkoholischen Getränken, die für rituelle oder kommunikative Zwecke nachweisbar schon seit langer Zeit aus vergorenen Getreideprodukten gewonnen wurden. Zweifellos war die Rohstoffbeschaffung über eigene Äcker einfacher als die mühsame Suche nach einzelnen Körnern in der Wildnis. Dieser Ausgang aus der ernährungswirtschaftlichen Unmündigkeit führte zu dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen. Der nun ortsfeste Mensch konnte sich stärker vermehren als zuvor, was aber schnell zur Ausbildung von Hierarchien und zur Eigentumsdifferenzierung in stetig wachsenden Gemeinschaften führte. Die Jäger und Sammler lebten in Horden mit selten mehr als fünfzig Mitgliedern, die fast alle miteinander verwandt waren. In den nun viel größeren Gemeinschaften entstand sozialer Druck. In der Folge kam es zwangsläufig zu Auseinandersetzungen und bereits zu ersten Gewaltverbrechen.
Andererseits führte die nun mögliche Arbeitsteilung zu ausgeprägtem Spezialistentum und in der Folge zu einer Fülle von Innovationen. Nach und nach wurden ertragsunsichere Wildformen der Pflanzen und Tiere züchterisch domestiziert und grundlegend, manchmal bis zur Unkenntlichkeit, verändert. Die Konzentration auf vergleichsweise wenige Arten mit besonders positiven Eigenschaften führte bereits in dieser Phase zu einer abnehmenden Biodiversität. In Verbindung mit zum Teil gewaltigen Eingriffen wurde in nur wenigen Jahrtausenden eine Kulturlandschaft geschaffen, die mit der ursprünglichen Natur kaum noch etwas gemein hatte. Ein Prozess, der während der Industrialisierung und durch das gigantische Bevölkerungswachstum auf der Erde noch beträchtlich an Fahrt aufnahm (Reichholf 2008).
Der Schwerpunkt der menschlichen Ernährung verschob sich in Richtung der Kohlenhydrate, die nach dem Erhitzen vergleichsweise leicht verdaulich wurden. Wer es dann noch schaffte, über die Säuglingszeit hinaus die Milch von Rindern zu verwerten, besaß einen gewichtigen Überlebensvorteil. Die dazu nötige Laktosetoleranz ist eine vergleichsweise junge, durch genetische Mutation des Enzymsystems gewonnene Eigenschaft, die in Nordeuropa bei rund 80 Prozent der Bevölkerung anzutreffen ist, in Asien lediglich bei 20 Prozent.
Die Neolithische Revolution brachte dem Menschen nicht nur Vorteile: Die Nähe zu den Zuchttieren konfrontierte ihn mit deren Krankheiten, Erreger sprangen immer wieder auf den Menschen über. Auch heutzutage spielen diese Zoonosen in vielen Ländern noch eine wichtige Rolle. Die zunehmende Bevölkerungsdichte begünstigte die Verbreitung von Infektionen, Missernten führten aufgrund der Abhängigkeit von einem lokal begrenzten Anbau zu Hungersnöten. Dies ist bis in die jüngere Zeit hinein zu beobachten. So verursachte vor gerade mal 160 Jahren der Ausfall der Kartoffelernte in Irland eine Nahrungsknappheit, in deren Folge eine Million Menschen an Hunger starben und noch viel mehr zur Flucht aus ihrem Land gezwungen wurden. Der Gesundheitszustand der Bauern und Viehzüchter – verglichen mit dem der Jäger und Sammler – verschlechterte sich ebenfalls und die durchschnittliche Körpergröße sank. War der frühere Speiseplan noch extrem vielseitig und nährstoffreich, wurde er für die Siedler zunehmend einseitiger und ihre Versorgung mit Mikronährstoffen gestaltete sich problematisch.
Wenn heutzutage eine Diskussion über Natur und artgerechte Haltung geführt wird, darf sie die extremen anthropogenen Veränderungen im letzten halben Prozent der Menschheitsgeschichte nicht außer Acht lassen. Die kulturelle Entwicklung dieser 10 000 Jahre hat Fauna und Flora einschließlich der menschlichen Lebensverhältnisse und den Menschen an sich tief greifender verändert als die 2,4 Millionen Jahre zuvor. Was artgerecht ist, sowohl den Menschen als auch Tiere und Pflanzen betreffend, ist letztlich eine Frage des betrachteten Zeitraumes.