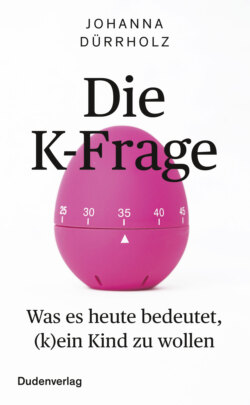Читать книгу Die K-Frage - Johanna Dürrholz - Страница 10
ОглавлениеWenn der Kinderwunsch dich zerreißt
Es gibt Menschen, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch leben müssen. Es gibt Menschen, die Kinder bekommen haben, obwohl sie eigentlich nie welche wollten. Es gibt Menschen, die überwinden Hürden und gehen steinige Wege, um sich ihren Wunsch nach Kindern zu erfüllen. Und es gibt Menschen, für die ist ein eigenes Kind die Erfüllung von allem, für die ist der Wunsch danach so groß, dass sie alles tun, um diese sie schier zerreißende Sehnsucht zu stillen; sie kämpfen bis zum Schluss. Katja ist so ein Mensch.
Katja, die eigentlich anders heißt, ist fünfundzwanzig Jahre alt, als sie zum ersten Mal ein Baby im Arm hält. Ihre Studienfreundin hat ein Kind bekommen, Notkaiserschnitt, vom Vater ist sie getrennt – also kommt Katja vorbei, um ihr beizustehen. Ihre Freundin kann ihr eigenes Baby nicht halten, ihr geht es körperlich zu schlecht. Katja nimmt stattdessen das Neugeborene auf den Arm. Sie hatte bis dahin eigentlich keinen Kontakt zu Kindern, ein Baby steht definitiv nicht auf ihrem Plan. Doch jetzt steht sie im Krankenhaus, neben dem Bett ihrer Freundin, und hält dieses winzig kleine Wesen fest. In dem Moment macht es klick. Sie weiß sofort: Das wünscht sie sich. Ein Baby. Ein eigenes Kind.
Also versuchen sie es, sie und ihr Freund. Und versuchen es. Wieder und wieder. Es tut sich: nichts. Katja hat vorher mehr als zehn Jahre lang die Pille genommen, ihr Körper muss sich erst mal umstellen. »Das war mir vorher gar nicht klar.« Ein Jahr später gehen sie ins Kinderwunschzentrum. Katja studiert noch, Jura, ihr Partner ist zwölf Jahre älter als sie. Sie machen die gängigen Tests. Das Spermiogramm ihres Freundes ist dann recht eindeutig: »Uns wurde ziemlich klar gesagt, dass wir beide auf natürlichem Wege wohl keine Kinder bekommen würden.« Eher gewinnen sie einen Sechser im Lotto, sagt der Arzt, als dass sie ein Kind zusammen bekommen. Katja ist gerade achtundzwanzig geworden, und ihre Hoffnung auf ein eigenes Kind geht gen null. »Für mich war aber immer klar: Ich mach das. Bis zum Ende. Egal, was ich auf mich nehme.« Sie will es also weiter versuchen, in der Kinderwunschklinik, mit künstlicher Befruchtung, egal, wie. Ihr Freund sträubt sich. So richtig wichtig ist es ihm eben nicht. Seine Schwester, ebenfalls kinderlos, mischt sich ein, hält zu ihrem Bruder. Katja fühlt sich alleingelassen. Kann sie sich damit abfinden, ihren Kinderwunsch niemals erfüllt zu wissen?
Sie machen Urlaub, Katja glaubt, sie hat abgeschlossen mit dem Thema. In diesem Monat macht sie zum ersten Mal keine Tests mehr, gibt zum ersten Mal ein bisschen auf. Trotzdem weiß sie ganz genau, dass ihr errechneter Eisprung in die Urlaubstage fällt. Nach mehreren Jahren Kinderwunschtherapie legt man solche Gewohnheiten nicht einfach ab. Als sie zurück sind, bleibt ihre Periode aus. Erst einen Tag, dann noch einen. Eine Freundin sagt: Du bist schwanger. Katja winkt ab. Sie weiß ja, dass sie nicht einfach schwanger geworden sein kann, so auf natürlichem Wege, bei den Werten. Und was, wenn doch? Von über hundert bei eBay gekauften Schwangerschaftstests ist noch genau einer übrig. Schließlich macht sie den Test. »Ich konnte ihn gar nicht weglegen, so schnell erschien neben der ersten Linie schon die zweite«, erzählt sie. Die Linie, diese hauchdünne Linie, diese klitzekleine Sache, die ihr etwas Riesengroßes mitteilt: Sie ist schwanger. »Wahnsinn.«
Die Zeit danach hat Katja später als eine sehr glückliche in Erinnerung – obwohl ihr die ersten vier Monate kotzübel ist, sie sich jeden Tag übergibt, obwohl sie ihr zweites Staatsexamen schwanger schreibt (und besteht). Obwohl sie und ihr Freund eigentlich nur heiraten, weil das dann wohl besser ist für das Kind. Obwohl ihr klar ist, dass ihr Mann, anders als sie, vielleicht nicht all in ist, was das Kind anbelangt. Gegen Ende der Schwangerschaft dann kommen die Schmerzen. Katja geht es plötzlich hundeelend. Wehen können es nicht sein, immerhin sind es noch fünf Wochen bis zum errechneten Termin. Im Krankenhaus stellt der behandelnde Arzt dann stark erhöhte Leberwerte fest. Man schickt sie trotzdem nach Hause. Sie fühlt sich krank, schlapp, hat weiterhin starke Schmerzen.
Von Tag zu Tag geht es ihr schlechter. Drei Tage später fährt ihr Mann sie ins Krankenhaus. Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung, heißt es. Aber genau wisse man es nicht. Dabei leidet Katja genau darunter: HELLP-Syndrom nennt sich das, eine hypertensive Schwangerschaftserkrankung, die für Mutter und Kind tödlich sein kann. Am nächsten Tag sagt der Arzt: Wir holen das Kind. Kaiserschnitt. Es kommt Katja heute vor wie Schicksal. Wie sie im Krankenhaus liegt. Wie die Ärzte den Kaiserschnitt machen, sie an sich hinabschaut und es gar nicht verstehen kann, dass der Teil ihres Körpers noch zu ihr gehört. Wie ihr Mann direkt nach der Geburt nach Hause geht, weil er müde ist. Wie sie ihr Kind erst zwölf Stunden nach der Geburt sehen kann, weil es ihr vorher zu schlecht geht. Und wie sie am Ende trotzdem nur glücklich ist: Ihrem Baby geht es gut. Ihr geht es gut. Sie nimmt einen gesunden Sohn mit nach Hause.
Die kleine Familie lebt nun zu dritt, und Katja ist in den ersten Monaten selig. Sie bleibt zu Hause bei ihrem Kind, ihr Mann geht voll arbeiten. Ihr Wunsch nach einem Kind hat sich erfüllt, und es fühlt sich genauso an, wie sie es sich vorgestellt hat – »nein, eigentlich besser«. Doch sie wünscht sich ein zweites Kind, eigentlich schon seit der Schwangerschaft. Ihr Partner will nicht. Die Beziehung bröckelt.
Insgesamt drei Jahre später sind sie endgültig getrennt. Katja hat nach der Geburt nur ein halbes Jahr in einer großen Kanzlei gearbeitet, um dann das zu tun, was sie eigentlich immer machen wollte. Sie schult um zur Übersetzerin, macht sich selbstständig, findet ein Büro. Sie ist jetzt mit einem neuen Mann zusammen – und ihr Wunsch nach einem zweiten Kind lässt sie nicht los. Doch ihr Freund ist fünfundzwanzig Jahre älter als sie, hat schon drei Kinder und möchte keine mehr. Eine Vasektomie hat er bereits vornehmen lassen. Irgendwann sagt er ihr endgültig: »Ich werde nicht derjenige sein, mit dem du noch ein Kind bekommst.« Katja hält an ihrem Wunsch fest. Irgendwann liest sie ein Buch über Co-Parenting-Modelle. Ihr Lebensgefährte findet die Idee gut, er fühlt sich entlastet. Er will sie unterstützen.
Sie recherchiert im Internet, meldet sich bei Familyship an, einem Portal, das Menschen mit einem Kinderwunsch miteinander verbindet. Sie lernt ein schwules Paar kennen, sie treffen sich. Katja ist sich gleich sicher: Das passt. Sie treffen sich immer wieder, die beiden Männer lernen ihren Sohn kennen, alle verstehen sich super, sind schon ein bisschen wie eine Patchworkfamilie. Bei dem Paar ist der Altersunterschied groß, ähnlich wie bei Katja und ihrem Partner. Das Sperma soll trotzdem der ältere Partner spenden, mit dem jüngeren hat es mehrmals nicht geklappt. Sie treffen sich, nicht nur zu Katjas Eisprung, aber vor allem dann. Wenn die Spermaprobe bereitsteht, ist Katja dran, das Paar spielt währenddessen mit ihrem Sohn. Sie injiziert sich das Sperma selbst mit einer Spritze.
Insgesamt sieben Monate lang versuchen sie es, sieben Zyklen lang, mehrmals im Monat. Es tut sich: nichts. Katja kennt das schon, die Enttäuschung auf allen Seiten ist trotzdem jedes Mal groß. Am Ende machen sie noch mal Tests. Ihre Hormone sind in Ordnung, das Spermiogramm aber ist sehr schlecht. Schon wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Sperma der Männer klappt, ist verschwindend gering. Das Paar versucht parallel, über einen Vermittlerdienst in den USA eine Leihmutter zu finden. Die Luft ist raus. Sie hören auf.
Katja würde den Kontakt gern halten, doch die beiden Männer schaffen es nicht. Zu groß ist der Schmerz darüber, was hätte sein können. Zu stark das Bedauern, dass die Familie, die sie sein wollten, immer nur in ihren Köpfen existiert hatte. Sie brechen den Kontakt ab.
Auch Katja muss auf die Füße kommen, muss den Rückschlag verkraften. Zusätzlich hat sie noch ihre Beziehung. Der Gedanke, dass es auch hier nichts wird mit dem zweiten Kind, belastet sie. Von ihrem Vorhaben hält er sie nicht ab. »Ich habe immer gesagt: Es gibt noch einen Weg.«
Katja sucht weiter. Sie hofft, dass es für sie klappen wird – es hat beim ersten Mal schließlich auch geklappt, against all odds. Sie trifft sich noch mit anderen schwulen Paaren, aber die Chemie stimmt nicht. Beim ersten Paar erscheint ihr die Beziehung zu instabil, und tatsächlich trennen sich die Männer. Das andere Paar will Katja nicht wirklich mit im Boot haben. »Die haben eigentlich eine Leihmutter gesucht und das auch recht offen gesagt.« Das hat mit ihren Wünschen nichts zu tun. Die Sehnsucht nach einem zweiten Kind in ihr brennt.
Im Internet lernt sie einen Mann kennen, der privat Samen spendet. Geld will er dafür nicht haben. Neun Spenderkinder hat er schon in die Welt gesetzt. Seine einzige Bedingung: Er will das Baby sehen. Mit seinen Kindern allein trifft er sich nicht, doch Mutter und Baby zusammen schon. Er schickt Katja Bilder von sich und den Babys. Seine eigene Ehe ist zerrüttet, aus ihr hat er einen Sohn, so alt wie der von Katja – und er hat sich immer eine Großfamilie gewünscht, so erzählt er es Katja. »Für ihn ist das auch ein großes Risiko«, sagt Katja. Die Mütter seiner so gezeugten Kinder könnten ihn auf Unterhalt verklagen.
Sie verstehen sich gut. Katja kann sich vorstellen, dass er ihr Spender wird. Sie kennt seinen richtigen Namen, weiß, wo er arbeitet und wo er wohnt. Auf dem HIV-Test steht dann aber ein anderer Name. Er will doch lieber anonym bleiben, sagt er. Sie weiß nicht, ob sie ihm vertrauen kann. Doch sie ist inzwischen an dem Punkt, an dem sie vieles zu tun bereit ist.
Er bevorzugt die natürliche Methode. Will er also doch nur Sex? In den einschlägigen Foren, in denen Katja sich aufhält, sind durchaus auch Männer unterwegs, die vorrangig Geschlechtsverkehr suchen. Sie bespricht sich mit ihrem Lebensgefährten. Sie recherchieren wieder im Netz. Die Chancen auf eine Schwangerschaft sind höher, wenn sie mit dem Spender schläft. Ihr Partner geht mit der Sache entspannter um als sie. Sie findet die Vorstellung furchtbar. »Ich bin da nicht der Typ für, der mal eben so – und ohne ein Gefühl; das ist überhaupt nicht meins.«
Sie treffen sich in einem Hotel in der Nähe vom Bahnhof in einer großen Stadt. Ihr Lebensgefährte bleibt zu Hause und passt auf ihren Sohn auf. Sie merkt im Auto, dass sie eine Blasenentzündung bekommt. Trotzdem trifft sie sich in diesen Tagen gleich dreimal mit dem Spender, zieht es unter Schmerzen (wegen der Blasenentzündung) durch. Mit Lust hat das Ganze für sie rein gar nichts zu tun. Für ihn auch nicht, glaubt sie. Sie fragt sich, ob er mit Viagra nachhilft, so wenig Leidenschaft ist da.
Er hat ihr vorher erklärt, welche Hotels sich eignen. Katja bucht dann immer ein billiges Zimmer, für 30 oder 40 Euro. Sie treffen sich unten vor dem Hotel, gehen gemeinsam hoch, und eine halbe Stunde später ist alles vorüber. So geht das über viele Monate, und doch tut sich nichts bei Katja.
Einmal gibt es Streit. Normalerweise telefoniert sie mit ihrem Lebensgefährten, bis sie unten vorm Hotel steht und der Spender vor ihr steht. Wenn alles vorüber ist, 30 oder 40 Minuten später, ruft sie ihn direkt wieder an. Sie sind immer in Kontakt, das beruhigt nicht nur ihn, sondern auch Katja. Doch dieses Mal unterhalten sie und der Spender sich nach dem Geschlechtsverkehr noch eine ganze Weile, so lange jedenfalls, dass ihr Partner sich Sorgen macht: Drehen die eine zweite Runde? Finden die sich vielleicht doch toll? Als er Katja damit konfrontiert, ist sie sprachlos.
Es wird schwieriger mit den Treffen. Einmal haben sie Sex in seinem Büro, weil kein Hotel mehr frei ist. Für Katja werden die Begegnungen immer mehr zur Qual. Sie lässt sie über sich ergehen. Irgendwann kann sie nicht mehr. Sie glaubt, der Spender auch nicht, denn er sagt das Treffen für den kommenden Monat ab – er habe einen Unfall gehabt. Der Kontakt bricht ab.
Katja ist weiterhin rastlos. Sie hat nicht ewig Zeit, das weiß sie. Sie hört sich um. Offiziell gilt sie nun als alleinstehend in dem Verfahren. Sie ist ja nicht verheiratet, und ihr Partner will in den Prozess nicht involviert sein. Doch eine Frau ohne Partner oder Partnerin geht nicht einfach zur Samenbank – und fertig. Viele Samenbanken in Deutschland bieten ihren Service nur für Paare an. Katja hat Kontakt zu zwei Ärzten, die mit Samenbanken in Berlin kooperieren und auch alleinstehende Frauen befruchten. Allerdings verlangen diese Ärzte in einem vorher aufgesetzten notariellen Schreiben, dass die Mutter in spe jemanden angibt, der Unterhalt zahlt – sonst könnten sie selbst auf Unterhalt verklagt werden. Genau so eine Person kann und will Katja aber ja nicht angeben. Sie will das Kind allein bekommen. Eine Samenspende in Deutschland ist für Katja darum erst mal ausgeschlossen.
All die Rückschläge, all das Bangen und Hoffen und Verzweifeln – es tut Katja nicht gut. Sie zweifelt viel. Fragt sich, wie es weitergehen soll. Hat Angst, dass es doch nichts wird mit dem ersehnten zweiten Kind, sie einen weiteren Rückschlag einstecken muss, noch einen. Was hilft: Recherchieren. Sie findet eine private Klinik in Holland, bei der alle Konditionen stimmen. Die Klinik arbeitet mit Samenspenden aus Dänemark. Katja fährt hin, führt ein Gespräch mit einer Psychologin, lässt sich untersuchen. Vor der ersten Sameninjektion muss Katja eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung in Deutschland vornehmen lassen. Das Ergebnis: Beide Eileiter sind verschlossen – »und kein Mensch wusste es«. Darum also waren alle Bemühungen zuvor umsonst gewesen. »Sie waren doch vorher schon schwanger. Da rechnet kein Mensch mit«, sagt ihre Frauenärztin. Ihr Lebensgefährte will sie trösten. Dabei ist Katja eigentlich richtig froh: Endlich weiß sie, woran es gelegen hat in den letzten Jahren. Endlich hat sie Gewissheit. Und sie weiß auch schon, was sie als Nächstes tun wird.
Insgesamt sechsmal fährt sie noch nach Holland. Wenn sie morgens früh losfährt, schafft sie es an einem Tag hin und zurück. Sie besprechen dort die Ergebnisse der Eileiteruntersuchung. Bei Katja kommt nur eine In-vitro-Befruchtung infrage, eine einfache Insemination reicht nicht aus. Sie sucht einen Spender aus, »wie aus einem Katalog«. Sie kann sich deren Stimmen anhören, die Handschrift anschauen, die Spender haben außerdem alle einen Test auf emotionale Intelligenz gemacht. Es gibt von ihnen nur Kinderfotos zu sehen – und die Mitarbeiter der Samenbank geben zusätzlich eine Einschätzung ab, welchem Prominenten der jeweilige Spender ähnlich sieht. Katja sieht das Kinderfoto ihres Spenders und weiß: Der ist es. Ihr Spender wird von den Mitarbeitern der dänischen Samenbank mit dem Schauspieler Brian Austin Green verglichen. Katjas Entscheidung ist gefallen. 1500 Euro kostet das Sperma.
Sie soll sich melden, wenn sie das nächste Mal ihre Periode bekommt. Auf halber Strecke zur Klinik wohnt ihre Mutter. Katja erzählt ihr erst nichts. An dem Wochenende, an dem sie ihre Regelblutung bekommen soll, fährt sie zu ihr. Sie benachrichtigt die Klinik, obwohl sie noch gar nicht blutet. Eine Stunde später bekommt sie ihre Periode. Sie ist so erleichtert, dass sie ihrer Mutter von ihrem Vorhaben erzählt. »Glaubst du, du schaffst das alles?«, fragt die. »Ja.« Am nächsten Tag fährt Katja in die Klinik. Sie ist aufgeregt. Jetzt geht es also los.
Sie bekommt einen Kofferraum voller Medikamente mit, auf Eis. Jeden Abend zur selben Uhrzeit spritzt sie sich selbst in den Bauch – ein Medikament, das die Eizellen reifen lässt. Nach wenigen Tagen muss sie sich noch ein zweites Medikament spritzen, das den Eisprung unterdrückt. Sie geht zu ihrer Frauenärztin zum Ultraschall. Die findet sehr viele reife Eizellen. Die Klinik in Holland bestellt Katja umgehend ein. Auch die Ärzte in Holland finden viele reife Eizellen vor, sie entnehmen ihr dreizehn Stück. Zehn auf der einen Seite, drei auf der anderen. Obwohl Katja leichte Betäubungsmittel bekommt, hat sie das Gefühl, alles mitzubekommen. Die Punktion empfindet sie als extrem schmerzhaft. Von den Spenderspermien suchen die Ärzte dann die besten aus und versuchen, die Eizellen zu befruchten. Bei zehn Stück klappt es. Alle entwickeln sich weiter.
Zurück in Deutschland, hat Katja neun riesengroße Zysten und Flüssigkeit im Bauch. Das liegt an der Überstimulation infolge der Medikamente. Die Beschwerden, sagt die Gynäkologin einen Tag später, nehmen nach dem Einsetzen der befruchteten Eizelle normalerweise gleich wieder ab. »Kriegen Sie die Zeit irgendwie rum«, rät die Gynäkologin. Die Chancen stehen gut. Wieder einen Tag später fährt Katja erneut in die Klinik nach Holland. Eine der Eizellen wird Katja eingesetzt – mehr ist in den Niederlanden pro Prozedur nicht erlaubt. In Deutschland dürfen es bis zu drei Eizellen sein. Die anderen befruchteten Eizellen lässt Katja in der Klinik einfrieren. Zwölf Tage lang nimmt sie Progesteron – und googelt sich wahnsinnig, wie sie sagt. Sie fühlt sich genauso wie in jedem Monat davor. Und ist sich sicher: Es hat nicht geklappt.
Dann kehrt die Überstimulation zurück, Katja hat wieder Wasser im Bauch – ein Zeichen dafür, dass es geklappt haben könnte. Kann sie sich schon freuen? Eigentlich geht es ihr doch wie immer. Dann tut ihr die Brust komisch weh. Sie hat zwei Tage lang Gänsehaut. Sie wünscht sich, dass sie ihre Periode in der Nacht bekommt – alles besser als ein weißer Schwangerschaftstest am nächsten Tag. Sie träumt von drei positiven Schwangerschaftstests. Dann wird sie wach: Drei Uhr morgens. Besonders wirksam ist Morgenurin. Schnell googeln: Kann man nach nur fünf Stunden Schlaf schon von Morgenurin sprechen? Kann sie damit den Test machen? Um vier Uhr steht sie schließlich auf und macht den Test. Zum zweiten Mal in ihrem Leben kann Katja gar nicht so schnell gucken, wie da eine zweite Linie neben der ersten erscheint. Ihr erster Versuch in der Klinik – er ist sofort geglückt.
Ihr Lebensgefährte kann es gar nicht glauben, als sie es ihm noch am selben Morgen erzählt.
Sie ziehen zusammen. Für das zweite Kind wünscht Katja sich eine natürliche Geburt. Bloß keinen zweiten Kaiserschnitt! Die Ärzte sind wachsam, weil sie beim ersten Mal das HELLP-Syndrom hatte. Diesmal bekommt sie Schwangerschaftsdiabetes. Ihr ist wieder lange schlecht, bis in die 24. Woche. Das Kind liegt auf einem Nerv, sie kann mehrere Monate nicht auf einem Fuß auftreten. »Ich habe ziemlich viel mitgenommen«, sagt sie. Am Ende liegt sie mit erhöhtem Blutdruck im Krankenhaus. Die Ärzte leiten die Geburt ein, sehr vorsichtig, denn das Baby soll nicht zu stark auf die Kaiserschnittnarbe drücken. Katja bekommt Wehen, die kommen und wieder vergehen. Und dann versiegen. Dann stellt sich heraus: Sie hat wieder eine Schwangerschaftsvergiftung. Sie darf nicht mehr aufs Handy schauen, der Fernseher wird rausgebracht, sie darf nur noch im Dunkeln liegen – erhöhte Krampfanfallgefahr.
Am Ende kommen doch Wehen, richtige Wehen. Zwölf Stunden lang, alle zwei Minuten. »Ich habe damit gerechnet, dass es schlimm werden würde – aber nicht so schlimm«, sagt Katja. Bei jeder neuen Wehe glaubt sie, sie wird ohnmächtig, so weh tut es ihr. Bis in die Fingerspitzen. Sie bekommt etwas gegen die Wehen, ist davon wie weggetreten. Im Bett neben ihr liegt ihr Lebensgefährte und schläft. Die Fruchtblase platzt, doch Katja kann sich nicht rühren. Presswehen setzen ein und eine halbe Stunde lang fühlt sich Katja, wie sie sich noch nie in ihrem Leben gefühlt hat. »Ganz bei mir.« All die Schmerzen, all die körperlichen Beschwerden, die sie auf sich genommen hat, scheinen in diesen großartigen Urschmerz zu münden – den ganz natürlichen Schmerz einer Geburt. Als die Hebamme kommt und kontrolliert, sagt sie: »Ihr Kind möchte kommen.« Die Hebamme und Katjas Lebensgefährte helfen ihr in den Kreißsaal, eine links, einer rechts, sie tragen Katja mehr, als dass sie sie stützen. Eine Wehe später ist ihr Baby da. Ihr Sohn. Endlich.
Katja ist vollkommen überwältigt von einem überbordenden Glücksgefühl. Ihr Lebensgefährte hat die ganze Geburt fotografiert, jeden Zentimeter mehr, den ihr Sohn auf die Welt, in den Kreißsaal kam. Sie schauen sich die Bilder wieder und wieder an. All die Schmerzen, all das Leid, all die Qualen im Kreißsaal – sie erinnert sich daran, ganz rational. Sie kann auch gut davon erzählen. Aber gleichzeitig ist der Schmerz vergessen.
Ihr Partner und sie ziehen den Sohn nun gemeinsam groß. Er ist jetzt genauso involviert wie sie, genauso eingenommen von diesem Wunder, das nicht über Nacht erschienen ist, sondern für das Katja hart und lange kämpfen musste. Sie will eine Sorgerechtsverfügung einrichten – doch dafür ist ihr Partner zu alt, er ist über sechzig. Ihr Lebensgefährte erkennt daraufhin die Vaterschaft an. Sie sind jetzt eine kleine Familie mit zwei Söhnen. Einmal fragt er, ob sie es damals nicht doch direkt mit seinem Sperma hätten machen sollen. Aber dann wäre ihr Sohn nicht ihr Sohn, der er jetzt ist. Und sie sind glücklich darüber, wie es jetzt ist. Es fühlt sich richtig an.
Katja hat etwas gemacht, das früher so nicht möglich gewesen wäre. Hat sie deshalb gegen die Natur gekämpft? Hätte es eigentlich gar nicht sein sollen? Aber ihr Gefühl, ihre Sehnsucht – das ist doch auch Natur, oder, wie Katja sagt, »wie ein Urinstinkt«. Für sie ist der Sinn ihres Lebens: das Leben weitergeben. Für dieses Leben, für ihre Kinder hat sie gekämpft wie eine Löwin.
Sie hat ihrem Körper viel zugemutet in den letzten fünfzehn Jahren, die es gedauert hat, bis sie am Ziel war. Und auch ihre Seele hat ordentlich etwas abbekommen, bei all den Treffen mit neuen Spendern, mit Familienmitgliedern in spe, mit potenziellen Vätern. Nur ist es eben so, dass Katja sich die ganze Zeit treu geblieben ist. Ihre Sehnsucht brennen fühlte. Ihren größten Wunsch erfüllen wollte. Geändert hat sie sich auf dem Weg selbst gar nicht so sehr – eine Mutter war sie vorher schon. Wie eine Mutter fühlte sie sich schon immer. Aber jetzt ist sie eine Mutter mit zwei Kindern.
* * *
Eine Sehnsucht, wie Katja sie beschreibt, wie Katja sie gefühlt hat, von der sie sich fast zerrissen fühlte – eine solche Sehnsucht habe ich noch nie gespürt. An keinem Tag, in keiner Minute. Ich habe sie mir nie vorgestellt, ich habe noch nicht mal angefangen, einen Gedankenumriss dieser Sehnsucht zu zeichnen, nicht mal mit Bleistift; ich habe noch nicht einmal davon geträumt. Es versetzt mir höchstens manchmal einen Stich, wenn ich zum Beispiel ein Baby sehe. Vielleicht erinnert es mich daran, wie anders mein Leben sein könnte. Vielleicht erinnert es mich auch daran, dass es da gewisse gesellschaftliche Erwartungen an mich gibt.
Ich bewundere Katja für ihre Stärke, ihren unermüdlichen Einsatz dafür, glücklich zu sein. Ich freue mich sehr für sie, dass sie ihre Sehnsucht stillen, ihren Traum erfüllen konnte, dass ihr beschwerlicher Weg nicht umsonst war.
Und ich frage mich: Was wäre in ein paar Jahren, wenn ich es doch probieren wollte – und dann klappte es nicht? Paaren mit Kinderwunsch wird immer geraten, erst einmal optimistisch und gelassen davon auszugehen, dass körperlich alles in Ordnung mit ihnen ist. Sie sollen in Ruhe probieren, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Was aber, wenn es bei mir trotzdem nicht klappen will? Bei der Frauenärztin ist immer alles okay, aber meine Periodenbeschwerden werden seit Jahren stetig stärker, und irgendwo habe ich gelesen, dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass die eigene Fruchtbarkeit abnimmt. Der Körper signalisiert mir quasi jeden Monat: Ich bin bereit! Wenn nicht jetzt, wann dann? Blöd nur, dass der Rest von mir nicht bereit ist. Ich könnte meine Fruchtbarkeit messen lassen, nur, was würde ich anfangen mit diesem großen Wissen? Was, wenn ich unfruchtbar wäre? Würde es mich runterziehen oder hochpushen, würde es mich fertigmachen oder erleichtern? Wenigstens müsste ich dann keine Entscheidung mehr treffen, denke ich manchmal. Und was, wenn ich superfruchtbar wäre? Wäre ich es irgendwem schuldig, diese Fruchtbarkeit zu nutzen? Wenn nicht der Gesellschaft, dann vielleicht meinem Körper, der ächzt unter der Last, weiblich und voller unbefruchteter Eier zu sein?