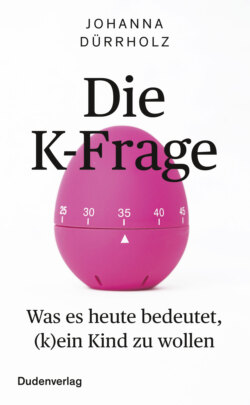Читать книгу Die K-Frage - Johanna Dürrholz - Страница 9
ОглавлениеGlücklich sein ohne Kind – wie geht das?
Als Franziska Ferber endgültig wusste, dass sich ihr Kinderwunsch nie erfüllen würde, schwor sie sich eines: Sie würde ihr Leid annehmen – und es in etwas Positives umwandeln. Sie würde nicht einfach in der eigenen Traurigkeit versinken. Sie würde anderen Frauen mit einem ähnlichen Schicksal helfen. »Doch bis dahin war es ein weiter Weg.«
Sie hatte schon ein paar Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet, ehe sie heiratete und mit ihrem Partner versuchte, ein Kind zu bekommen. Als es nicht klappen wollte, gingen sie zum Arzt, anschließend versuchten sie es drei Jahre lang in einer Kinderwunschklinik – vergeblich. Mit Anfang dreißig hatte Franziska Ferber die Gewissheit: Ein leibliches Kind würde sie nie bekommen können. Ein Pflegekind, das sie womöglich wieder verlieren könnten, trauten sie und ihr Mann sich nach den Jahren des Wartens und der vielen Enttäuschungen einfach nicht zu. Und Adoption? »In dem entsprechenden Jahr kamen in München sechs zur Adoption freigegebene Kinder, die nicht als Teil einer Patchworkfamilie adoptiert wurden, auf über vierhundert Paare. Dazu kamen noch die Paare aus dem Jahr davor, die unter vierzig waren.« Die Aussicht auf weitere Jahre des Wartens, des Bangens, Hoffens und Enttäuschtwerdens war alles andere als rosig. Ferber wusste, dass sie das nicht durchstehen würde. Also machte sie irgendwann den Cut. Es sollte eben nicht sein.
Für Ferber waren die Jahre des Versuchens, das ewige Trial and Error, geprägt von Verlust, Schmerz, Trauer, Enttäuschung. »Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mich begleitet, der mich unterstützt.« Sie suchte professionelle Hilfe. Doch sie fand niemanden, der explizit Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch begleitete. Also schulte sie selbst um. Absolvierte eine dreijährige Coaching-Ausbildung. Und gibt heute Kurse und Seminare für Frauen, denen es ähnlich ergeht wie früher ihr.
Weil Ferber sich so sehr damit auseinandersetzt, welche Wünsche wir in uns tragen und was Frauen mit Kinderwunsch beschäftigt, möchte ich mit ihr sprechen. Kann sie mir verraten, was es ist, das diesen intrinsischen Wunsch auslöst? Und ob man auch ohne Kinder glücklich leben kann? Kann man, sagt Ferber, logisch. Sie tut es ja selbst. Doch für sie ist das Thema nach wie vor emotional besetzt, das merken wir beide im Gespräch. Natürlich kann sie das ausblenden und die professionelle Distanz wahren, wenn sie Frauen berät. Doch es hilft eben auch schon zu wissen: Da ist jemand, die weiß genau, wie ich mich fühle.
Laut dem Bundesfamilienministerium ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. In einer repräsentativen Studie von 20201 heißt es, Kinderlosigkeit sei in unserer Gesellschaft »ein Massenphänomen«. Sie sei in »allen Altersgruppen, Lebensphasen und Milieus eine weit verbreitete Normalität«, allerdings besonders häufig in der Mitte der Gesellschaft, noch mehr in gehobenen Milieus zu finden. »Vor allem Frauen und Männer mit hoher Qualifikation und beruflichen Ambitionen verschieben ihren Kinderwunsch auf die (unbestimmte) Zeit nach dem Berufseinstieg oder gar der beruflichen Etablierung«, heißt es in der Erhebung.
Ist ungewollte Kinderlosigkeit also genau das: ein Problem von Frauen, die sich erst selbst verwirklichen wollten – bis es schließlich zu spät war? Ich muss an die Patientinnen denken, mit denen Dr. Schmutzler häufig zu tun hat. Steht mir demnach genau das Schicksal bevor, das er bereits prognostiziert hat?
Doch Franziska Ferber hatte nicht zu lange gewartet – und war umso enttäuschter, als ihr klar wurde, dass sie kinderlos bleiben würde. »Ich glaube, es gibt drei Ebenen, auf denen wir uns Kinder wünschen«, erklärt sie. Da sei zum einen die Ebene, mit der sich die meisten identifizieren könnten: »Das ist der Wert an sich, ein Kind zu haben, Mutter zu werden, Mutter zu sein. Eine Familie zu gründen.« Das hat, findet Ferber, einen hohen persönlichen und gesellschaftlichen Wert. Sie selbst hat diesen Wert nie infrage gestellt. Sie hat sich, anders als ich, nicht vorher gefragt: Will ich überhaupt? »Obwohl ich keine Frau bin, die schon von klein auf davon träumte, ein Kind zu bekommen, Mutter zu werden – überhaupt nicht.« Doch dass sie Kinder wollte, stand für sie außer Frage.
Die zweite Ebene habe mit ihrer Persönlichkeit zu tun. »Ich bin ein wahnsinnig herzlicher und liebevoller Mensch«, sagt Ferber über sich selbst. »Ich kümmere mich gern um andere Menschen. Ich übernehme gern Verantwortung.« Und in einer Unternehmensberatung werde man für alles Mögliche geschätzt, aber nicht unbedingt für seine liebevolle, herzliche Art, erklärt sie lachend. Wohin dann aber mit all der Fürsorge, die sie in sich trägt? Wohin mit dieser mütterlichen Art? »Wünscht man das nicht jedem Kind – eine liebevolle Mutter?«, meint Ferber. Sie fühlte sich vom Schicksal übergangen. »Ich fand das so ungerecht – dass ich so viel Liebe in mir trage. Und nicht wusste, wohin damit. Nur weil ich kein Kind bekommen konnte.«
Tatsächlich hat Franziska Ferber heute einen kleinen Hund. Als Kompensation, das ist ihr klar – und für sie auch in Ordnung. Außerdem kann sie in ihren Kursen »ihren Kinderwunsch-Frauen«, so nennt sie ihre Klientinnen, vieles zurückgeben. Kann mit Menschen arbeiten. Sich kümmern, Verantwortung übernehmen, motivieren. Kann diesen Teil ihrer Persönlichkeit genauso ausleben wie ihre Fähigkeiten.
Die dritte Ebene, auf der Ferber sich Kinder wünschte, ist ihr zwar nicht peinlich – aber so richtig angenehm ist es ihr auch nicht. »So möchte ich mich selbst nicht sehen«, sagt sie, ist aber doch ehrlich und reflektiert genug, um darüber zu sprechen. Weil es zur Lebensrealität dazugehört. »Ich war schon einige Jahre in der Unternehmensberatung tätig, als wir versuchten, ein Kind zu bekommen«, erzählt sie, »und ich hatte da im Job wirklich eine ganz tolle Zeit. Trotzdem war es auch eine unglaubliche Belastung. Ich war an einem Punkt, an dem ich keine Lust mehr darauf hatte, jeden Montagmorgen um 6.20 Uhr in ein Flugzeug zu steigen und meine Kraft dafür einzusetzen, dass irgendein Unternehmen x Prozent mehr Rendite erwirtschaften kann. Das erschien mir so sinnlos.« Die Sinnstiftung also wieder. In einer Gesellschaft, in der sehr viele von uns in Büros sitzen, Tabellen pflegen und sehr abstrakt einem Kapital zuarbeiten, ist die Frage nach dem Sinn vielleicht umso drängender. Und wenn wir ihn nicht in unserer Arbeit erkennen, über die sich viele Menschen in Deutschland stark definieren, dann doch wenigstens über das Familienleben. Klingt einleuchtend, oder?
»Ich habe ordentlich verdient«, sagt Ferber. »Aber es gibt Sättigungsgrenzen. Irgendwann entspricht ein Zugewinn an Gehalt nicht mehr dem gleichen Zugewinn an persönlicher Zufriedenheit.« Aus heutiger Sicht sind das keine Gedanken, auf die sie stolz ist: »Ich hätte mich ja auch woanders bewerben können.« Doch die Auseinandersetzung mit und der Wunsch nach Sinnhaftigkeit ist etwas, das viele Frauen bewegt. Auch weil Männlichkeit in unserer Gesellschaft noch immer zu einem höheren Anteil über die Arbeit definiert wird, während Weiblichkeit mit Sorgearbeit und Muttersein assoziiert wird. Selbst die Frage danach, was uns in unserem Leben Sinn gibt, ist uns kulturell vorgegeben. Sich von diesen Vorstellungen zu lösen, ist darum gar nicht so leicht.
Franziska Ferber jedenfalls sah das Ganze pragmatisch. »Ich dachte mir, wenn ich schwanger werde, müsste ich gar nicht in die Auseinandersetzung mit meinem Chef gehen und womöglich unangenehme Gespräche führen.« Stattdessen, so stellte sie es sich vor, könnte sie einfach mit einem Attest ihres Frauenarztes kommen, das besagt: »Die Ferber fliegt ab nächster Woche nicht mehr.« Die Erschöpfung, die ihr Job auslöste, hätte sie damit zumindest fürs Erste geklärt. Viele ihrer Klientinnen schämen sich genau für solche Gedanken, erzählt sie. Dabei kann man doch die Verlagerung der Sinnsuche und die Aussicht darauf, sich für einige Monate häuslich mit einem Baby zurückzuziehen, gut verstehen. Ob es dann wirklich so gemütlich wird und ob diese Überlegungen der Realität entsprechen, lässt sich natürlich bezweifeln. Oder: Das steht auf einem anderen Blatt.
Es fiel Franziska Ferber schwer zu akzeptieren, dass sie keine Kinder würde bekommen können. »Ich habe nie infrage gestellt, dass ich welche bekommen würde«, sagt sie. Besonders schwierig war für sie, dass sie schon mit Anfang dreißig wusste, dass sie kinderlos bleiben würde, in einem Alter also, in dem in ihrem Umfeld viele Paare ihr erstes Kind bekamen. »Da trudelte eine Schwangerschaftsnachricht nach der nächsten rein.« Für sie war das besonders belastend. »Zumal ich immer das Gefühl hatte, ich müsste mich ja mit denen freuen. Rückblickend würde ich sagen: Ich habe da meine Seele verkauft.« Sich für jemanden freuen, der genau das bekommt, was einem selbst verwehrt bleibt – Ferbers Ansicht nach ist das ethisch erwünscht. Dennoch wollte es ihr nicht gelingen. Sie empfand immer Neid – und fühlte sich deshalb schuldig.
Was dann folgte, beschreibt Franziska Ferber heute als langen, schwierigen und persönlichen Weg. Als Weg hin zur Akzeptanz eines Lebens, das anders verläuft, als sie es sich vorgestellt hatte. Dabei ist sie manche Umwege gegangen – »Die hab ich im Nachhinein rausgestrichen« –, aber die Eckpunkte bleiben, und an denen orientiert sie sich auch mit den Frauen, die zu ihr kommen. Es geht darum, Antworten zu finden »auf große und existenzielle und tiefe Lebensfragen«. Es geht um den Sinn, um die Aufgaben im Leben. Um Zugehörigkeit. Keiner konnte Franziska Ferber dabei helfen, diese Fragen zu beantworten. Doch sie kann heute anderen Frauen dabei helfen. Und das gibt ihrem Leben Sinn.
* * *
Mit meinen Eltern über dieses Thema zu reden ist gar nicht so leicht. Als ich meine Mutter nach ihrem Geburtstag fragte, ob es sie störe, dass ich einen Tag länger bleiben würde als der Rest der Familie, antwortete sie: »Nein, du störst mich nie. Du bist mein Lebenselixier.« Meine Mutter ist kein dramatischer oder gar pathetischer Mensch, überhaupt nicht. Sie ist aufgewachsen als Tochter eines Schlossermeisters und einer Hausfrau, im Ruhrgebiet, und kann alles reparieren, wenn sie will. Als ich mit elf oder zwölf meinen Fahrradschlüssel verlor, sägte sie einfach das massive Schloss an meinem Pegasus-Rad durch. Zwei Freundinnen von mir sagten immer, meine Mutter könnte auch Astronautin sein, weil sie irgendwie alles kann. Es stimmt: Sie ist gebildet und eine weichherzige Mama, zugleich aber tough und durchgreifend. Aber jetzt ist sie schon älter, genau wie mein Vater, der bald in den Ruhestand geht und den ich fast noch nie so aufgeregt erlebt habe wie angesichts der Tatsache, dass er Großvater wird. Er hat sogar ganz ernsthaft seinen Namen ins Spiel gebracht: Helmut. Wir alle sind froh, dass meine Schwester eher dagegen ist. Das Kind wird es eines Tages danken.
Jedenfalls sagen meine Eltern beständig, dass sie sich aus allem raushalten, was sie aber doch nie tun, weil meine Familie, und ich bin eigentlich froh darüber, sehr meinungsstark ist. An diesem Wochenende zum Beispiel erzählte ich meinem Papa von einer feministischen Autorin, die ich toll finde.
»Aber du bist doch gar keine Feministin«, meinte er gleich.
»Doch.«
»Ne, Quatsch. Bist du nicht.« Und so weiter. Als ich einmal andeutete, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt Kinder will, sagte meine Mutter, dass sie glaubt, dass ich es bereuen würde. Sie hat das danach nie wieder gesagt, und ich weiß natürlich, dass sie es gut mit mir meint. Weil sie mich über alles liebt, wünscht sie sich, dass es mir eines Tages auch so geht, dass ich ein Kind habe, einen Augenstern. Sie kann sich das Leben ohne ihre beiden Töchter nicht vorstellen. Meine Eltern sind beide ihr Leben lang zufriedene Lehrer gewesen, ein glückliches Paar – und überglückliche Eltern. Sie sind froh und dankbar, dass meine Schwester und ich beide irgendwie ganz gut geraten sind und dass sie ihren Freunden stolz von uns erzählen können. Fehler, die ihre eigenen Eltern gemacht hatten, wollten sie nie wiederholen – bei vielen Dingen ist ihnen das geglückt, anderes kriegt man nicht so leicht raus aus der DNA.
Meine Eltern sitzen hier mit mir auf der Terrasse, der Garten ist zugewachsen mit grünem Allerlei, in den Beeten stehen die Rosen, an der Hecke wuchert es, wir halten Abstand und sitzen draußen, weil es unser erster Corona-Sommer ist. Ab und zu steht mein Vater aufgeregt auf, bückt sich stöhnend zu seiner Steinschleuder (er hat Rücken) und schießt mit Erbsen auf die fetten Tauben, die sich alle naselang im riesigen Ahorn niederlassen, der vom Nachbargrundstück zu uns herüberragt und den schönsten Schatten überhaupt spendet. Ich bin froh, dass meine Schwester nun ernst macht: Heiraten. Das Baby. Das nimmt mir den Druck.
In meiner Familie gelte ich zuweilen als nicht ganz normal, ohne dass ich so genau wüsste, wieso. »Doch, du bist total normal!«, ruft mein Vater empört, als ich erwähne, dass mein Schwager mich manchmal komisch findet. Ich übe auf dem Rasen Handstand, wie früher. In alte Rollen fällt man schnell zurück. Bin ich normal? Oder ist es schon nicht normal, nicht zu wissen, was man will? Ist das, was ich mache, nicht normal? Ja, ich schreibe für meinen Lebensunterhalt, und das könnte man vielleicht, großzügig interpretiert, als künstlerisch bezeichnen. Andererseits arbeite ich bei einer Tageszeitung, die nicht unbedingt als durchgeknallter Hippie-Laden bekannt ist. »Du bist nicht nullachtfuffzehn«, sagt meine Mutter liebevoll. Sie hat mir mal eine Karte geschenkt, die ich mir in meiner Studenten-WG an meine Zimmertür gehängt habe und die ich bis heute aufbewahre: Vor einem quietschrosa Hintergrund tanzt ein Schaf. Dazu der Satz: »Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.« Zwar sind die Menschen, die sich selbst als ein »bisschen verrückt« betiteln, in der Regel spießig, angepasst, langweilig und konventionell, doch mir hat diese Sicht der Dinge (der Satz stammt übrigens von Erasmus von Rotterdam) trotzdem gefallen. Es war nämlich auch die Art meiner Mutter, mir zu sagen: So, wie du bist, bist du okay. Das war zu einer Zeit, in der ich recht ziellos durch mein Germanistikstudium schwamm und hauptsächlich feiern ging. Und selbst ganz furchtbar unglücklich darüber war, mit meinem Kram nicht zurande zu kommen.
Ich frage mich trotzdem, ob meine Mutter ähnlich entspannt reagieren würde, würde ich mich endgültig gegen Kinder entscheiden. Und: Würde ich wirklich bereuen? Ich kann meinen Eltern ihr Elternglück nicht absprechen, im Gegenteil, ich habe ja immer davon profitiert. Reicht mein Anderssein so weit, dass ich mich von diesen Konventionen freisprechen kann, die es in meiner Familie gibt: dass nämlich, wer Kinder bekommt, erfüllter, netter und zufriedener ist? »Mein Gefühl, dass ich kein Kind will, ist das Gefühl, nicht zu jemandes Vorstellung von mir werden zu wollen«, schreibt Sheila Heti in ihrem Buch Mutterschaft.2 Ich verstehe sie sehr gut.
Mich nervt es auch, nicht zu wissen, ob ich irgendwas von diesem Leben, in dem Kinder für mich als Frau vorgesehen sind, selbst will – oder ob es alle anderen von mir erwarten. Gleichzeitig weiß ich auch, dass ich meinen Eltern nicht dankbar sein muss. Ich bin es, aber ich bin ihnen eigentlich trotzdem keine Rechenschaft schuldig – so funktioniert das nun mal nicht, wenn man Leben in die Welt setzt. Doch nichts läge mir ferner, als ihnen wehzutun. Ihr Seelenheil ist auch für mich wichtig, so wichtig, dass ich dafür wahrscheinlich auch ein Kind kriegen würde.