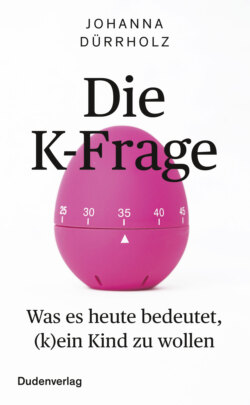Читать книгу Die K-Frage - Johanna Dürrholz - Страница 11
ОглавлениеWoher kommt eigentlich der Kinderwunsch?
Mein Blick auf Babys hat sich verändert. Ich fand sie schon immer süß, nicht weil ich eine Frau bin und man das von Frauen so erwartet, sondern weil ich kleine, drollige Wesen immer süß finde. Auch Hundewelpen oder Katzenbabys gefallen mir wirklich sehr gut. »Babyishness« oder auch »Kindchenschema« nennt sich das Phänomen, wenn man kleine Wesen mit höherem Fettanteil und großen, runden Augen und generell anderen Proportionen als bei Ausgewachsenen besonders süß findet. Heute fallen mir Menschenbabys allerdings stärker auf als Tierbabys. Ich merke es, wenn eines im Raum ist. Ich nehme das Baby einer Freundin auf den Arm und rieche ganz vorsichtig den Milch-und-Honig-Duft seines Kopfes (das ist nicht ausgedacht, das Kind riecht wirklich danach), halte es und weiß nicht, wohin mit mir.
Das Baby macht ganz viel mit mir, löst diverse Gefühle aus, die ich zum größten Teil nicht einordnen kann. Über seinen Händen, dort, wo sonst das Handgelenk zu sehen ist, reihen sich kleine Speckwülste übereinander, in die ich vorsichtig reindrücke. Dieses Baby ist ein Wunder der Natur, das ist mir klar. Es ist nicht hier, um von mir gemocht und geschmust zu werden, so wie der kleine Hund, den ich mir seit Langem wünsche, für den ich aber einfach keine Zeit hätte. Es ist hier, um von mir mit kratzbereiten, ausgefahrenen Nägeln beschützt zu werden. Es ist hier, um größer und stärker und klüger zu werden. Es ist hier, um mir das Herz zu zerreißen. So kommt es mir zumindest vor.
Woher kommen diese Gefühle? Warum habe ich überhaupt so ein verwirrend unklares Sehnen nach einem Baby, einem Kind in mir? Will ich deshalb ein Kind, weil mir die Gesellschaft das vorlebt? Wie im nächsten Kapitel noch deutlicher werden wird, ist in Deutschland der sogenannte Muttermythos besonders ausgeprägt, weil insbesondere in der NS-Ideologie das Ziel einer deutschen Frau einzig und allein das Gebären vieler kleiner Deutscher sein sollte.
Immer wieder begegnet einem aber auch das Argument, dass der Kinderwunsch gerade bei Frauen quasi angeboren sei. Eine Laune der Natur. Wenn es nach unseren biologischen Bedürfnissen geht, so die Verfechter dieser Theorie, wollen unsere Körper nichts lieber tun, als sich zu reproduzieren.
Ich war nie ein Fan von biologisch begründeten Argumenten, wenn es um die Unterschiede der Geschlechter geht. Wenn Menschen mir weismachen wollen, dass Männer eben »von Natur aus« lieber zur Arbeit gehen und Frauen lieber zu Hause bleiben, kann ich nur müde lächeln. Ich halte das für Quatsch. Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie hat in ihrem berühmten TED Talk »We should all be feminists« gesagt: »Manche Menschen werden die Evolutionsbiologie und Affen anführen und darauf verweisen, dass etwa weibliche Affen sich vor männlichen Affen verneigen – solche Sachen. Aber der Punkt ist: Wir sind keine Affen. Affen leben auch auf Bäumen und essen Erdwürmer. Wir machen das nicht.«3 Ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Rein auf der Biologie beruhende Argumente sind in Diskussionen, die sich um das Hier und Jetzt drehen, das seit Jahrtausenden kulturell geprägt ist, jedenfalls selten allein gültig.
Trotzdem: Unsere Gene beeinflussen uns. Es interessiert mich, was aus evolutionsbiologischer Sicht dazu führen könnte, dass Menschen sich Kinder überhaupt wünschen. Dass sie sich reproduzieren wollen. Ich rufe Axel Meyer an, der ein renommierter Evolutionsbiologe und ein viel kritisierter Autor ist. In seinem Buch Adams Apfel und Evas Erbe schreibt er von einer »Genderideologie« (was er auch in Gastbeiträgen etwa in der Neuen Zürcher Zeitung wiederholt) und davon, dass die Gender Studies sich nicht an Fakten halten, die Biologie aber schon. Seine Ausführungen wurden von vielen als sexistisch aufgefasst, wogegen er sich unter anderem mit der Aussage verteidigte, er sei Feminist. Auf meine Interviewanfrage reagiert er freundlich, und ich bin gespannt. Tatsächlich habe ich zu Beginn unseres Telefonats das Gefühl, dass Meyer sich vor mir rechtfertigen will. Dabei habe ich ihn da noch gar nichts Kritisches gefragt, nur gesagt, ich hätte einige Interviews mit ihm gelesen. Im Gespräch finde ich ihn eigentlich sehr nett und überhaupt nicht so provokant wie in den Thesen seines Buchs über Gender und Männer und Frauen, von denen ich den meisten nicht zustimmen würde.
Meyer erzählt mir: »2008 und 2009 war ich mit meiner Frau im Wissenschaftskolleg in Berlin, und das war das erste Mal, dass ich das Wort ›biologistisch‹ überhaupt gehört habe. Die meisten Kulturwissenschaftler haben überhaupt keinen Kontakt zu Naturwissenschaftlern – und umgekehrt.« Die negative Konnotation von biologistischem Argumentieren sei ihm vorher gar nicht bekannt gewesen. »Viele meiner Freunde sind Evolutionsbiologen, die ähnlich denken.« Wir lachen beide. Er sagt, es sei für ihn umso interessanter gewesen, die kulturwissenschaftliche Sichtweise kennenzulernen. Auf meine Frage, ob er dieser denn auch etwas abgewinnen könne, ruft er: »Natürlich! Natürlich! Es war spannend, diese andere Sicht auf die Welt kennenzulernen. Ich sage immer: Der Mensch ist die kulturellste aller Tierarten. Wir lernen am meisten voneinander, geben unheimlich viel weiter.«
Das ist für Meyer die Grundthese, die man annehmen muss, um die evolutionsbiologischen Argumente nachzuvollziehen: Dass der Mensch ein Tier ist, mit einer sehr, sehr langen evolutionären Vorgeschichte. »Auch der Mensch ist ein Produkt der Evolution«, sagt Meyer. »Man kann durch das Studium anderer Tierarten, insbesondere unserer nächsten Verwandten, viel lernen. Wir sind ja nicht separat erschaffen worden.«
Die entscheidende Frage ist doch aber: Wie weit ist unser Verhalten heute noch biologisch zu begründen? »Das hängt vom Einzelfall ab«, meint Meyer. »Es gibt biologische Erklärungen für unser Verhalten und kulturelle Prägungen.« In welchem Maße die Natur noch greift, »hängt auch davon ab, was erforscht wird«. Erblichkeit, so Meyer, könne nur in einer bestimmten Umwelt gemessen werden. Und nichts sei nur genetisch oder nur umweltbedingt. »Es ist fast immer etwas von beidem. Als Evolutionsbiologe vertrete ich den Standpunkt, dass sich viele unserer Verhaltensweisen aus der Evolution ergeben.« Schon verständlich, bei dem Beruf. Gerade Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sagt Meyer, seien biologisch leicht zu erklären. Aber: »Es ist selbstverständlich kompliziert, dies genauer zu erforschen. Wir können keine Kaspar-Hauser-Experimente machen.«
Warum also wollen Menschen, evolutionsbiologisch begründet, Kinder bekommen? »Männer«, so Meyer, »sollten möglichst viele Kinder haben und möglichst viele Frauen befruchten wollen, um ihre eigenen Gene und die Gene ihrer Verwandten in der nächsten Generation besonders häufig repräsentiert zu haben.« Und Frauen? »Genauso. Das Diktat der biologischen Fitness betrifft beide.«
Interessant an der evolutionsbiologischen Begründung Meyers ist für mich, dass wir unser Leben entgegen dieser Motivation gestalten. In Deutschland leben die meisten Menschen noch immer monogam, den eigenen Samen möglichst weit zu verbreiten klappt da nicht. Meyer stimmt mir zu. »Ein Argument, das dafür spricht, dass Monogamie eher nicht die ursprüngliche Sache des Homo sapiens ist, ist die Größe der Hoden.« Menschen produzierten viel mehr Samen, als eigentlich gebraucht würde. Solche anatomischen Hinweise sprechen laut Meyer dafür, dass Monogamie nicht biologisch begründet ist. »In vielen Kulturen leben die Menschen ja sowieso polygam, meist seriell oder sogar simultan.« Die Ehe als monogame Beziehungsform ist aus soziologischer Perspektive übrigens deswegen eingeführt worden, weil der Mann kontrollieren wollte, dass die Kinder auch wirklich von ihm sind.
Wenn ich mir also anschaue, wie wir Menschen in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben, dann hat das nicht mehr viel mit dem evolutionsbedingten Willen zur Fortpflanzung zu tun. Wir handeln »wider unsere Natur«, so Meyer. »Wir weißen westlichen Akademiker machen in dieser Hinsicht ja alles falsch, weil wir viel zu spät und viel zu wenig Kinder bekommen.« Ihm ist klar, dass der Kinderwunsch, den Menschen heute verspüren, nicht mehr rein evolutionsbiologisch zu begründen ist. »Das ist nicht die einzige Erklärung. Aber es ist für mich die Anfangserklärung, die es zu widerlegen gilt.«
Die Erklärungen der Biologie leuchten mir ein. Ich glaube auch, dass wir unsere biologische Prägung sicher nie ganz abgeschüttelt haben, müssen wir ja auch gar nicht. Doch wir Menschen haben uns schon recht weit von evolutionsbiologischen Beweggründen entfernt, uns zu kulturellen und sozialen Wesen entwickelt. Ich frage mich, welche Erklärung die Soziologie dafür hat, dass wir Menschen uns heute überhaupt noch fortpflanzen. Andere Dinge, etwa die Polygamie, haben wir ja auch hinter uns gelassen (zumindest manche von uns).
Eine umfassende soziologische Abhandlung zu dem Thema stammt aus dem Jahr 1973.4 Die Autoren Lois und Martin Hoffman stellen darin fest, dass sich bis dahin kaum jemand damit beschäftigt hat, warum Menschen sich Kinder eigentlich aus einer emotionalen Motivation heraus wünschen. Es sei stattdessen fast immer nur um ökonomische Überlegungen gegangen. Dabei verändern sich die Zeiten. Bekamen Menschen in den vergangenen Jahrhunderten Kinder, um sich wirtschaftlich abzusichern, um das Feld zu bestellen, um eine Altersvorsorge zu haben und, last but not least, weil sie nicht verhüten konnten, so haben sich die Gründe in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Lois und Martin Hoffman führen insgesamt neun Motive an, die ihrer Meinung nach erklären, was den Wert von Kindern in der Gesellschaft heute ausmacht. Demnach ist es die Gesellschaft, die unseren Kinderwunsch formt: Wir wollen sein wie alle, wollen der Norm entsprechen, gleichzeitig aber unsere Identität durch Kinder stärken. Wir erhoffen uns Spaß und Kreativität und wir gehen davon aus, dass wir der Gesellschaft nützen, wenn wir Humankapital beisteuern, also Kinder kriegen.
Die Soziologie-Professorin Michaela Kreyenfeld, die an der Hertie School in Berlin lehrt, erklärt es mir am Telefon noch einmal genauer. Kinder seien früher ein Garant für eine Altersabsicherung gewesen. »Die großen Umbrüche im Rückgang der Kinderzahlen werden mit dem Wandel des Nutzens von Kindern erklärt. Wir arbeiten überwiegend nicht mehr auf dem Feld, da braucht man sie nicht mehr.« Warum will man heute überhaupt noch Kinder, wenn die Altersversicherung nun auch staatlich gewährleistet wird? »Daran arbeiten wir Soziologen uns unter anderem ab«, antwortet Kreyenfeld. »Wir versuchen empirisch zu erfassen, warum und wie viele Kinder sich die Menschen heute wünschen.«
Heute stünden ganz andere Dinge im Vordergrund, wenn es darum geht, Kinder zu kriegen. Andere Bedürfnisse und Präferenzen. »Liebe, Gegenüberspiegelung im anderen, Familie.« Das sehe man auch bei Patchworkfamilien, sogenannten Fortsetzungsfamilien. »Wenn Leute schon Kinder haben, bekommen sie mit einem neuen Partner oft noch ein weiteres Kind – weil sie mit dem auch noch mal eine Familie konstituieren wollen. Familie wird als Wert gesehen, mit dem man den Partner bindet und die Beziehung festigt.« Über Muttersein und Vatersein definiert man außerdem noch immer einen gewissen Status in der Gesellschaft. Man hat etwas geleistet, einen Beitrag in Form von neuen Erdenbürgern (und zukünftigen Steuerzahlern).
Dass ich mich seit etwa einem Jahr frage, ob ich mir Kinder wünsche, ist laut Michaela Kreyenfeld übrigens recht eindeutig zu erklären. »Die dreißig ist nicht in Stein gemeißelt, aber das Durchschnittsalter, in dem Frauen derzeit Kinder bekommen.« Im Jahr 2019 waren Mütter in Deutschland bei der Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich 30,1 Jahre alt. In genau diesem Alter habe ich diesen bestimmten Druck verspürt. Mich gefragt: Muss ich auch?
Aber wollen wir heute denn wirklich nur noch aus kulturellen und emotionalen Gründen Kinder? Sind Kinder unser emotionales i-Tüpfelchen, das unseren German Dream von Heirat, Kind und Eigenheim perfekt macht? »Es gibt Kollegen, die sehen das anders«, meint Kreyenfeld dazu. »Eine Kollegin etwa hat über die Mädchenpräferenz in der ehemaligen DDR geschrieben. Wenn ein Paar zwei Söhne hatte, hat es eher noch mal versucht, ein drittes Kind zu bekommen – in der Hoffnung auf eine Tochter. Dahinter steckte der Wunsch, ein Mädchen zu bekommen, weil die sich später mit höherer Wahrscheinlichkeit um die pflegebedürftigen Eltern kümmern würden.« Ein durchaus ökonomisches Argument. Viele Menschen, so Kreyenfeld, sorgten sich außerdem vor Einsamkeit im Alter. Allerdings: Auch hier sei die empirische Evidenz dünn. »Die Lebenszufriedenheit von Leuten mit Kindern und von Kinderlosen unterscheidet sich im Alter gar nicht so deutlich.«
Ich skype noch mit einem weiteren Soziologen, Johannes Kopp, Professor an der Universität Trier. Seiner Meinung nach ist die Interaktion mit Kindern für uns Menschen generell etwas Positives. »Man sieht Kinder gerne aufwachsen, man hat Kinder gern um sich.« Das sei ein gängiges Motiv: »Dass Kinder einen Wert an sich darstellen.«
Beziehungen und Kinder, das sagen mir sowohl Kopp als auch Kreyenfeld, sind für uns Menschen etwas, das einfach zum Leben dazugehört. Auch wenn der Lebensweg gesellschaftlich vielleicht nicht mehr so eindeutig vorgeschrieben ist, haben die meisten Menschen doch nach wie vor eine sehr genaue Vorstellung davon, was dem einen, guten Leben nicht fehlen darf.
Trotzdem lassen wir uns viel öfter scheiden und kriegen immer weniger Kinder als früher. Der Vorstellung, die wir von uns selbst und unserem Leben haben oder die wir zumindest glauben haben zu müssen, entsprechen wir also gar nicht mehr. »Es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie die Fertilität, also das ›Kinderkrieg-Verhalten‹, sich verändert hat«, sagt Kopp. »Die Studie betrachtet die unterschiedlichen Jahrgänge im Beziehungsverlauf. Das Ergebnis war eigentlich recht einfach: Es hat sich nichts geändert. Innerhalb von Beziehungen bekommen die Frauen unverändert oft Kinder.« Was aber hat sich dann geändert? »Die Zahl von Beziehungen. Man findet nicht mehr so oft den richtigen Partner. Wenn man heute nicht mehr zufrieden ist, wenn in Beziehungen etwas ernsthaft nicht mehr stimmt, dann löst man’s auf.« Was er, Kopp, durchaus gut finde. Auch ich denke: Die Scheidung ist immerhin ein Instrument, das Frauen viel Freiheit und Unabhängigkeit beschert hat und sie auch vor großem Unglück, vor Unterdrückung und Gewalt schützt.
Wir sind heute also wählerischer, was unsere Partner angeht, finden den richtigen Partner oft auch immer später – und kriegen dementsprechend seltener Kinder.
Unterscheidet sich aus soziologischer Sicht denn der Kinderwunsch bei Männern und Frauen? »Der Kinderwunsch bei Männern ist oft ein bisschen diffuser als bei Frauen, weil die Umsetzung des Kinderwunschs dann häufig doch eher von der Partnerin abhängt«, sagt Michaela Kreyenfeld. Das fasziniert mich. »Diffus« ist genau das Wort, mit dem ich auch meine eigenen Gefühle zu diesem Thema beschreiben würde.
»Ich denke«, entgegnet Kreyenfeld, »die meisten Wünsche, die wir haben, sind diffus. Ob wir heiraten oder nicht heiraten – das sind alles diffuse Wünsche. Ob sie sich dann in Verhalten manifestieren, hängt von vielen Dingen ab. Das sind die Rahmenbedingungen, die uns im Lebenslauf treffen – oder auch nicht treffen.«
Vielleicht, dämmert es mir, ist es also ganz normal, dass das Bedürfnis nach Kindern und Familie und Heirat nicht klar ausformuliert in mir liegt und glänzt, sondern unbestimmt und latent vor sich hin wabert. Genauso diffus habe ich allerdings, das muss ich zugeben, auch den Wunsch nach einer Beförderung in mir. Den Wunsch, noch mal in Berlin zu leben oder in London. Den Wunsch, eines Tages irgendwo Chefin zu sein. Den Wunsch, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, entschleunigter zu leben, weniger zu arbeiten, aber dank irgendeines Geldsegens trotzdem gut leben zu können. Den Wunsch, jeden Morgen zu meditieren und ausschließlich vegan zu leben.
Was aus statistischen Erhebungen zumindest deutlich hervorgeht: Kinder und Ehe machen die meisten Menschen tatsächlich glücklicher. »Die empirische Evidenz«, so Kreyenfeld, »ist da schon ziemlich klar, dass die Lebenszufriedenheit von Eltern im Jahr der Geburt des Kindes extrem nach oben geht – gerade bei der Geburt des ersten Kindes.« Die gehe dann allerdings auch schnell wieder runter. »Aber erst einmal ist die Geburt des Kindes für die Mehrzahl der Menschen ein Ereignis, das mit sehr vielen positiven Dingen verbunden wird.« Na, immerhin. Warum aber zweifle ich, zweifeln immer mehr Frauen an diesem Lebensweg, an diesem ausbuchstabierten Traum vom eigenen Kind?
Michaela Kreyenfeld meint dazu: »Die normativen Kräfte unserer Gesellschaft sind einfach nicht mehr so groß, dass Familie, Heirat, Kinder der vorgezeichnete Lebenslauf sind. Die Soziologen versuchen es mit dem Schlagwort ›Individualisierung‹ zu beschreiben. Das ist so gemeint, dass die gesellschaftlichen Normen nicht mehr vorgeben, was zu tun ist. Der biografische Spielraum ist größer geworden.«