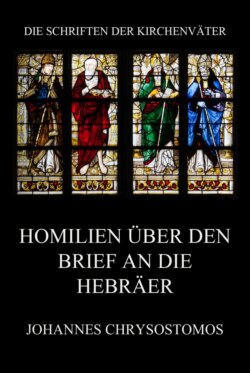Читать книгу Homilien über den Brief an die Hebräer - Johannes Chrysostomos - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünfte Homilie.
ОглавлениеI.
16.17. Denn nirgends kommt er Engeln zu Hilfe, sondern dem Samen Abrahams kommt er zu Hilfe. Darum mußte er in Allem seinen Brüdern gleich werden.
Da Paulus die große Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe gegen das Menschengeschlecht darstellen will, unterzieht er nach den Worten: „Da nun die Kinder Fleisches und Blutes theilhaftig geworden sind, so hat auch er gleichfalls sich derselben theilhaftig gemacht,“ diese Stelle einer näheren Erörterung, indem er sagt: „Denn nirgends kommt er Engeln zu Hilfe.“ Nimm diese Worte nicht so schlechthin und betrachte es nicht als eine unbedeutende Sache, daß er unser Fleisch angenommen, denn nicht Engeln hat er diese Gnade erwiesen, weßhalb er auch sagt: „Denn nicht Engeln kommt er zu Hilfe, sondern dem Samen Abrahams kommt er zu Hilfe.“ Was ist Das, was er sagt? Nicht die Natur eines Engels nahm er an, sondern die menschliche. Was bedeutet der Ausdruck: „kommt zu Hilfe“? Nicht die Natur der Engel, sagt er, hat er gewählt, sondern die unsere. Warum aber sagt er denn nicht: „Er hat angenommen,“ sondern bedient sich des Ausdruckes: „kommt zu Hilfe“? Dieser bildliche Ausdruck ist von der Art und Weise Derjenigen entlehnt, welche Solche verfolgen, die sie zur Rückkehr veranlassen wollen, und die Alles aufbieten, die Flüchtlinge zu erfassen und, die entrinnen wollen, festzuhalten. Denn der von ihm wegeilenden Natur, die von ihm weit sich entfernte (denn88 „wir waren Gott entfremdet und ohne Gott in der Welt“), ist er nachgefolgt und hat sie festgehalten. Hieraus beweist er, daß einzig die Menschenfreundlichkeit, die Liebe und die Fürsorge (Gottes) Dieses gethan hat. Wie er daher in den Worten: „Sind sie nicht alle dienende Geister, ausgesandt zum Dienste um Derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen?“89 seinen großen Eifer um das Wohl der menschlichen Natur zeigt, und wie sehr Gott für dasselbe besorgt sei: so ist auch Das, was er hier durch einen Vergleich zeigt, noch viel größer; denn „nicht Engeln,“ sagt er, „kommt er zu Hilfe.“ Denn es ist in der That etwas Großes. Wunderbares und Erstaunliches, daß nun Fleisch von unserem Fleische in der Höhe thronet und angebetet wird von Engeln und Erzengeln, von den Seraphim und den Cherubim. Wenn ich Dieß manchmal in meinem Geiste erwäge, gerathe ich ganz ausser mich und verliere mich in erhabene Gedanken über das Menschengeschlecht; denn ich sehe die großen und glänzenden Vorspiele90 und die große Sorgfalt Gottes für unsere Natur. Und er sagt nicht einfach: „Den Menschen ist er zu Hilfe gekommen,“ sondern weil er sie erheben und zeigen wollte, daß ihr Geschlecht groß und ehrenvoll sei, spricht er: „sondern dem Samen Abrahams kommt er zu Hilfe.“
„Darum mußte er in Allem seinen Brüdern gleich werden.“ Was heißt Das: „in Allem“? Er wurde geboren, will er sagen, genährt, wuchs heran, duldete Alles, was nothwendig war, und endlich starb er; das heißt „in Allem den Brüdern gleich werden“. Denn nachdem viel über seine Majestät und seine göttliche Ehre gesagt worden war, verbreitet er sich in der ferneren Rede über die Menschwerdung; und da staune über die Klugheit und Kraft, womit Dieß geschieht, wie er es als die Frucht seiner großen Liebe darstellt, daß er uns gleich geworden; was ein kräftiger Beweis seiner großen Fürsorge war. Denn nachdem er oben gesagt: „Da nun die Kinder Fleisches und Blutes theilhaftig geworden sind, so hat gleichfalls auch er sich derselben theilhaftig gemacht.“ spricht er nun hier, „daß er in Allem den Brüdern gleich geworden sei,“ als wollte er sagen: Er, der so groß und der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist, der die Welt erschaffen hat und sitzet zur Rechten des Vaters, wollte in liebevoller Fürsorge in Allem unser Bruder werden, und darum verließ er die Engel und die himmlischen Mächte und stieg zu uns herab und kam uns zu Hilfe. Erwäge, wie viel Gutes er uns gethan hat! Er hat den Tod vernichtet, uns aus der Tyrannei des Teufels errettet und von der Knechtschaft befreit und dadurch, daß er unser Bruder geworden, uns hochgeehrt, aber nicht allein durch seine Bruderschaft, sondern auch durch unzähliges Andere uns ausgezeichnet; denn er wollte auch unser Hohepriester beim Vater sein; Paulus fügt nämlich bei: „Damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott.“ Darum, will er sagen, hat er unser Fleisch angenommen, nur aus Menschenfreundlichkeit, damit er sich unser erbarme; denn es besteht kein anderer Grund der Erlösung als nur dieser allein. Er sah nämlich, wie wir darniederlagen, in Gefahr waren, zu Grunde zu gehen, unter der Tyrannei des Todes standen, - und er erbarmte sich. „Um zu versöhnen,“ heißt es, „die Sünden des Volkes, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester.“ Was heißt aber Das: „ein treuer“? Ein wahrer, der da Macht hat; denn ein wahrer Hoherpriester ist einzig und allein der Sohn, der Diejenigen, deren Hoherpriester er ist, von den Sünden zu erlösen vermag. Um nun ein zu unserer Reinigung wirksames Opfer zu bringen, wurde er Mensch. Darum fügt er die Worte hinzu: „vor Gott,“ d. h. in Beziehung auf Gott. Wir waren, sagt er, Feinde Gottes, schuldbeladen, mit Schmach bedeckt: es war Niemand, der für uns ein Opfer dargebracht hätte. In diesem Zustande gewahrte er uns und erbarmte sich, indem er nicht einen Hohenpriester bestellte, sondern selbst ein treuer Hoherpriester wurde. Um nun zu zeigen, wie treu er sei, fügt er bei: „Um zu versöhnen die Sünden des Volkes.“
18. Denn darin, worin er selbst versuchtworden und gelitten hat, kann er auch Denen, die versucht werden, helfen.
II.
Das ist sehr niedrig und gering und Gottes unwürdig. „Denn worin er selbst,“ heißt es, „gelitten hat.“ Hier spricht er aber von dem Menschgewordenen; vielleicht sind diese Worte auch gesagt, um die Zuhörer recht zu überzeugen und um ihrer Schwäche willen. Was er aber sagt, hat diesen Sinn: durch selbsteigene Erfahrung kennt er unsere Leiden, und diese sind ihm durchaus nicht unbekannt; denn er weiß sie nicht nur als Gott, sondern auch als Mensch kennt er sie durch selbstgemachte Erfahrung. Vieles hat er gelitten, darum weiß er auch Mitleid zu haben. Wohl ist Gott leidensunfähig; allein hier ist die Rede von der Menschheit, wie wenn er sagte: Die menschliche Natur Christi hat viele Leiden erduldet. Er weiß, was Trübsal ist; er weiß, was Versuchung ist, nicht weniger als wir, die wir leiden; denn er selbst hat gelitten. Was will also Das sagen: „Er kann Denen, die versucht werden, helfen“? So viel, als wenn man sagte: Mit vieler Bereitwilligkeit wird er seine helfende Hand ausstrecken; er ist voll Mitleid. Da die Juden etwas Großes sein wollten und mehr als die Heidenchristen beanspruchten, so zeigt er, ohne Die aus dem Heidenthum zu verletzen, daß sie einen Vorzug besäßen. Worin bestand denn derselbe? Darin, daß aus ihrer Mitte das Heil stammt, daß er ihnen zuerst zu Hilfe gekommen, daß er von ihnen Fleisch angenommen. „Denn nicht Engeln,“ heißt es, „kommt er zu Hilfe, sondern dem Samen Abrahams kommt er zu Hilfe.“ Dadurch ehrt er auch den Patriarchen und zeigt, was es heisst „Samen Abrahams“. Er ruft ihnen die demselben gemachte Verheissung: „Dir und deinem Samen will ich dieses Land geben“91 in’s Gedächtniß zurück und zeigt auf die kürzeste Weise die durch gemeinsame Abstammung nahe Verwandtschaft. Weil aber diese Verwandtschaft nicht von großer Wichtigkeit war, kommt er wieder weitläufiger auf die durch die Menschwerdung vollbrachte Erlösung zu sprechen und sagt: „Um zu versöhnen die Sünden des Volkes.“ Denn daß er Mensch werden wollte, war schon ein Zeichen großer Fürsorge und Liebe; - nun ist es aber nicht Dieß allein, sondern es sind auch die unsterblichen Güter, welche uns durch ihn bereitet werden. - „Um zu versöhnen die Sünden des Volkes.“ Warum sagt er nicht: des Erdkreises, sondern: „des Volkes“? Hat er ja doch unser aller Sünden getragen. Weil er bis dahin von ihnen gesprochen. So sagte ja auch der Engel zu Joseph: „Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erlösen.“92 Denn Das sollte zuerst geschehen; darum kam er, um Diese (die Juden) selig zu machen, und durch Diese dann Jene (die Heiden), obgleich das Gegentheil stattfand. Dieß sagten auch die Apostel vom Anfang: „Euch zuvörderst hat Gott seinen Sohn, den er erweckt hat, gesandt, daß er euch segne;“93 und wieder: „Euch ist das Wort des Heiles gesandt.“94 Hier zeigt er den Vorzug des jüdischen Stammes, indem er sagt: „Um zu versöhnen die Sünden des *Volkes.“95 Einstweilen spricht er sich so aus. Daß aber der Heiland (Jesus) wirklich es ist, der die Sünden nachläßt, zeigte er bei dem Gichtbrüchigen durch die Worte: „Deine Sünden sind dir vergeben“96 und bei der Taufe; denn er sagt ja zu seinen Jüngern: „Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes!“97 Da er aber Fleisch angenommen, bespricht Paulus im Verlaufe der Rede ohne befürchtende Rücksicht das Unerhabene in ihm; denn siehe, was er nun sagt!
Kap. III
1.2. Weßhalb, heilige Brüder, Mitgenossen des himmlischen Berufes, sehet auf Jesum, den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, welcher treu ist Dem, der ihn gemacht hat, wie auch Moses in dem ganzen Hause desselben.
Indem er ihn durch einen Vergleich über Moses stellen will, lenkt er die Rede auf das Gesetz des Hohenpriesterthums; denn von Moses hatten sie alle eine nicht geringe Meinung. Gleich schon streut er den Samen der Auszeichnung. Er beginnt von dem Fleische, steigt aber dann zur Gottheit empor, wo kein weiterer Vergleich mehr stattfinden konnte. Da er vom Fleische anfängt, stellt er eine Ähnlichkeit dar in den Worten: „wie auch Moses in dem ganzen Hause desselben“. Er zeigt aber nicht gleich im Anfang den Vorrang, damit der Zuhörer nicht zurückschrecke und rasch die Ohren verstopfe; denn obgleich sie gläubig waren, bewahrten sie dennoch dem Moses immer noch eine große Verehrung. - „Welcher treu ist,“ sagt er, „Dem, der ihn gemacht hat.“ Wozu hat er ihn gemacht? Zum Apostel und Hohenpriester. Hier redet er nicht von seiner göttlichen Wesenheit, sondern einstweilen nur von seiner menschlichen Würde. „Wie auch Moses in dem ganzen Hause desselben,“ d.h. im Volke oder im Tempel. Hier aber haben die Worte: „in dem Hause desselben“ den Sinn, als wenn man sagen würde: in Bezug auf Alles, was sich im Hause befindet; denn wie ein Aufseher und Hausverwalter stand Moses unter dem Volke. Daß das Wort „Haus“ hier die Bedeutung von Volk hat, beweisen die Worte: „Welches Haus wir sind,“98 d. i. in dessen Besitz wir sind. Dann der Vorzug:
3. Denn um so größerer Herrlichkeit ist Jener würdig geachtet worden vor Moses - nun ist wieder die Rede vom Fleische: je größere Ehre vor dem Hause Dem gebührt, der es gebaut hat.
III.
Auch er, will er sagen, gehörte zum Hause. Er gebraucht aber nicht die Worte: Dieser war Knecht, Jener aber Herr, sondern läßt Dieß nur verdeckt durchleuchten. Wenn das Volk das Haus und er vom Volke war, so gehörte ja auch er zum Hause; denn so pflegen ja auch wir zu sagen: Dieser oder Jener ist aus diesem oder jenem Hause. Hier aber sagt er Haus und nicht Tempel; denn diesen hat nicht Gott erbaut, sondern die Menschen; der ihm aber, dem Moses nämlich, das Dasein gegeben, ist Gott. Betrachte, wie er verdeckt den Vorrang deutlich werden läßt. „Treu war er,“ heißt es, „in dem ganzen Hause desselben,“ und er selbst war vom Hause, d. h. vom Volke. In größerer Ehre steht der Künstler als seine Werke; aber auch der Baumeister (genießt höhere Ehre) als das Haus, das er gebaut hat.
4. Der aber Alles erschaffen hat, ist Gott.
Siehst du, daß er nicht vom Tempel, sondern vom ganzen Volke redet?
5. Und Moses war zwar treu in dem ganzen Hause desselben als Diener zur Bezeugung Dessen, was verkündet werden sollte.
Siehe, wie noch ein anderer Vorzug besteht, - aus dem Verhältniß von Sohn und Dienern. Siehst du, wie er die wahre Abstammung durch die Benennung „Sohn“ andeutet?
6. Christus aber ist als Sohn in dem ihm eigenen Hause.
Siehe, wie er Werk und Meister, Diener und Sohn unterscheidet; der eine tritt in die väterlichen Besitzungen als Herr ein, der andere aber als Knecht. - „Welches Haus wir sind, wenn wir anders das Vertrauen und die herrliche Hoffnung bis an’s Ende festhalten.“ Hier ermahnt er sie wieder, fest zu stehen und nicht zu fallen; denn das Haus Gottes, sagt er, werden wir sein, wie es Moses war, wenn wir andere das Vertrauen und die herrliche Hoffnung bis an’s Ende festhalten. Wer also durch die Prüfungen schmerzlich berührt wird und zu Fall kommt, kann sich nicht rühmen, und wer sich schämt und sich verbirgt, hat kein Vertrauen. Wer sich von Schmerz überwältigen läßt, bleibt ohne Ruhm. Dann aber spendet er ihnen auch wieder Lob mit den Worten: „Wenn wir anders das Vertrauen und die herrliche Hoffnung bis an’s Ende festhalten,“ wodurch er zeigt, daß sie bereits begonnen haben. Es ist also nothwendig, bis an’s Ende auszuharren und nicht bloß einfach zu stehen, sondern auch eine feste Hoffnung in der Überzeugung des Glaubens zu haben, ohne in den Prüfungen wankend zu werden. Auch darfst du dich nicht über die zu menschlich klingende Redeweise: „selbst versucht“99 wundern. Denn wenn die Schrift von dem Vater, der nicht Mensch wurde, sagt: „Vom Himmel schaute der Herr, und er sah alle Menschenkinder,“100 d. h. er gewann über Alles eine ganz genaue Kenntniß; und wieder: „Darum will ich hinabgehen und sehen, ob sie das Geschrei im Werke vollbracht haben;“101 und wieder: „Gott kann die Laster der Menschen nicht ertragen;“ - wenn die göttliche Schrift, sage ich, die Größe des Zornes anzeigt: so können noch viel mehr von Christus, der im Fleische gelitten, solch menschliche Zustände ausgesagt werden. Denn da viele Menschen glauben, daß vor Allem die Erfahrung eine zuverlässige Erkenntniß gewähre, so wollte er zeigen, daß Derjenige, welcher gelitten, wisse. was die menschliche Natur zu leiden hat. - „Weßhalb (ὅϑεν), heilige Brüder,“ sagt er. Der Ausdruck: „weßhalb“ steht hier statt: „darum“ (διὰ τοῦτο). „Mitgenossen des himmlischen Berufes.“ Suchet also hier Nichts, da ihr dorthin berufen seid; denn dort ist der Lohn, dort die Vergeltung. - Was besagen aber die Worte: „Sehet auf Jesum Christum, den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, welcher treu ist Dem, der ihn gemacht hat, wie auch Moses in dem ganzen Hause desselben“? Was heißt Das: „Welcher treu ist Dem, der ihn gemacht bat“? Es heißt: Welcher als Verwalter für Das besorgt ist, was ihm anvertraut worden, und nicht gestattet, daß es planlos verschleudert werde. „Wie auch Moses in dem ganzen Hause desselben,“ d.h. betrachtet, wer der Hohepriester und wie er beschaffen ist, und ihr bedürfet deines weiteren Trostes, keiner anderen Ermunterung. Apostel (Gesandten) nennt er ihn, weil er gesendet wurde, und „Hoherpriester unseres Bekenntnisses“ ist gleichbedeutend mit: Hoherpriester unseres Glaubens. Schön sagt er: „wie auch Moses“; denn auch er hatte die Sache des Volkes zu verwalten, wie auch Jener das Vorsteheramt ausübte, aber in einem wichtigeren und höheren Verhältnisse; denn Moses stand da als Diener, Christus aber als Sohn; Jener verwaltete fremdes. Dieser aber besorgte sein Eigentum. - „Zur Bezeugung Dessen, was verkündet werden sollte.“ Was sagst du? Nimmt Gott das Zeugniß eines Menschen an? Ganz gewiß. Denn wenn er Himmel und Erde und Hügel zu Zeugen anruft, da er durch den Propheten spricht: „Höret, ihr Himmel, und nimm es zu Ohren, Erde, denn der Herr redet;“102 und: „Höret, ihr Berge und ihr Grundvesten der Erde, daß der Herr in’s Gericht geht mit seinem Volke!“103 - so wird er um so mehr die Menschen zu Zeugen nehmen. Was heißt Das: „zur Bezeugung“? Daß sie Zeugen seien, wenn sie unverschämt wären. „Christus aber als Sohn;“ Jener hat über Fremdes die Sorge. Dieser aber besorgt sein Eigenthum. „Die herrliche Hoffnung.“ Treffend sagt er: „Hoffnung“; denn alle Güter fußten ja auf der Hoffnung. Diese muß aber so festgehalten werden, daß man sich derselben rühme, als besäßen wir dieselben schon wirklich. Darum sagt er: „die herrliche Hoffnung“ und fügt bei: „wenn wir dieselbe bis an’s Ende festhalten;“ denn durch die Hoffnung sind wir gerettet worden. Wenn wir also durch die Hoffnung Erlösung gefunden und mit Geduld warten, so wollen wir auch wegen der Gegenwart nicht mißmuthig werden und nicht schon jetzt suchen, was uns die Zukunft verheißt; „denn die Hoffnung,“ heißt es, „welche man sieht, ist keine Hoffnung.“104 Denn da die Güter so groß sind, will er sagen, können uns dieselben in diesem vergänglichen Leben nicht zu Theil werden. Warum hat er sie uns aber verheissen, wenn er sie uns hienieden nicht geben will? Damit er durch diese Verheissung die Seelen erfreue, durch das Versprechen den Muth stärke und unsern Sinn ermuntere und belebe. Deßhalb ist Dieß alles geschehen.
IV.
Lassen wir uns also nicht aus der Fassung bringen! Niemand beunruhige sich, wenn er sieht, daß es den Bösen gut geht! Hier finden weder das Laster noch die Tugend ihre Vergeltung. Sollte Dieß aber sowohl in Bezug auf das Laster als auf die Tugend etwa stattfinden, so geschieht es doch nicht nach Gebühr, sondern überhaupt nur, gleichsam als Vorgeschmack des Gerichtes, damit Diejenigen, welche an keine Auferstehung glauben, dadurch schon hienieden gezüchtiget werden. Sehen wir also, daß ein Bösewicht reich ist, so soll uns Das nicht entmuthigen; sehen wir, daß ein braver Mann schwere Leiden erduldet, so sollen wir uns nicht in Klagen ergießen; denn jenseits glänzen die Kronen, jenseits auch warten die Strafen. Übrigens aber kommt es nicht vor, daß der Böse ganz und gar schlecht ist, sondern noch immer etwas Gutes an sich hat; auch nicht, daß der Gute allseitig vollkommen ist, sondern noch immer an gewissen Fehlern krankt. Wenn nun der Lasterhafte bei seinen Unternehmungen Glück hat, so wisse, daß Dieß nur zu seinem eigenen Verderben ausschlägt; denn damit er für das wenige Gute hier schon den Lohn empfange, jenseits aber der vollen Strafe verfalle, deßhalb empfängt er zeitliches Glück. Und überaus glücklich ist Jener zu preisen, der hienieden gezüchtiget wird, damit er frei von allen Sünden, ruhmvoll und rein und ohne Furcht vor der Rechenschaft dieses Leben verlasse. Dieses lehrt uns auch Paulus, indem er spricht: „Darum sind unter euch viele Kranke und Schwache, und Viele schlafen;“105 und wieder: „Einen Solchen übergebet dem Satan zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde.“106 Und der Prophet spricht: „Sie hat Doppeltes aus der Hand des Herrn empfangen für all ihre Sünden;“107 und wiederum David: „Sieh’ auf meine Feinde, denn ihrer sind viele, und mit ungerechtem Hasse hassen sie mich, und vergib alle meine Sünden!“108 Und wieder ein Anderer: „Herr, unser Gott, gib uns Frieden, denn all unser Thun thust du für uns.“109 Diese Stellen beweisen aber, daß die Guten schon hier die Strafen für ihre Sünden empfangen; wie aber die Bösen, welche schon diesseits ihr Gutes erhalten, jenseits die volle Strafe bekommen, höre, was Abraham zum Reichen spricht: „Gedenke, Sohn, daß du Gutes zurückempfangen hast in deinem Leben, Lazarus hingegen Übles.“110 (Was für Gutes?) Da er hier sagt: zurückempfangen, nicht aber: empfangen, zeigt er, daß hier Beiden zu Theil geworden, was ihnen gebührte, sowohl Dem, welcher in zeitlichem Glücke gelebt, als auch Dem, welcher von Mißgeschick heimgesucht war. Er sagt: „Darum wird Dieser getröstet;“ du siehst, daß er rein von Sünden war; „du aber wirst gepeinigt.“ Seien wir also nicht traurig, wenn wir sehen, daß es den Sündern wohlgeht, sondern freuen wir uns, wenn wir selbst Schlimmes erdulden; denn die Sünder erhalten hienieden ihre Bezahlung. Suchen wir nicht Ruhe: denn Christus hat seinen Jüngern Trübsal verkündet, und Paulus sagt: „Alle, die gottselig leben in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden.“111 Kein wackerer Streiter denkt im Kampfe an Bäder, an einen Tisch voll Speisen und Wein. - Das paßt nicht für einen Athleten, sondern für einen Feigling. Der Athlet hat es zu thun mit Staub, mit Öl, mit der Sonnenhitze, mit vielem Schweiß, mit Mühsal, mit allen Beschwernissen des Kampfes. Hier ist die Zeit des Kampfes, also auch die Zeit für Wunden und Leiden. Höre, was der heilige Paulus sagt: „So kämpfe ich, aber nicht um bloß Luftstreiche zu thun.“112 Seien wir der Überzeugung, daß unser ganzes Leben ein Kampf ist und wir nicht Ruhe suchen; zeigen wir uns nicht befremdlich in den Stunden der Trübsal: kommt es ja auch dem Kämpfer nicht fremd vor, wenn er im Kampf ist! Eine andere Zeit gibt es zum Ruhen. Durch Trübsale müssen wir vollkommen werden. Bleiben wir auch von Verfolgung und Bedrängniß verschont, so gibt es doch andere Leiden, die uns jeden Tag treffen; wollen wir uns diesen nicht unterziehen, so werden wir jene schwerlich ertragen. „Lasset euch von keiner Versuchung ergreifen als von einer menschlichen!“ heißt es.113 Beten wir also zu Gott, daß wir nicht in Versuchung fallen; sind wir in dieselbe gefallen, so wollen wir sie großmüthig ertragen. Denn kluge Männer stürzen sich nicht von selbst in Gefahren; finden sich aber Gefahren, so steht der tapfere und weise Mann fest. Werfen wir uns daher nicht ohne Grund den Gefahren entgegen; denn das ist Verwegenheit; werden wir aber ihnen entgegen geführt, indem es die Umstände fordern, dann weichen wir ihnen nicht aus! Das wäre Feigheit. Ruft uns aber die Predigt des göttlichen Wortes, so sollen wir uns nicht entziehen; ohne Grund und Zweck aber, ohne Bedürfniß und ohne den Drang der göttlichen Liebe (der Gefahr) nicht entgegen laufen; denn das wäre Prahlerei und thörichte Ruhmsucht. Sollte aber Etwas gegen die Religion geschehen, so sollten und müßten wir tausendmal sterben, nicht weichen. Fordere die Versuchungen nicht heraus, wenn dir in Bezug auf Religion und Frömmigkeit Nichts zu wünschen übrig bleibt! Wozu thörichter Weise Gefahren aufsuchen, die keinen Nutzen gewähren?
V.
Dieses sage ich euch, weil ich will, daß ihr die Gebote Christi befolget, welcher zu beten befiehlt, damit wir nicht in Versuchung fallen, und welcher verlangt, daß wir das Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. Hierin liegt kein Widerspruch, sondern vollkommene Harmonie. Sei darum so gerüstet wie ein tapferer Krieger und sei fortwährend unter den Waffen: nüchtern, wachsam, stets in Erwartung des Feindes; du aber verursache keine Kämpfe, denn Das ist nicht das Werk eines Soldaten, sondern eines Aufrührers! Ruft dich aber die Trompete der Religion, so tritt rasch vor und verachte dein Leben und schreite mit aller Herzhaftigkeit zum Kampfe; durchbrich die Reihen der Feinde, schlag dem Teufel in’s Gesicht und richte das Siegeszeichen auf! Wird jedoch der Religion kein Angriff bereitet, bedrängt Niemand unsere Dogmen und zwingt uns Niemand zu Dingen, die Gottes Willen widerstreiten, - ich spreche in Bezug auf das Leben, - so sei kein Sonderling! Das Leben des Christen muß reich sein an Blut, ja, reich an Blut, aber nicht indem man fremdes vergießt, sondern indem man bereit ist, sein eigenes fließen zu lassen. Mit solch entschlossenem Muthe wollen wir also unser eigenes Blut vergießen, wenn es für Christus sein soll, wie wenn man Wasser ausschüttet (und wie Wasser ist ja das Blut, das den Körper durchströmt), und mit einer solchen Leichtigkeit wollen wir unser Fleisch ausziehen, wie wenn man einen Mantel ablegt. Das wird aber der Fall sein, wenn wir nicht am Gelde kleben, nicht an den Wohnungen, wenn uns keine Leidenschaft fesselt, wenn wir an Nichts mehr hangen. Wenn schon Diejenigen, welche dem Soldatenleben sich widmen, Allem entsagen, sich stellen und dorthin marschiren, wohin sie der Krieg ruft, und Alles muthig ertragen: so müssen noch vielmehr wir, die wir Christi Streiter sind, also gerüstet dastehen und uns in Schlachtordnung stellen, um gegen die Leidenschaften den Kampf aufzunehmen. Es gibt jetzt keine Verfolgung, und möchte sie nimmer aufleben! Aber ein anderer Krieg ist zu führen: der Krieg gegen die Geldgier, gegen den Neid, gegen die anderen Leidenschaften. Von diesem Kriege spricht Paulus, wenn er sagt: „Wir haben nicht (bloß) zu kämpfen wider Fleisch und Blut.“114 Dieser Kampf dauert immerfort. Darum will er, daß wir immer unter den Waffen stehen. „Stehet denn,“ sagt er, „umgürtet,“ was auch für die jetzige Zeit gilt, wodurch er zeigt, daß man die Waffen nie ablegen dürfe. Schwer ist der Kampf durch die Zunge, schwer durch die Augen; diesen Kampf also sollen wir kämpfen; gewaltig ist der Kampf der Leidenschaften. Darum ergeht an den Streiter Christi der Ruf zu den Waffen. „Stehet denn,“ sagt er, „euere Lenden umgürtet,“ und fügt hinzu: „mit Wahrheit.“ Warum mit Wahrheit? Die Leidenschaft ist nämlich Täuschung und Lüge, wie auch David sagt: „Denn meine Lenden sind voll der Täuschungen.“115 Auch findet sich darin kein Vergnügen, sondern nur ein Schatten desselben. „Darum umgürtet,“ sagt er, „euere Lenden mit Wahrheit,“ d. h. mit wahrem Vergnügen, mit Sittsamkeit und Ehrbarkeit! Diesen Rath gibt er im Hinblick auf die Häßlichkeit der Sünde, und weil er will, daß alle unsere Glieder ringsum geschützt seien. „Denn der ungerechte Zorn,“ heißt es, „wird nicht ohne Strafe sein,“116 und er will uns umgeben mit Panzer und Schild. Denn ein wildes Thier ist der Zorn, das rasch dahinrennt, und man braucht tausend Wälle und Zäune, um es zu bewältigen und im Zaume zu halten. Und deßhalb hat Gott diesen Körpertheil, gerade wie von Stein, aus Knochen gebildet, indem er diese als Stütze verlieh, damit nicht, falls dieselben leicht zerbrochen oder durchschnitten würden, der ganze Körper (τὸ πν ζῶον) verderbe. Denn ein Feuer ist er (der Zorn), heißt es, und ein gewaltiger Sturm, und nicht leicht dürfte ein anderes Glied diese Gewalt aushalten können. Darum, sagen die Ärzte, sei auch dem Herzen die Lunge untergelegt, damit das Herz, gleichsam auf einem weichen Schwamme sich stützend, frei von der widerstrebenden harten Brust, ausruhe und durch die häufigen Schläge nicht verletzt werde. Wir bedürfen daher eines starken Panzers, um dieses Thier stets in Ruhe zu erhalten; aber auch das Haupt muß durch einen Helm geschützt sein. Denn weil der Verstand dort seinen Sitz hat, so kann daher, wenn die Pflichten erfüllt werden, Heilsames kommen, aber auch Unheil, wenn das Gegentheil stattfindet. Darum sagt er: „Und den Helm des Heiles.“ Denn das Gehirn ist weich von Natur, darum wird es wie von einer harten Schale durch den Oberschädel gedeckt. Für uns ist es aber die Quelle alles Guten und alles Bösen, indem dort die Erkenntniß ist von Dem, was pflichtmäßig geschehen oder nicht geschehen soll. Aber auch unsere Hände und Füße bedürfen der Waffen; - nicht diese Hände noch diese Füße, sondern wiederum die der Seele; jene, um zu besorgen, was nothwendig ist, diese, um dahin zu gehen, wohin sie die Pflicht ruft. Wir wollen uns so bewaffnen, daß wir die Feinde überwinden und die Siegeskrone erlangen in Christus Jesus, unserem Herrn, welchem mit dem Vater und dem heiligen Geiste sei Ruhm, Macht und Ehre jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.