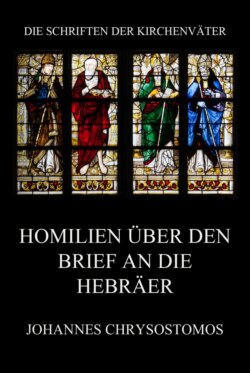Читать книгу Homilien über den Brief an die Hebräer - Johannes Chrysostomos - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweite Homilie.
ОглавлениеI.
3. Welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist, durch das Wort seiner Kraft Alles trägt und, nachdem er uns von Sünden gereiniget hat …
Wir bedürfen zwar überall eines frommen Sinnes, am meisten aber, wenn wir von Gott sprechen oder über ihn Etwas hören; denn weder ist die Zunge befähigt, Gottes Würdiges zu sprechen, noch das Ohr, etwas Solches zu hören. Ja, was rede ich von Zunge und Ohr? Denn nicht einmal der Verstand, welcher diese doch weit übertrifft, wird es vermögen, wann wir von Gott sprechen wollen, etwas Gründliches darüber zu sagen. Wenn nämlich schon der Friede Gottes allen Verstand übersteigt, und in eines Menschen Herz noch nicht gekommen ist, was Gott Denen bereitet hat, die ihn lieben, so überragt weit mehr noch er selbst, der Gott des Friedens, der Urheber aller Dinge unsere Vernunft im vollsten Maaße. Wir sollen daher mit Glauben und Frömmigkeit Alles beginnen; und wenn dann die Sprache sich unfähig fühlt, ihren Ausdrücken die rechte Tiefe zu geben, dann wollen wir ganz besonders den Herrn preisen, daß wir einen Gott haben, den unser Verstand und unsere Vernunft nimmer zu erfassen vermag. Denn Vieles, was wir von Gott erkennen, vermögen wir nicht in Worten auszudrücken, und Vieles reden wir von ihm, was wir nicht begreifen; so z. B. wissen wir, daß Gott allgegenwärtig ist; wie aber Das stattfinde, sehen wir nicht ein. Wir wissen, daß eine gewisse unkörperliche Kraft die Ursache alles Guten ist, das Wie aber kennen wir nicht. Siehe, wir reden und verstehen nicht! Ich sage: Er ist allgegenwärtig, aber ich verstehe es nicht; ich spreche: Er ist ohne Anfang, allein ich begreife es nicht; ich sage: Er hat sein Dasein durch sich selbst, und wiederum weiß ich nicht, wie ich mir Das denken soll. Es gibt nun aber auch Dinge, die wir nicht ausdrücken können; so z. B. erkennt der Verstand Etwas, wofür ihm jedoch der Ausdruck versagt ist. Und damit du dich überzeugest, daß hierin auch Paulus noch schwach ist und seine Ausdrucksweise der Vollendung entbehrt, und damit du selber erbebest und dich nicht weiteren Grübeleien hingibst, so merke auf! Nachdem er ihn Sohn genannt und als Schöpfer hingestellt hat, was fügt er hinzu? „Welcher, da er der Abglanz feiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist.“ Das aber müssen wir mit frommem Sinne aufnehmen und alles Unstatthafte davon ausscheiden. „Abglanz der Herrlichkeit,“ sagt er. Siehe nun, wie er selbst Das versteht, und darum faß’ es auch du so, nämlich: daß er (der Sohn) aus ihm sei, daß er leidensunfähiger Natur, daß er nicht weniger noch geringer sei. Denn es gibt Manche, welche dem Ausdrucke „Abglanz“ eine abgeschmackte Bedeutung beilegen. Abglanz, sagen sie, hat in sich selber keinen Bestand, sondern hat den Grund seines Daseins nur in einem Anderen. Fasse also die Sache nicht so auf und leide nicht an der Krankheit des Marcellus und des Photinus. Gleich bietet dir Paulus das Mittel, daß du nicht jener Sinnesauffassung verfallest und dich nicht von jener verderblichen Krankheit erfassen lassest. Was sagt er weiter? „Und das Ebenbild seines Wesens.“ Durch diesen Zusatz zeigt er, daß, wie der Vater in sich selbst ist und besteht und zu seinem Sein und Bestehen keines Anderen bedarf, so der Sohn ein Gleiches besitze. Mit diesen Worten will er hier zeigen, daß keine Wesensverschiedenheit zwischen ihnen bestehe, daß das Ebenbild neben dem Urbilde Selbstbestand habe und selbstwesenhaft sei. Nachdem er oben gesagt hat, daß Gott durch ihn Alles erschaffen hat, spricht er ihm hier die Selbstherrschaft zu. Denn was fügt er bei? „Da er durch das Wort Alles trägt;“ damit wir daraus nicht nur die Ebenbildlichkeit der Wesenheit entnehmen, sondern auch die Selbstmacht, womit er Alles regiert. Sieh’ also, wie er Das dem Sohne zueignet, was dem Vater eigenthümlich zugehört! Darum sagt er auch nicht einfach: „Da er Alles trägt,“ noch auch: „durch seine Kraft,“ sondern: „durch das Wort seiner Kraft.“ Denn wie wir ihn früher allmählig sich erheben und wieder herabsteigen sahen, so steigt er auch jetzt stufenweise hinauf und wieder herab, indem er spricht: „Durch den er auch die Welt gemacht hat.“ Siehe, wie er auch hier zwei Wege einschlägt! Er will uns nämlich von den Neuerungen des Sabellius und Arius, von denen der Eine den Unterschied der Person aufhebt, der Andere die eine Natur in eine Ungleichheit zertrennt, ferne halten und widerlegt alle Beide vortrefflich. Wie macht er Das? Fortwährend bespricht er Eins und Dasselbe, damit man nicht glaube, er habe keinen Daseinsursprung, noch auch, er sei verschiedener Natur mit Gott dem Vater. Und staune nicht über diese Rede, mein Lieber! Denn wenn nach einer solchen Beweisführung dennoch Manche behauptet haben, er sei anderer Natur, und ihm einen anderen Vater gegeben haben, mit dem er im Streite stehe: was würden Diese von ihm erst ausgesagt haben, wenn Paulus Dieß alles nicht mitgetheilt hätte? Wenn er nun gezwungen ist, zu heilen, dann ist er auch genöthigt, Niedriges auszusagen, wie er z. B. sich ausdrückte: „Den er zum Erben des All gesetzt,“ und: „Durch den er die Welt gemacht hat.“ Und damit er andererseits nicht verletze, so erhebt er ihn, nachdem er Niedriges von ihm ausgesagt hatte, wieder auf die Stufe der höchsten Würde und zeigt, daß er mit dem Vater gleichgeehrt und zwar so gleichgeehrt sei, daß Viele der Ansicht waren, er sei der Vater selbst. Betrachte aber seine große Klugheit. Vorerst beweist er, und zwar mit Schärfe und Gründlichkeit, daß er Sohn Gottes und von Diesem keineswegs verschiedener Natur sei; und nachdem Dieß gezeigt worden, spricht er in der Folge jegliches Hohe, was er nur immer will. Und da er, weil er Großes von ihm ausgesagt hat, Viele zu jener Ansicht veranlaßte, so stellt er zuerst Niedriges hin und steigt dann mit Sicherheit zu jeglicher Hohe empor. Nachdem er gesagt hat: „Welchen er zum Erben des All gesetzt,“ und daß er durch ihn die Welt gemacht hat, fügt er hinzu: „Da er durch das Wort seiner Kraft Alles trägt;“ denn wer mit dem bloßen Worte Alles regiert, wird auch Niemandes bedürfen, um Alles zu Stande zu bringen.
II.
Daß Dieß sich also verhalte, erkenne aus dem Verlaufe der Rede, worin er ihm die Selbstmacht zuschreibt und auch die Worte: „durch welchen“ beseitigt. Denn nachdem er durch diese Worte, was er wollte, erreicht hat, ist im Folgenden keine weitere Rede davon, sondern es heißt: „Du hast im Anfang, o Herr, die Erde gegründet, und die Werke deiner Hände sind die Himmel.“ Nirgends finden sich hier die Worte: „durch welchen“, noch daß er durch ihn die Welt gemacht hat. Wie aber? Ist sie denn von ihm nicht gemacht? Allerdings, aber nicht, wie du sprichst oder vermuthest, daß er nämlich als Werkzeug gedient, oder daß er sie nicht gemacht haben würde, falls ihm nicht der Vater die Hand gereicht hätte. Denn so wie jener Niemanden richtet, und geschrieben steht, daß er durch den Sohn richte, weil er diesen als Richter gezeugt hat, so heißt es auch, er erschaffe durch ihn die Welt, weil er ihn als Weltschöpfer gezeugt hat. Wenn nämlich er selbst den Grund des Daseins im Vater hat, um wie viel mehr die Dinge, die durch ihn geworden sind! Wenn er nun zeigen will, daß er vom Vater ist, so spricht er nothwendig Unerhabenes aus; will er aber Erhabenes melden, so greifen Das Marcellus und Sabellius gierig auf; allein die Abirrung Beider vermeidet die Kirche und hält den Mittelweg inne, indem sie weder bei dem Unerhabenen stehen bleibt, damit nicht Paulus von Samosata Boden gewinne, noch immer bei dem Hohen verweilt, sondern neuerdings dessen niedere Seite zeigt, damit Sabellius sich nicht wieder geltend mache. Er sagte: „Sohn“, und alsbald stützte sich Paulus von Samosata darauf mit der Behauptung, er sei ein Sohn wie die vielen anderen; allein der Apostel versetzt ihm einen gemessenen Schlag, indem er den Sohn einen „Erben“ nennt. Aber er (Paulus von Samosata) und Arius verharren in ihrer Unverschämtheit, indem Beide den Ausdruck: „Er hat ihn zum Erben gesetzt“ festhalten, woraus Jener den Beweis der Schwäche führen, Dieser aber seinen Kampf auch noch gegen das Folgende fortsetzen will. In den Worten: „Durch den er auch die Welt gemacht hat“ hat Paulus jenen schamlosen Samosatener ganz und gar zu Boden gestreckt; Arius aber scheint noch Kampfeskraft zu besitzen. Aber siehe, wie er auch Diesen durch die Worte: „Welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit ist,“ darniederwirft! Allein es rüsten sich wieder zum Anlauf Sabellius, Marcellus und Photinus; jedoch auch Diesen allen versetzt er einen einzigen Schlag, indem er spricht: „Und das Ebenbild seines Wesens, welcher durch das Wort feiner Kraft Alles trägt.“ Hier versetzt er auch wieder dem Marcion einen wenn auch nicht sehr kräftigen Streich, jedoch er trifft ihn; denn durch den ganzen Brief streitet er gegen sie. Allein wie ich schon gesagt habe, nennt er den Sohn den „Abglanz seiner Herrlichkeit“. Daß diese Bezeichnung eine zutreffende sei, erschließe aus den Worten Christi, die er von sich selber aussagt: „Ich bin das Licht der Welt.“14 Darum nannte er ihn aber „Abglanz“, um zu zeigen, daß er auch dort so genannt sei, und zwar offenbar als ein Licht vom Lichte. Aber nicht allein Das wird gezeigt, sondern daß er auch unsere Seelen erleuchtet hat. Durch den Ausdruck „Abglanz“ aber zeigt er die Gleichheit der Wesenheit mit dem Vater und sein nahes Verhältniß zu ihm. Betrachte, wie scharfsinnig Das ausgedrückt ist! Er nimmt eine Wesenheit und eine Person, um zwei Personen zur Vorstellung zu bringen, was er auch in Bezug auf die Erkenntniß des heiligen Geistes thut. Denn wie er sagt, daß nur eine Erkenntniß des Vaters und des heiligen Geistes sei, die thatsächlich nur eine und ohne alle Verschiedenheit ist: so hat er auch hier nur eine Bezeichnung gewählt, um zwei Wesenheiten zu zeigen. Ferner fügt er bei: „und Ebenbild;“ denn das Ebenbild ist ein anderes neben dem Urbilde, aber es ist nicht ganz und gar ein anderes, sondern nur neben dem Urbilde, da denn auch hier die Bezeichnung „Ebenbild“ nicht nur keine Verschiedenheit mit dem Urbilde, sondern vielmehr eine allseitige Ähnlichkeit zeigt. Da er ihn nun gar „Gestalt und Ebenbild“ nennt, was werden sie sagen? „Der Mensch ist ja auch ein Bild,“ heißt es.15 Wie aber? etwa so wie der Sohn? Keineswegs; denn ein Bild zeigt noch keine Wesensähnlichkeit. Und doch wird der Mensch nur insoferne ein Bild genannt, als er eine Ähnlichkeit mit ihm zeigt, wie sie im Menschen stattfinden kann. Denn was Gott im Himmel ist, Das ist der Mensch auf der Erde, nämlich in Bezug auf die Herrschaft; und wie dieser über Alles auf der Erde gebietet, so regiert Gott Alles im Himmel und auf der Erde. Übrigens wird der Mensch nicht Abbild, nicht Abglanz, nicht Gestalt genannt, was die Wesenheit oder auch die Wesensähnlichkeit anzeigt. Wie nun die Gestalt des Menschen nichts Anderes erkennen läßt als einen natürlichen Menschen, so zeigt auch die Gestalt Gottes nichts Anderes als Gott. - „Welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit ist;“ - siehe, was Paulus thut! Den Worten: „Welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit ist,“ fügt er wieder hinzu: „sitzet zur Rechten der Majestät.“ Siehe, welche Bezeichnungen er gebraucht, da er den Namen der Wesenheit selbst nirgends gefunden! Denn weder der Name „Majestät“ noch die Bezeichnung „Herrlichkeit“ können ausdrücken, was er sagen will; den (eigentlichen) Namen findet er nicht. Denn Das ist es ja, was ich Anfangs gesagt, daß wir nämlich oft Etwas erkennen, wofür uns die Bezeichnung abgeht. Denn weder ist der Ausdruck Gott der Name seiner Wesenheit, noch ist überhaupt für diese Wesenheit ein Name zu finden. Und was Wunder, daß Dieses bei Gott der Fall ist, da wohl schwerlich Jemand einen Namen zu finden vermöchte, der geeignet wäre, das Wesen eines Engels zu erklären, vielleicht nicht einmal das Wesen einer Seele (ψυχή); denn dieser Ausdruck scheint mir nicht passend, um das Wesen darzustellen, sondern das Athmen (ψύχειν) zu bezeichnen; denn für Seele findet man ja auch die Bezeichnungen Herz und Sinn gebraucht. „Schaffe, o Gott, ein reines Herz in mir!“ heißt es.16 Aber nicht allein Das; man findet auch an vielen Stellen die Seele Geist genannt. „Welcher Alles durch das Wort seiner Kraft trägt.“ Siehst du, was er sagt?
III.
Wie kannst du nun, sage mir, Häretiker, die Behauptung aufstellen, daß nach den Worten der Schrift: „Gott sprach: Es werde Licht!“ der Vater befohlen, der Sohn den Befehl ausgeführt habe? Sieh’ aber, auch hier wirkte er durch das Wort! - „Welcher,“ heißt es, „Alles trägt,“ d. h. Alles regiert und es vor dem Verfalle bewahrt; denn nicht geringer ist die Erhaltung der Welt als die Erschaffung, ja um noch Erstaunlicheres zu sagen, sie ist noch mehr. Denn erschaffen heißt aus Nichts Etwas in’s Dasein rufen; das Gewordene (die Geschöpfe) aber vor dem Zerfalle bewahren und zusammenhalten und das Widerstrebende harmonisch mit einander verbinden. Das ist groß und wunderbar und das Zeichen einer gewaltigen Macht. Um aber die Leichtigkeit anzudeuten, sagt er nicht: „welcher regiert,“ sondern: „welcher trägt,“ nach Ähnlichkeit Derer, welche Etwas einfach mit dem Finger bewegen und machen, daß es sich dreht. Hier zeigt er auch, daß der Umfang der Schöpfung groß, und daß das Große ihm Nichts sei. Ferner zeigt er in dem Ausdruck: „durch das Wort seiner Macht“, daß Alles ohne Mühe geschehe. Schön sagt er: „durch das Wort;“ denn da das Wort bei uns schwach zu sein scheint, zeigt er, daß Dieß bei Gott nicht so der Fall sei. Aber er sagt, daß er durch das Wort trage; wie er aber durch das Wort trage, fügt er nicht bei; denn Das ist unmöglich zu wissen. Darnach spricht er von der Majestät. So macht es auch Johannes; denn nachdem er gesagt, daß er Gott sei, fügt er hinzu, er sei der Schöpfer der Welt; denn was Jener in den Worten andeutet: „Im Anfang war das Wort“ und: „Alles ist durch ihn gemacht worden,“17 Das zeigt Dieser in den Worten: „Durch den er auch die Welt schuf;“ denn er zeigt, daß er sowohl Weltschöpfer, als auch vor allen Zeiten da war. Wie nun, wenn der Prophet vom Vater spricht: „Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du,“18 kann dann vom Sohne gesagt werden, daß er vor allen Zeiten da sei und das All erschaffen habe? Mehr noch: Was vom Vater gesagt wurde, der vor aller Zeit da ist, sollte man Das auch vom Sohne gesagt finden? Und wie Jener (Johannes) sagt: „Er war das Leben,“ um anzudeuten, daß er die Schöpfung erhält, weil er selbst das Leben von Allem ist, so sagt auch Dieser: „Welcher Alles trägt durch das Wort seiner Macht,“ im Gegensatz zu den Heiden, welche, sofern es auf sie ankommt, ihm die Erschaffung der Dinge und die Fürsehung absprechen und seine Macht bis zum Mond hin beschränken. - „Nachdem er uns von Sünden gereiniget hat.“ Nachdem er über jene bewunderungswürdigen großen Wahrheiten, die so erhaben sind, gesprochen, redet er auch über seine Fürsorge um die Menschen. Jene Worte: „Welcher Alles trägt“ haben auch einen weitumfassenden Inhalt, aber diese besagen viel mehr; auch sie haben den Sinn der Allgemeinheit, denn seinerseits hat er Alle erlöst. Dasselbe zeigt auch Johannes. Nachdem er durch die Worte: „Er war das Leben“ seine Fürsehung klar gemacht hatte, sagt er wieder: „Und er war das Licht,“ wodurch er Dasselbe klarmacht. „Nachdem er uns,“ sagt er, „durch sich selbst19 von Sünden gereiniget hat, sitzt er zur Rechten der Majestät in der Höhe.“ Hier gibt er zwei sehr wichtige Zeugnisse seiner Fürsorge an: daß er uns von Sünden gereiniget hat, und daß er Dieß durch sich selber gethan. Und an vielen Stellen findet man ihn es rühmend hervorheben, daß wir nicht nur mit Gott ausgesöhnt wurden, sondern auch, daß Dieß durch den Sohn geschah; denn das ohnehin so große Geschenk habe dadurch einen um so größeren Werth, weil es durch den Sohn zu Theil ward. Denn nach den Worten: „Er sitzet zur Rechten“ und: „Nachdem er uns durch sich selbst von Sünden gereiniget hat,“ wodurch er an das Kreuz erinnerte, lenkt er die Rede gleich auf die Auferstehung und die Himmelfahrt. Betrachte aber seine unaussprechliche Klugheit. Er sagt nicht: „Es wurde ihm zu sitzen befohlen,“ sondern: „Er sitzt. Dann wieder, damit du nicht wähnest, er stehe, fügt er bei: „Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt: Setze dich zu meiner Rechten?“20 „Er sitzet,“ sagt er, „zur Rechten der Majestät in der Höhe.“ Was heißt Das: „in der Höhe“? Beschränkt er Gott auf einen Ort? Mit nichten. Eine solche Meinung hat er in uns durch diese Sprache keineswegs erwecken wollen, sondern wie er durch die Worte: „zur Rechten“ ihm nicht eine Haltung gegeben, sondern gezeigt hat, daß er gleiche Ehre wie der Vater genieße, so hat er auch, indem er sich des Ausdruckes: „in der Höhe“ bediente, ihn nicht dort eingeschlossen, sondern erklärt, daß er über Alles erhaben sei und Alles übertreffe, als ob er sagte: Selbst auf den väterlichen Thron ist er gekommen. Wie also der Vater in der Höhe ist, so auch er; denn der Sitz zeigt nichts Anderes an als die gleiche Ehre. Wenn sie aber sagen, er habe gesprochen: „sitze“, so fragen wir sie, was nun? Hat er denn zu ihm so gesprochen, da er stand? Das werden sie nicht nachweisen können. Übrigens heißt es nicht, daß er befohlen oder beauftragt, sondern daß er gesprochen habe: „sitze“, und Dieß aus keinem anderen Grund, als damit du nicht glaubest, er habe keinen Daseinsursprung und keinen Daseinsgrund. Daß er deßhalb so gesprochen, ist klar aus dem Orte des Sitzens. Denn hätte er sagen wollen, er sei geringer, so würde er nicht gesprochen haben: „zur Rechten“, sondern: „zur Linken“.
4. Der um soviel besser als die Engel geworden, je vorzüglicher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat.
Der Ausdruck „geworden“ steht hier, wie man sich etwa ausdrücken könnte, für „erklärt“;21 dann erhärtet er Das. Woher? Vom Namen. Siehst du, daß der Name Sohn die wahre Abstammung zu bezeichnen sich eignet? Und fürwahr, wenn er nicht wirklicher Sohn wäre, würde er nicht so gesprochen haben. Warum? Weil er durch nichts Anderes wirklicher Sohn ist, als weil er aus ihm sein Dasein hat. Daher nimmt er also den Beweis. Denn wäre er Sohn nur aus Gnade, so wäre er nicht nur nicht vorzüglicher, sondern noch geringer als die Engel. Wie so? Weil auch gerechte Männer „Söhne“ genannt wurden, und der Name „Sohn“, wenn er nicht wirklicher Sohn ist, keinen Vorzug zu bezeichnen vermag. Und indem er darthut, daß zwischen den Geschöpfen und dem Schöpfer ein Unterschied sei, höre, was er sagt:
**5. Denn zu welchem der Engel hat er je gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum: Ich werde ihm Vater, und er wird mir Sohn sein.
Dieß ist auch in Bezug auf seine Menschheit gesagt; denn die Worte: „Ich werde ihm Vater, und er wird mir Sohn sein,“ bezeichnen treffend die Menschwerdung; die Worte aber: „Mein Sohn bist du“ besagen nichts Anderes, als daß er aus ihm das Dasein hat. Wie aber das Wort „sein“ sehr passend von der Gegenwart gebraucht wird, so scheint mir auch der Ausdruck „heute“ in Bezug auf die Menschheit gesprochen zu sein. Denn wenn er darauf zu reden kommt, bespricht er Alles ohne Ängstlichkeit; es nimmt ja auch die Menschheit an der Erhabenheit Theil wie die Gottheit an der Niedrigkeit; denn Gott hat es nicht verschmäht, Mensch zu werden; und hat er die Sache nicht ausgeschlagen, wie sollte er denn die Worte verschmähen?
IV.
Da wir Das wissen, wollen wir in Nichts uns schämen und nicht hochmüthig sein. Denn wenn er selbst, der da Gott und Herr und Gottes Sohn ist, es nicht verschmäht hat, Knechtesgestalt anzunehmen, sollen wir um so mehr Alles gerne thun, und sei es auch noch so gering. Denn woher, sprich, o Mensch, fassest du stolze Gedanken? Aus dem irdischen? Das ist, kaum erschienen, auch schon wieder verschwunden. Oder aus deinen geistigen Vorzügen? Aber auch Das gehört zur Tüchtigkeit des Geistes, nicht hochmüthig zu sein. Oder bildest du dir Etwas ein auf deine Rechtschaffenheit? Höre, was Christus spricht: „Wenn ihr Alles gethan habt, so sprechet: Wir sind unnütze Knechte, denn wir haben nur unsere Schuldigkeit gethan.“22 Oder bläht dein Reichthum dich auf? Sage mir doch, warum? Hast du nicht gehört, daß wir nackt in dieses Leben eingegangen und auch nackt wieder aus demselben scheiden werden? Ja noch mehr. Siehst du nicht, daß Diejenigen, welche vor dir gelebt, nackt von hinnen gegangen? Wer soll nun im Besitze fremder Güter hochmüthig sein? Denn Diejenigen, welche sie nur zum eigenen Genusse verwenden wollen, verlieren sie auch wider Willen, oft noch vor ihrem Lebensende, im Tode ganz sicher. Aber solange wir leben, sagt man, gebrauchen wir sie doch nach Belieben. Schwerlich dürfte sich Jemand finden, der sie so bald nach Wunsch gebrauchen könnte, und vermöchte er auch, sie nach Belieben zu verwenden, so ist auch Das noch nichts Großes; denn kurz ist diese Zeit im Vergleiche mit der endlosen Ewigkeit. Du bist hochmüthig, o Mensch! weil du wohlhabend bist? Warum denn? Das können auch Räuber sein und Diebe und Mörder und Weichlinge und Hurer und alle schlechten Menschen. Warum bist du nun stolz? Wenn du nämlich den Reichthum pflichtmäßig verwendest, so darfst du nicht hochmüthig sein, damit du nicht das Gebot übertretest; verwendest du ihn aber auf pflichtwidrige Weise, so sollst du eben darum noch demüthiger sein, weil du ein Sklave von Geld und Gut geworden und unter deren Herrschaft schmachtest. Denn sage mir: wenn ein Fieberkranker viel Wasser hinunterstürzte, das für den Augenblick den Durst löschte, später aber die Fieberflamme vermehrt, sollte sich dieser darauf Etwas einbilden? Wie aber, wenn du dir nun gar viele thörichte Sorgen machst, sollte Das deinen Sinn aufblähen? Warum? Sprich! Weil du viele Gebieter hast? weil dich tausend Sorgen quälen? weil dir Viele schmeicheln? Das ist aber Knechtschaft. Damit du aber einsehest, daß du ein Sklave bist, so höre aufmerksam zu! Die andern Leidenschaften, die sich in uns regen, sind zuweilen nützlich, wie der Zorn nicht selten es ist, denn es heißt: „Ein ungerechter Zorn wird nicht ohne Strafe sein,“23 woraus folgt, daß es auch einen gerechten Zorn gibt. Und wiederum: „Wer seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird der Hölle schuldig sein.“24 Ferner können der Wetteifer und die Begierde gut sein; letztere nämlich, wenn sie sich die Kindererzeugung zum Ziele setzt, dieser aber, wenn er Wetteifer im Guten ist; wie auch Paulus sagt: „Der Eifer im Guten ist allzeit gut;“25 und wiederum: „Strebet an die besseren Gnadengaben!“26 Beide also sind nützlich; die Tollkühnheit aber ist nirgends ersprießlich, sondern überall unnütz und schädlich. Will aber Jemand stolz sein, so sei er stolz auf die Armuth, nicht auf den Reichthum! Warum? Weil Derjenige, welcher mit Wenigem zu leben vermag, viel größer und besser ist, als wer Das nicht kann.
V.
Denn sage mir, wenn Etliche in eine königliche Stadt gerufen würden, und die Einen weder Zugthiere noch Dienerschaft noch Zelte noch Herberge noch Schuhe noch Geräthe nöthig hatten, sondern es ihnen genügte, nur Brod zu haben und Wasser aus der Quelle zu schöpfen; die Andern aber sagten: Wenn ihr uns nicht Fahrzeuge gebt und ein weiches Lager, so können wir hier nicht wohnen, und wenn wir kein zahlreiches Gefolge haben und nicht fortwährend in behaglicher Ruhe leben können, so ist’s uns unmöglich, zu bleiben. Auch muß man uns ein Gespann zur Verfügung stellen und durch einen kleinen Theil des Tages einen Spaziergang vergönnen und noch vieles Andere: - welche möchten wir wohl bewundern? Diese oder Jene? Offenbar Diejenigen, welche keine Bedürfnisse haben. So ist es auch hier. Diese haben auf ihrem Wege durch’s Leben Vieles, Jene aber Nichts nöthig, so daß, wenn überhaupt ein Stolz stattfinden sollte, man seinen Ruhm in der Armuth suchen müßte. Aber der Arme ist verächtlich, sagt man. Nicht der Arme, sondern Diejenigen, die ihn wegwerfend behandeln. Denn wie sollte ich nicht Jene verachten, die es nicht verstehen, Achtung zu zollen, wem Achtung gebührt? Wird ja auch ein Maler die unwissenden Spötter verlachen und sich keineswegs an ihr Geschwätz kehren, sondern in seinem Selbstbewußtsein seine Zufriedenheit finden. Sollten nun wir uns von dem Urtheile des großen Haufens abhängig machen? Wie wäre Das verzeihlich? Darum verdienen wir verachtet zu werden, wenn wir Diejenigen, denen wir wegen unserer Armuth verächtlich erscheinen, nicht geringschätzen und nicht als erbärmliche Menschen ansehen wollten. Ich will es unterlassen, zu sagen, wie viele Sünden aus dem Reichthum entstehen, wie viel Gutes die Armuth erzeugt; jedoch sind weder Reichthum noch Armuth an sich etwas Gutes, es kommt nur darauf an, welchen Gebrauch man davon macht. Für den Christen ist die Armuth eine größere Quelle des Ruhmes als der Reichthum. Wie so? Wer in Armuth lebt, wird demüthiger, besonnener und gemessener, bescheidener und verständiger sein; wer aber im Reichthume sitzt, findet dagegen viele Hindernisse. Besehen wir uns einmal die Werke, welche der Reiche vollbringt oder vielmehr Derjenige, welcher vom Reichthum einen schlechten Gebrauch macht. Ein Solcher raubt, übervortheilt, übt Gewalthätigkeit. Was weiter? Wirst du nicht finden, daß die sündhaften Liebeshändel und die zügellosen Fleischesgelüste und die Zauberei und die Giftmischerei und alle anderen Schlechtigkeiten aus dem Reichthum entsprießen? Siehst du, daß es leichter ist, in der Armuth die Tugend zu üben als im Reichthum? Denn wähne ja nicht, daß die Reichen, wenn sie auch hier ungestraft bleiben, sich keiner Vergehen schuldig machen; wäre es nämlich leicht, sie (nach Gebühr) zu bestrafen, so würde man die Gefängnisse davon angefüllt finden. Aber zu den anderen Übeln gesellt sich für den Reichen auch Dieses, daß er im Besitze seiner Geldmacht seine Schlechtigkeiten ungestraft ausübt und von feinen bösen Thaten nicht absteht; daß er Wunden empfängt ohne die Heilmittel und Niemand ihm einen Zügel anlegt. Wollte sich aber Jemand bemühen, so würde er finden, daß die Armuth auch vielfache Mittel zum Vergnügen darbietet. Wie denn? Weil sie von Sorgen, von Haß, Kampf, Streitsucht, Zwist und zahllosen bösen Dingen befreit ist. Jagen wir darum dem Reichthum nicht nach und beneiden wir nicht immer Die, welche Vieles besitzen! Haben wir aber Glücksgüter, so wollen wir dieselben, wie es Pflicht ist, gebrauchen; sind sie uns aber versagt, so sollen wir uns darüber nicht grämen, sondern wir wollen in Allem Gott loben, daß er es uns möglich gemacht, bei weniger Mühe denselben Lohn wie die Reichen oder noch einen größeren, wenn wir wollen, zu gewinnen, und Geringes wird für uns die Quelle großer Vortheile sein; denn auch Derjenige, der zwei Talente gebracht, wurde gleichen Lobes und gleicher Ehre theilhaftig wie Der, welcher fünf vorgelegt hat. Warum? Weil Jener, dem zwei Talente anvertraut waren, Alles, was an ihm lag, erfüllt und das Empfangene verdoppelt zurückgebracht hat. Was beeifern wir uns denn, Vieles in Verwaltung zu bekommen, da es uns möglich ist, aus Wenigem den gleichen, ja noch größeren Nutzen zu ziehen, da die Arbeit geringer, der Lohn aber reichlicher ist? Auch wird der Arme von Dem, was er hat, leichter sich trennen als der Reiche, welcher viele und große Schätze besitzt. Oder wisset ihr nicht, daß, je mehr Reichthümer Jemand zusammengerafft, desto mehr derselben ersehnt? Damit uns also Das nicht begegne, wollen wir nicht nach Reichthum haschen, nicht verdrießlich die Armuth ertragen, nicht nach irdischen Schätzen schmachten, sondern was wir etwa besitzen, nach der Vorschrift des heiligen Paulus gebrauchen, der da spricht: „Welche haben, als hätten sie nicht, und welche diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie dieselbe nicht,“27 damit wir der verheißenen Güter theilhaftig werden durch die Liebe und Barmherzigkeit (Gottes).