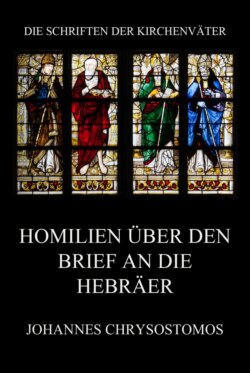Читать книгу Homilien über den Brief an die Hebräer - Johannes Chrysostomos - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erste Homilie.
ОглавлениеI.
Kap. I.
1. 2. Mannigfaltig und auf vielerlei Weise hat einst Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet, zuletzt hat er in diesen Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben des All gesetzt, durch den er auch die Welt gemacht hat.
„Wirklich, als die Sünde überschwenglich war, wurde die Gnade noch überschwenglicher.“1 Auf diese Wahrheit deutet der heilige Paulus auch hier im Eingange seines Briefes an die Hebräer hin. Denn weil diese von Mühen und Beschwerden fast aufgezehrt waren und darnach die Dinge beurtheilten, und für sie der Schluß nahe lag, daß sie selbst geringer als alle Anderen wären: so zeigt er, daß sie einer viel größern, ja überschwenglichen Gnade gewürdiget seien, und gibt gleich in den ersten Worten des Briefes dem Zuhörer eine besondere Anregung. Darum sagt er: „Mannigfaltig und auf vielerlei Weise hat einst Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet, zuletzt hat er in diesen Tagen zu uns durch den Sohn geredet.“ Warum stellt er sich selber den Propheten nicht gegenüber? War er doch weit größer als diese, da ihm Größeres anvertraut war. Das thut er aber nicht. Warum? Erstens, weil er sich selber nicht rühmen wollte; zweitens, weil die Zuhörer noch nicht die nöthige Reife besaßen; drittens, weil er sie zu heben beabsichtigte und zeigen wollte, daß sie einer großen Auszeichnung theilhaftig würden, - als wollte er sagen: Was Großes liegt darin, daß Gott zu unseren Vätern die Propheten gesandt, da er uns seinen eigenen eingebornen Sohn geschickt hat? - Recht schön beginnt er mit den Worten: „Mannigfaltig und auf vielerlei Weise;“ denn er zeigt, daß nicht einmal die Propheten Gott geschaut haben, wohl aber der Sohn ihn geschaut hat. Denn der Ausdruck: „Mannigfaltig und auf vielerlei Weise“ hat die Bedeutung: in verschiedenen Gesichten und Gleichnissen; denn er spricht: „Ich mehre die Gesichte und erscheine in Gleichnissen durch die Propheten.“2 Das ist also nicht der einige Vorzug, daß zu Jenen zwar Propheten gesandt wurden, zu uns aber der Sohn, sondern daß auch keiner der Propheten Gott geschaut hat, wohl aber der eingeborne Sohn. Das aber schreibt er nicht gleich im Anfang, sondern beweist es erst im Folgenden, wo er von der Menschheit (Christi) spricht: „Denn zu welchem der Engel sprach Gott je: Du bist mein Sohn?“ und: „Setze dich zu meiner Rechten.“3 Betrachte seine große Klugheit. Zuerst zeigt er die durch die Sendung der Propheten ihnen gewordene Auszeichnung, und nachdem er Dieß als Thatsache dargelegt hat, beweist er das Übrige, daß nämlich Gott zu Jenen durch die Propheten, zu uns aber durch seinen Eingeborenen gesprochen. Hätte er aber sogar durch Engel zu ihnen geredet (und in der That haben Engel mit ihnen verkehrt), so hätten wir auch in dieser Beziehung den Vorzug, und zwar in so weit, als zu uns der Herr, zu Jenen aber die Diener geredet; denn die Engel sind wie die Propheten nur Diener. Schön spricht er auch: „Zuletzt in diesen Tagen;“ denn auch Das richtet sie auf und tröstet sie in ihrer Betrübniß; wie er denn auch an einer anderen Stelle schreibt: „Der Herr ist nahe, seid nicht ängstlich besorgt;“4 und wieder: „Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden;“5 so auch hier. Was will nun Paulus damit sagen? Daß ein Jeder, der im Kampfe seine Kräfte erschöpft hat, sobald er das Ende des Kampfes vernimmt, ein wenig ausathmet, indem er weiß, daß nun das Ende der Mühen und der Anfang der Ruhe gekommen. - „Zuletzt hat er in diesen Tagen zu uns in dem Sohne geredet.“ Die Worte: „in dem Sohne,“ „durch den Sohn“ spricht er gegen Diejenigen aus, welche behaupten, Dieß passe auf den heiligen Geist. Siehst du, daß das „in“ dem „durch“ entspricht? Ferner haben die Ausdrücke: „einst“ und „zuletzt in diesen Tagen“ ihren besonderen Sinn. Welchen denn? Nach Verlauf einer geraumen Zeit, da wir der Strafe gewärtig waren, die Gnadengaben aufgehört hatten, es keine Aussicht auf Erlösung gab, als wir von allen Seiten Verluste befürchteten: da erlangten wir größeren Vortheil. Nun erwäge, wie klug er sich ausdrückt! Er sagt nicht: „Christus hat geredet,“ obgleich er es war, der so gesprochen, sondern da sie noch schwach waren und Das, was auf Christus Bezug hatte, nicht zu fassen (zu hören) vermochten, sagt er: „Er hat zu uns durch den Sohn geredet.“ Was sagst du? Gott hat durch den Sohn geredet? Ja. Wo ist dann der Vorzug? Denn hier hast du gezeigt, daß das neue und das alte Testament denselben Urheber haben, was doch keinen Vorzug (des neuen vor dem alten) in sich schließt. Darum läßt er eine Erörterung in den Worten folgen: „Er hat zu uns durch den Sohn geredet.“ Siehe, wie Paulus die Sache zu einer gemeinschaftlichen machte und sich seinen Schülern gleichstellt mit den Worten: „Er hat zu uns geredet.“ Hat er doch nicht zu ihm gesprochen, sondern zu den Aposteln und durch sie zur Schaar (der Gläubigen). Allein er hebt sie und zeigt, daß er auch zu ihnen geredet; gleichzeitig aber tadelt er gewisser Maßen auch die Juden; denn beinahe Alle, zu denen die Propheten gesprochen, waren schlechte und verruchte Menschen. Ohne sich hierüber weiter zu verbreiten, redet er über die von Gott gespendeten Wohlthaten. Darum fügt er auch bei: „Den er zum Erben des All gesetzt.“ Hier meint er das Fleisch (die Menschen), wie auch David im zweiten Psalm sagt: „Begehre von mir, so will ich dir geben die Heiden zu deinem Erbe!“6 Denn nicht mehr ist Jakob des Herrn Antheil noch Israel sein Erbe, sondern Alle sind es. Was besagen die Worte: „Den er zum Erben gesetzt hat“? Sie besagen: Diesen hat er zum Herrn über Alles gesetzt. Dasselbe sagt auch Petrus in der Apostelgeschichte: „Zum Herrn und zum Christus hat Gott ihn gemacht.“7 Den Ausdruck „Erbe“ hat er gebraucht, um ein Zweifaches anzuzeigen, nämlich daß er wirklicher Sohn sei, und daß ihm deßhalb die Herrschaft nicht entrissen werden könne. Erbe des All soll so viel heissen als: Erbe der ganzen Welt. Sodann führt er die Rede wieder auf das Frühere zurück: „Durch den er auch die Welt8 gemacht hat.“
II.
Wo sind Diejenigen, die da sprechen: Es war eine Zeit, wo er nicht war? Dann steigt er stufenweise höher und spricht sich weit erhabener als im Gesagten in folgenden Worten aus:
3. 4. Welcher, da er der Abglanz ferner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist, durch das Wort seiner Kraft Alles trägt und, nachdem er uns von Sünden gereiniget hat, sitzet zur Rechten der Majestät in der Höhe; der um so viel besser als die Engel geworden, je vorzüglicher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat.
Ha! welch apostolische Weisheit! Jedoch nicht so fast über die Weisheit des Paulus, als über die Gnade des heiligen Geistes müssen wir staunen; denn so sprach er nicht aus selbsteigener Erkenntniß, noch hat er eine solche Weisheit aus sich selber geschöpft. Woher hat er sie denn? Etwa vom Messer oder von den Häuten oder aus der Werkstätte? Nein! Eine solche Sprache ist göttliches Werk. Denn diese Gedanken waren nicht das Erzeugniß seines Verstandes, welcher damals so ärmlich und so gering war, daß er nicht mehr besaß als Einer aus dem gewöhnlichen Volke. Denn wie konnte Derselbe auch, der sich mit Handelsgeschäften und Häuten befaßte, einen größeren Aufschwung haben? Aber die Gnade des heiligen Geistes, welche nach freier Wahl ihre Werkzeuge wählt, zeigte ihre Kraft. Denn wie Jemand, der einen kleinen Knaben auf eine Höhe, die bis zum Himmelsscheitel hinaufreicht, bringen wollte, Dieß allmählig und in kleinen Absätzen thun und von unten ihn hinaufführen würde; dann, wenn er oben stände und den Kleinen abwärts blicken hieße und diesen dann bestürzt und ängstlich und schwindelig sähe, - ihn nehmen und auf einen niedriger liegenden Punkt hinabführen würde, auf daß er aufathmen könnte, dann den Neugekräftigten wieder bergan und wieder bergab führen würde -: so macht es auch der heilige Paulus sowohl bei den Hebräern als an allen anderen Orten, wie er es ja von seinem Meister gelernt hatte. Bald führt er feine Zuhörer hinauf in die Höhe, bald geleitet er sie wieder hinab und läßt sie nicht lange auf demselben Standpunkt verweilen. So betrachte ihn auch hier, wie er sie über viele Stufen hinaufführt und sie auf den Gipfel der Gottseligkeit stellt, dann aber, ehe sie von Verwirrung und Schwindel ergriffen werden, sie wieder tiefer hinabführt und sie aufathmen läßt, indem er spricht: „Er hat zu uns geredet durch den Sohn;“ und wieder: „Den er zum Erben des All gesetzt hat.“ Denn der Name „Sohn“ hat in soweit eine gemeinsame Bedeutung. Wird nun darunter der wirkliche Sohn (Gottes) verstanden, so ist er über Alles erhaben; wie er aber in diesem Betrachte sei, zeigt er im Folgenden, wo er darthut, daß er von oben ist. Sieh’ aber, wie er sie vorerst auf eine niedrigere Stufe hinstellt, indem er sagt: „Den er zum Erben des All gesetzt hat.“ Denn die Worte: „Zum Erben hat er gesetzt“ haben einen gewöhnlichen Sinn. In dem Zusatze: „Durch den er auch die Welt gemacht hat“ stellt er ihn auf eine höhere Stufe; dann stellt er ihn auf die höchste, über welche hinaus keine mehr ist, mit den Worten: „Welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens ist…“ Wahrhaftig, er hat ihn zum unzugänglichen Lichte, zum Abglanze selbst hingeführt. Und siehe, wie er ihn, ehe sich die Dunkelheit ausbreitet, wieder allmählig erniedrigt, indem er sagt: „Welcher durch das Wort seiner Kraft Alles trägt und, nachdem er uns von Sünden gereiniget hat, sitzet zur Rechten der Majestät in der Höhe.“ Er sagt nicht einfach: „er sitzet,“ sondern: „nachdem er uns von Sünden gereiniget hat;“ denn er übernahm die Menschwerdung, wodurch er etwas Unerhabenes ausspricht. Hierauf spricht er wiederum Hohes, indem er sagt: „zur Rechten der Majestät in der Höhe,“ und fügt alsdann nochmals die mehr niedrigen Worte hinzu: „Der um so viel besser als die Engel geworden, je vorzüglicher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat.“ Hier spricht er nämlich von seiner menschlichen Natur, da der Ausdruck: „besser geworden“ keinen Bezug hat auf seine mit dem Vater gleiche Wesenheit, - denn diese ist nicht geworden, sondern gezeugt, - sondern auf seine menschliche Natur, - diese ist geworden. Jedoch über die Wesenheit spricht er jetzt nicht, sondern wie Johannes mit den Worten: „Der nach mir kommen wird, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich,“ darthun will, daß er größerer Ehre werth und ruhmreicher sei, - so will auch hier Paulus, da er sagt: „Um so viel besser als die Engel geworden, je vorzüglicher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat,“ erklären, daß er höher stehe und gepriesener sei. Du siehst, daß hier von der Menschheit die Rede ist; denn den Namen: „Gott das Wort“ hatte er immer und nicht etwa später ererbt; auch wurde er nicht erst damals besser als die Engel, nachdem er uns von Sünden gereiniget hatte, sondern er war immer besser und zwar unvergleichbar besser. Paulus spricht demnach über seine menschliche Natur, sowie auch wir, wenn wir von einem Menschen sprechen, über ihn Hohes und Niedriges auszusagen gewöhnt sind. Denn wir sagen: Nichts ist der Mensch, Erde ist der Mensch, Staub ist der Mensch, so benennen wir das Ganze nach seinem geringeren Bestandtheile. Wenn wir aber sagen: Ein unsterbliches Wesen ist der Mensch, der Mensch hat Vernunft und Verwandtschaft mit den himmlischen Wesen, so bezeichnen wir hinwieder das Ganze nach seinem edleren Bestandtheile. So redet auch Paulus bald von seiner geringeren, bald von seiner höheren Wesenheit, je nachdem er über die Menschwerdung handeln oder über dessen pure Natur belehren will.
III.
Nachdem er uns also von unseren Sünden gereiniget hat, wollen wir auch rein bleiben und keine Makel mehr annehmen, sondern die uns verliehene Schönheit und Würde so unbefleckt und makellos zu bewahren bestrebt sein, daß sich kein Flecken, keine Runzel oder sonst Etwas der Art vorfinde. Denn Flecken, und Runzeln sind die kleinen Sünden, z. B. Schelten, Übermuth, Lüge, - doch auch diese sind keine kleinen Sünden, sondern sehr große, so große, daß sie uns sogar des Himmelreiches berauben. Wie und auf welche Weise? „Wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr! wird des höllischen Feuers schuldig sein,“ heißt es.9 Wenn aber schon Derjenige, welcher „du Narr!“ sagt, was doch die allergeringfügigste Schimpfrede und eine Knabenneckerei zu sein scheint, diese Strafdrohung hört, welche Strafe wird dann Der auf sich laden, welcher seinen Bruder einen Bösewicht, einen Schurken, einen Verläumder schilt und mit zahllosen andern Schmähungen überhäuft? Was ist furchtbarer als Das? Jedoch ertraget meine Worte, ich bitte darum. Wenn nämlich Derjenige, der Einem der Geringsten Etwas thut, es ihm (Christo) selber thut, wenn er es aber Einem der Geringsten nicht thut, es gegen ihn selber unterläßt,10 wie sollte das nicht auch der Fall sein in Bezug auf Lob und Tadel? Wer seinen Bruder mit Übermuth behandelt, der übt gegen Gott selber Übermuth; und wer seinen Bruder ehrt, der ehret Gott. Lernen wir also die Zunge bezähmen, auf daß sie wohlrede; denn der Psalmist sagt: „Bewahre deine Zunge vom Bösen!“11 Denn Gott hat uns dieselbe nicht darum gegeben, daß wir der Tadelsucht und dem Übermuth dienen und einander verleumden, sondern auf daß wir Gott loben, daß wir Solches reden, was den Zuhörern Segen bringt, was Erbauung und Nutzen schafft. Redest du irgend Jemandem Böses nach? Welchen Gewinn hast du davon, da du dich mit Jenem in Schaden verwickelst? Du gewinnst den Ruf eines schmähsüchtigen Menschen; denn es gibt gar kein Übel, das nur bis zu Dem dringt, der es erduldet, und nicht zugleich Den ergreift, der es verursacht; so stellt der Neidische scheinbar einem Andern nach, ärntet aber selbst zuerst die Frucht seiner Ungerechtigkeit, denn er zehrt dabei selber ab und geht, von Allen verabscheut, zu Grunde. Der Habsüchtige vergreift sich am Eigenthume des Nächsten, beraubt sich aber selber der Liebe (Anderer), und was noch mehr ist, er bringt sich bei Allen in schlechten Ruf. Ein guter Name steht nämlich weit höher als Reichthum; denn einen schlechten Ruf kann man nicht leicht abwaschen, Güter aber leichter erwerben. Noch mehr: der Mangel an Glücksgütern schadet Demjenigen, welchem sie fehlen, Nichts; wem aber der ehrliche Name verloren gegangen, der wird beschimpft und verspottet und ist Allen verhaßt und zuwider. So wird auch der Zornige zuerst für sich selbst eine Zuchtruthe, dann für Den, welchem er zürnt. Ebenso schändet der Verläumder zuerst sich selber und darnach erst Denjenigen, den er verläumdet; oder auch Das hat er nicht einmal vermocht, sondern er selbst trägt den Ruf eines verruchten und verächtlichen Menschen davon, während er Jenem zu einer um so größeren Liebe verhilft. Denn sobald Dieser von der üblen Nachrede Kunde erhält, und anstatt sich an dem Ehrenräuber mit Gleichem zu rächen, vielmehr mit Lob und Achtung über ihn redet, fällt das Lob nicht Diesem zu, sondern auf ihn selber zurück. Denn wie oben bemerkt worden, rächen sich die Verläumdungen gegen den Nächsten an den Ehrenräubern zuerst, - gerade so schafft auch das dem Nebenmenschen erwiesene Gute seinen Urhebern das erste Wonnegefühl; denn der Urheber sowohl des Guten wie des Bösen hat davon natürlich den ersten Genuß; und wie das Wasser der Quelle, mag dasselbe bitter oder süß sein, die Gefäße der Schöpfenden füllt, ohne daß die Fülle der Wasser sprudelnden Quelle sich mindert: so bereitet die Tugend ihrem Urheber Wonne, das Laster aber richtet Den, der es verübt, zu Grunde. So verhält es sich im Diesseits; welche Worte aber sind wohl im Stande, das Jenseits in seinen Belohnungen und Strafen zu schildern? Gar keine. Denn die Güter der Ewigkeit sind nicht nur unaussprechlich, sondern sie übersteigen sogar allen Verstand; das Gegentheil aber von ihnen wird uns mit Ausdrücken bezeichnet, an die wir gewöhnt sind; denn Feuer, heißt es, ist dort und Finsterniß, Bande sind dort und ein Wurm, der nie stirbt. Allein nicht nur Dieses, was da aufgezählt wird, stellt sich unserem Geiste dar, sondern noch viel Schwereres. Damit du Das einsehest, erwäge vorerst Dieses schnell! Wenn dort Feuer ist, wie ist da Finsterniß möglich? Siehst du, daß jenes Feuer unerträglicher ist als das gewöhnliche? Denn es hat ja kein Licht. Wenn dort Feuer ist, wie brennt es denn immer? Siehst du, daß es schwerer zu ertragen ist als das gewöhnliche? Denn es erlischt nicht; darum nennt man es auch ein unauslöschliches Feuer. Bedenken wir also, welch ein großes Unglück es ist, ewig zu brennen und in der Finsterniß zu sein und unendliches Jammergeschrei unter Zähneknirschen auszustoßen und - nimmer Erhörung zu finden. Denn wenn schon hier Jemand von edler Erziehung in ein Gefängniß geworfen würde und den Gestank daselbst und die öde Finsterniß und die mit Mördern gemeinsame Fesselung für schwerer halten würde als jedweden Tod, so bedenke, was Das ist: mit den Mördern des ganzen Erdkreises zu brennen, ohne zu sehen und gesehen zu werden, vereinsammt unter einer so gewaltigen Menge! Denn die undurchdringliche Finsterniß laßt uns auch Jene nicht einmal erkennen, welche uns die Nächsten sind, sondern ein Jeder wird sich in einer Lage befinden, als hätte er alle diese Leiden allein zu ertragen. Wenn aber die Finsterniß schon für sich allein unsere Seelen drücket und ängstigt, was wird erst sein, wenn sich zur Finsterniß auch noch viele andere Qualen und Feuerschmerzen gesellen? Deßhalb bitte ich, Das unaufhörlich in Erwägung zu ziehen und die Trauer, die uns aus dem Gesagtem erwächst, zu ertragen, damit wir nicht durch unsere Werke den Qualen verfallen. Denn Dieß alles wird unfehlbar stattfinden, und Diejenigen, welche Böses gethan, wird jenem Orte der Peinen Niemand entreissen, weder Vater noch Mutter noch Bruder, selbst wenn er viel Zuversicht hätte und bei Gott Großes vermöchte. „Ein Bruder erlöset ja nicht,“ heißt es, „wird denn ein Mensch erlösen?“12 Gott selbst ist es, der einem Jeden nach seinen Werken vergilt, und diese bringen Rettung oder Verwerfung. „Machet euch Freunde mittelst des ungerechten Reichthums!“13 Gehorchen wir also, denn es ist ein Gebot des Herrn; vertheilen wir den Überfluß des Reichthums unter die Armen; geben wir Almosen, solange wir können; denn das heißt sich Freunde machen vermittelst des Reichthums! Legen wir diese Güter in die Hände der Armen, damit wir befreit bleiben von jenem Feuer, damit wir es auslöschen, damit wir jenseits Zuversicht haben; denn dort sind es nicht diese, die uns aufnehmen, sondern unsere Werke. Daß wir aber nicht ohne Weiteres schon darum das Heil finden können, weil diese unsere Freunde sind, ist aus dem Beisatz ersichtlich. Denn warum sagt er nicht: Machet euch Freunde, damit sie euch in die himmlischen Wohnungen aufnehmen, sondern fügt auch noch die Art und Weise hinzu? Denn durch die Worte: „vermittelst des ungerechten Reichthums“ zeigt er, daß man sich durch zeitliche Güter diese Freunde verschaffen solle, daß aber die Freundschaft an und für sich offenbar uns nicht zu schirmen vermöge, wenn wir nicht gute Werke haben, wenn wir nicht den ungerecht erworbenen Reichthum auf gerechte Weise vertheilen. Was ich da über das Almosen sage, paßt nicht allein für die Reichen, sondern auch für die Armen; ja, diese Worte gelten sogar für Diejenigen, die sich vom Bettel ernähren; denn es ist Niemand so arm, und müßte er noch so sehr darben, daß er nicht etwas Weniges hätte. Nun ist es möglich, daß Jemand, der von seinem kleinen Besitze auch nur Weniges mittheilt, die Wohlhabenden übertreffe, wenn diese auch mehr geben, sowie es bei jener Wittwe der Fall war. Denn nicht nach der Größe der Gabe, sondern nach dem Können und dem guten Willen des Gebers wird der Werth des Almosens bemessen. Überall müssen wir also guten Willen, überall Liebe zu Gott haben. Wenn wir mit dieser Alles thun, und wenn wir dann auch nur Weniges geben, weil wir nur Weniges haben, so wird Gott von uns sein Antlitz nicht abwenden, sondern unsere Gabe so aufnehmen, als hätten wir Großes und Erstaunliches geleistet; denn er sieht nicht auf die Gaben, sondern auf den guten Willen, und wenn er sieht, daß dieser stark ist, so wird er darnach richten und entscheiden und uns der ewigen Güter theilhaftig machen, in deren Besitz wir alle durch seine Menschenfreundlichkeit und Gnade gelangen mögen.