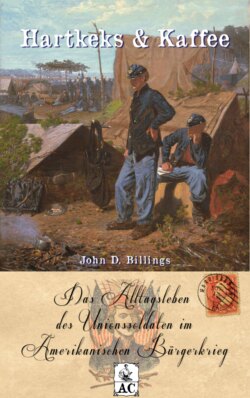Читать книгу Hartkeks & Kaffee - John Davis Billings - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 05: Das Leben in Holzhütten
Оглавление"Er erbaute die Hütte,
Legte in deren Mitte
Die Gebeine des Robinson Crusoe."
– Samuel Foote, 'Der Schultheiß von Garratt'
Für den Aufbau des Lagers eines Regiments oder einer Geschützbatterie fanden sich exakte Vorschriften in den Heeresregularien. Diese sahen (in etwas vereinfachter Form) vor, dass jede Kompanie eines Regiments ihre Zelte in zwei Reihen aufschlagen sollte und dass ihre Eingänge an eine Lagerstraße grenzen sollten. Diese Straße verlief rechtwinkelig zur Fahnenreihe, welche die Linie markierte, an der das Regiment sich im Bedarfsfalle formierte. Ohne allzu sehr in die Details zu gehen, möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, dass die Zelte der Kompanieoffiziere hinter ihren jeweiligen Kompanien aufgeschlagen wurden und die Zelte der Stabsoffiziere wiederum hinter diesen. Die Lagerpläne der Kavallerie waren vergleichbar, sahen jedoch lediglich eine Zeltreihe pro Kompanie vor. Die Artillerie errichtete drei Zeltreihen, je eine pro Geschützsektion.
Nach diesen Ausführungen muss ich gestehen, dass all diese Vorschriften für die Organisation eines Lagers zwar existierten, von den Soldaten jedoch weitaus häufiger (und enthusiastischer) missachtet als befolgt wurden. Die Heeresregularien galten strenggenommen als Leitfaden für die regulären Streitkräfte, doch diese regulären Einheiten stellten nun nur noch einen sehr geringen Teil des gesamten Unionsheeres dar. Der Großteil oder, um eine Redewendung der Iren zu verwenden, "die größere Hälfte" des Heeres bestand aus Freiwilligen, welche sich nicht bedingungslos den Heeresregularien unterwerfen wollten. Folglich wurde bei der Raumplanung eines neuen Lagers häufig die "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"-Methode angewandt. Es ist jedoch wahr, dass Regimenter, welche von strikten Offizieren geführt wurden, mit großer Wahrscheinlichkeit die meisten der offiziellen Vorschriften befolgten. Viele der anderen hielten sich an jene Anordnungen, die sie für sinnvoll erachteten und der nicht unerhebliche Rest verfuhr nach Belieben, sofern er nicht von einer anerkannten Autorität zur Ordnung gezwungen wurde. Beim Betreten mancher Lager war der Einfluss einer strikten, führenden Hand nicht zu übersehen, während andernorts ein dermaßen wüstes Wirrwarr herrschte, dass man zu der Überzeugung gelangen konnte, der Lagerplan sei vom erstbesten, dahergelaufenen Landei zusammenimprovisiert worden (was im Einzelfall durchaus zutreffen mochte). Wenn die Truppen ihr Lager in einem Wald aufschlugen, wie es bei Winterlagern üblich war, war eine unsystematische Lagerplanung meist den dichten Bäumen geschuldet.
Doch nun zum angekündigten Thema dieses Kapitels! Lieber Leser, folge mir in eine der Holzhütten. Von ihren Wänden, ihrem Dach, ihrem Schornstein und ihrer Feuerstelle habe ich bereits berichtet. Der Eingang, durch welchen wir die Hütte betreten, mag an derselben Seite wie die Feuerstelle sein. Dies war häufig der Fall, da sich neben der Türe gerade genug ungenutzter Platz für diesen Zweck befand. Wurde eine Hütte jedoch von vier oder mehr Soldaten bewohnt, so wurde die Feuerstelle bevorzugt in der Mitte einer Seite eingerichtet, zumeist gegenüber der Türe. Trat man durch den Eingang, so sah man in der Regel zwei Betten entlang der gegenüberliegenden Wand, eines in Nähe des Bodens (der in den seltenen Fällen, in denen auf derlei Luxus Wert gelegt wurde, ein richtiger Holzfußboden sein mochte) und eines darüber, knapp unter dem Dach. Ich sage "in der Regel", weil die genaue Einrichtung stets von den jeweiligen Umständen abhing. Wenn eine Hütte lediglich von zwei Männern belegt war, stand ein Feldbett darin. Bei vier Bewohnern musste manchmal ebenfalls ein Bett ausreichen, das dann an einer der längeren Wände stand. Auch wenn es noch weitere Ausnahmen gab, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen muss, lässt sich sagen, dass in der durchschnittlichen Hütte zwei Betten standen.
Innenansicht einer Holzhütte
Die Bauweise der Betten war sehr variantenreich. Manche waren aus den Brettern von Hartkekskisten gezimmert, andere aus quer über zwei Stangen gelegten Fassdauben. Einige Soldaten ersannen gefederte Betten aus biegsamen, jungen Bäumchen und polsterten sie mit Heu und Eichen- oder Kiefernlaub. Wieder andere besorgten sich bei der Artillerie, der Kavallerie oder dem Wagentross grobe Getreidesäcke und fertigten aus diesen behelfsmäßige Hängematten, in denen es sich erholsam schlafen ließ. Am Kopfe jedes Bettes wurden die Tornister und Bündel verstaut, in denen sich die persönlichen Habseligkeiten der Soldaten befanden. Es waren dies zumeist Unterwäsche, Socken, Nähgarn, Nadeln, Knöpfe, Briefe, Briefpapier, Fotographien und dergleichen mehr. Die Infanteristen verfügten über weniger Besitztümer als die Artilleristen, da deren Gepäck auf dem Marsche auf den Protzen verstaut wurde. In den Winterlagern sammelten jedoch die Soldaten aller Waffengattungen eine Unmenge von Annehmlichkeiten an, welche ihnen in den heißbegehrten Versorgungskisten aus der Heimat geschickt wurden.
Die Brotbeutel und Feldflaschen sowie das Lederzeug wurden für gewöhnlich an in die Wände gesteckten Holzzapfen aufgehängt. Es existierten keine gesonderten Stellplätze für die Musketen. Manch einer lehnte die seine in eine Ecke, während andere sie mit dem Trageriemen an einen der Zapfen hängten.
Die besten dieser grobschlächtigen Behausungen entbehrten nicht einer gewissen Wohnlichkeit. Eine Hartkekskiste, die mit dem Deckel an die Wand genagelt und mit ledernen Scharnieren versehen war, diente als Türe und wenn man einige Regalböden in ihre Innenseite einsetzte, gab sie zugleich einen brauchbaren Geschirrschrank ab. Eine weitere Kiste, umgedreht und auf vier kurze Beine gestellt, fungierte als Tisch, klein aber gerade groß genug für die "Familie" und ausgesprochen nützlich. Manchmal wurden über der Feuerstelle ein oder mehrere Regalböden befestigt, auf denen all der kleine Schnickschnack der Bewohner seinen Platz fand. Irgendjemand zimmerte genügend drei- oder vierbeinige Schemel für die Wohngemeinschaft zusammen. Eine Hütte, die sämtliche oben genannten Annehmlichkeiten in sich vereinte, konnte als Fürstenresidenz unter den Lagerbehausungen gelten. Etliche Hütten mussten gänzlich ohne solchen Luxus auskommen.
Das Essgeschirr eines Soldaten bestand aus einer Blechtasse, einem Blechteller, einem Messer, einer Gabel und einem Löffel. Wenn er sein Mahl beendet hatte, scherte er sich in der Regel nicht um die Küchenetikette des Zivillebens und warf sein Geschirr unter sein Bett, wo es bis zur nächsten Mahlzeit verblieb. Wenn der Soldat sich doch zum absoluten Minimum an Geschirrreinigung herabließ, so war dies kein sonderlich appetitlicher Anblick. Manchmal kratzte er einfach mit seinem Messer einige Male über den Teller und ließ es dabei bewenden. Gelegentlich mochte er eine Handvoll Stroh oder Laub aus seinem Bett fischen und damit den Teller auswischen. Stand reichlich frisches Brot zur Verfügung, so gab eine Scheibe hiervon ein brauchbares Spültuch ab und zudem konnte man ein wenig heißen Kaffee auf den Teller gießen, um bei der Reinigung zu helfen. Manch einer kramte zur Essenszeit ohne jegliches Anzeichen von Scham oder Ekel seinen Teller, der noch Spuren der letzten Mahlzeit aufwies, hervor und entgegnete auf die Bemerkung des Koches nichts weiter, als dass der Zustand des Tellers durchaus der Qualität des Essens entspräche. Waren Messer und Gabel zu schwarz, um ihre bedenkliche Färbung weiterhin ignorieren zu können (und es musste dies schon ein ausgesprochen finsterer Schwarzton sein), so bestand der einfachste und bequemste Reinigungsprozess darin, sie mehrere Male vehement in die Erde zu stechen.
Zur Beleuchtung der Hütten wurden von der Regierung sehr knapp bemessene Mengen an Kerzen ausgegeben. Zuerst waren dies lange Stangen, die vor der Verteilung an die Männer zurechtgeschnitten wurden, später waren es kurze Kerzen. Ich habe oben behauptet, sie seien in knapp bemessenen Mengen verfügbar gewesen; diese Aussage muss ich relativieren. Manchmal konnte man sie in beliebiger Anzahl bekommen und manchmal war beim besten Willen keine einzige von ihnen aufzutreiben. Das Problem war, dass sich diese Zeiträume der Knappheit unmöglich vorhersagen ließen. Es war dann üblich, die Quartiermeister der Veruntreuung zu bezichtigen und es ist auch wahr, dass etliche von ihnen Schurken waren, aber ich glaube, dass sie trotzdem viele der gegen sie vorgebrachten Anfeindungen nicht verdient hatten. Einige Männer verbrauchten weitaus mehr Kerzen als andere. Tatsächlich waren manche Burschen vollkommen unfähig, sich von jedem beliebigen Bedarfsgut einen Vorrat anzusparen. Das Prinzip, ein Verbrauchsgut über einen Zeitraum bis zum Zeitpunkt seiner nächsten Ausgabe hin zu rationieren, schien ihnen völlig unbegreiflich zu sein.
Improvisierte Kerzenhalter
Was die Kerzenhalter betrifft, so wurden diese von der Regierung zu tausenden an die Truppen ausgegeben. Sie waren aus Stahl gefertigt und ausgesprochen belastbar, allerdings gelangte nur die Infanterie in ihren Genuss, denn es handelte sich dabei um ihre Bajonette. Diese musste man lediglich mit der Spitze in den Boden rammen und fertig war der Kerzenhalter. Tatsächlich war die Bajonetttülle der mit Abstand am weitesten verbreitete Kerzenhalter des einfachen Soldaten (sofern er ein Bajonett besaß). Es war immer verfügbar und eignete sich durch seine Beschaffenheit sehr gut zu diesem Zwecke. Selten wurden auch Kartoffeln benutzt, aber sie waren zu kostbar, um verbreitete Anwendung zu finden. Eine weitere übliche Methode bestand darin, die Kerze mit ihrem eigenen geschmolzenen Wachs auf einer Kiste zu befestigen.
Sooft Kerzen nicht ausreichten, wurden sogenannte "Schmalzlampen" angefertigt. Ich habe Exemplare gesehen, die aus einer mit Bratfett gefüllten Sardinendose bestanden, in der ein Stofffetzen als Docht hing. Diese Konstruktion wurde dann an einem Draht an den Firstbalken gehängt. Hierfür waren die Drähte begehrt, welche die Heuballen für die Pferde und Maultiere zusammenhielten.
Von allen Einrichtungsgegenständen einer Hütte wurden die Betten am meisten wertgeschätzt. Das Soldatenleben ist von langen Phasen der Untätigkeit geprägt und in diesen verbrachten die Männer viel Zeit in ihren Feldbetten, da ihnen Ottomanen, Chaiselongues und Polstersessel natürlich verwehrt waren. Die Betten mussten also als Ersatz für sämtliche Ruhemöbel dienen.
Die Gewohnheiten bei der Bettennutzung möchte ich an dieser Stelle näher erläutern. Jeder Soldat erhielt eine wollene Decke und eine gummierte Decke. Wenn die Männer sich nach dem Anwesenheitsappell und Zapfenstreich in ihre Behausungen zurückzogen, entkleideten sie sich nicht, um in ihr Nachthemd zu schlüpfen, wie sie es zuhause getan hätten. Für gewöhnlich gaben sie sich damit zufrieden, sich ihres Mantels, ihrer Stiefel und vielleicht noch ihrer Weste zu entledigen. Manche zogen sich bis auf ihre wollene Unterwäsche aus, streiften eine Schlafmütze über und schliefen auf diese Weise ein wenig bequemer. In jedem Regiment gab es auch den einen oder anderen, der tags wie nachts all seine Kleidung anbehielt und ein Kleidungsstück nur dann ablegte, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Diese Burschen legten sich in voller Uniform in ihr Bett und begruben sich unter sämtlichen Decken, derer sie habhaft werden konnten. Von diesen Charakteren wird noch in anderer Hinsicht die Rede sein.
Wenn zwei Männer sich im Winterlager einen Schlafplatz teilten, so hatte dies den Vorteil, dass jeder von den Decken des anderen profitierte und je nach Wetter konnte dieser Vorteil beträchtlich sein. Die gummierte Decke wurde zumeist mit der gefütterten Seite zuoberst als Unterlage benutzt, ganz so als lägen sie auf der bloßen Erde, da hierdurch sowohl kalte Luft als auch Feuchtigkeit von unten abgehalten wurden. Zudem minderte die Decke auf diese Weise den Verlust an Körperwärme.
Ich glaube, bereits angedeutet zu haben, dass die Schutzzelte einem schweren Regen nicht viel entgegenzusetzen hatten. Sobald also ein Gewitter aufzog, sahen sich die Schläfer in den oberen Stockbetten häufig genötigt, ihre gummierten Decken oder Ponchos über dem Zeltdach auszubreiten oder, falls sie das Zelt nicht verlassen wollten, von innen unter dem Dach zu befestigen. War ihnen selbst dies noch zu viel Arbeit, so begnügten sie sich damit, sich unter ihrer gummierten Decke zu verkriechen und das eindringende Regenwasser auf den Fußboden abfließen zu lassen.
In gewissen Abständen, deren Länge zu einem gewissen Maße von den Bewegungen der Armee diktiert wurde, tauchte ein Inspekteur des Regierungseigentums bei den Truppen auf, um den Zustand von Onkel Sams militärischen Besitztümern zu überprüfen. Befand der Inspekteur einen Gegenstand für nicht mehr diensttauglich, so markierte er ihn mit dem Kürzel "I C" für "Inspected Condemned", also "Geprüft und für schlecht befunden". Die Soldaten nahmen dieses Kürzel bald in ihr Vokabular auf und suchten unermüdlich nach Möglichkeiten zu seiner humoristischen Anwendung.
Am Tage lagen die Männer in ihren Betten und schliefen, wenn sie nicht lasen oder auf ihren Betten saßen und Briefe schrieben. Besucher dachten sich zumeist nichts dabei, sich direkt neben den derart Beschäftigten niederzulassen, sofern es ihnen nicht ausdrücklich untersagt wurde. Nun bestanden jedoch zwischen den einzelnen Soldaten dermaßen unterschiedliche Hygienestandards, dass manche Männer sich zu der Maßnahme berechtigt sahen, außer sich selbst niemanden auf ihrem Bette sitzen zu lassen. Wenn also die dreibeinigen Schemel und die herumstehenden Kisten nicht für die Hüttenbewohner und ihre Gäste ausreichten, stellte der Gastgeber seine Sitzgelegenheit zur Verfügung und zog sich mit einer Eilfertigkeit auf sein Bett zurück, welche ein tiefergehendes Interesse als bloße Gastfreundschaft verriet. Diese Beobachtung führt mich unweigerlich zu einem anderen Thema: dem zahlreichen Ungeziefer, das sich anscheinend gemeinsam mit den Soldaten "für drei Jahre oder die Dauer des Krieges" verpflichtet hatte. Die kleinen Tierchen erhielten im Lager jede Menge Aufmerksamkeit, weitaus mehr als auf dem Marsche. Ich beziehe mich hierbei speziell auf Pediculus Vestimenti, wie sie die Wissenschaftler nennen. Fertigt man ein Bild von ihr an und vergrößert es ausreichend, so zeigt es jene wohlbekannte Form:
Pediculus Vestimenti
Altgediente Soldaten werden diesen Blutsauger sogleich erkennen, selbst wenn ihnen der Name nicht geläufig sein mag. Dies ist der berühmte "Graurücken", der die Soldaten der Union und der Konföderation so unermüdlich begleitete. Genau wie der Tod behandelte auch er alle Menschen gleich. Er plagte die Gerechten wie die Sünder gleichermaßen. Er bohrte seinen Rüssel mit der gleichen Gier in den Major-General und den einfachen Soldaten. Einmal hörte ich die Ordonnanz eines Kompanieführers sagen, er habe in einer einzigen Sitzung 52 Graurücken aus dem Hemd seines Vorgesetzten herausgepickt. Fürst oder Bettler, der Laus war es egal. Jedem Soldaten war es vorbestimmt, enge Bekanntschaft mit den Tierchen zu schließen. In diesem Falle war ewige Wachsamkeit nicht der Preis der Freiheit. Selbst der umsichtigste Soldat konnte während eines Feldzuges nicht die nötige Zeit und Sorgfalt hierfür erübrigen. Es ist wahr, dass die reinlichsten Männer am längsten verschont blieben, aber früher oder später waren auch sie an der Reihe, sich wiederholt verstohlen mit mindestens einer Hand zu kratzen.
Die Geheimniskrämerei, die ein zum ersten Male befallener Mann plötzlich an den Tag legte, war für die Außenstehenden ausgesprochen unterhaltsam. Er versuchte die Anzeichen für die Gegenwart seiner kleinen Bewohner mit einer Umsicht zu verschleiern, wie es ein alter 49er mit dem Lageplatz seiner frischentdeckten Goldader getan haben mochte. Manchmal fand er zunächst nur eine einzige Laus an seinem Körper; diese meuchelte er in aller Stille an einem unbeobachteten Ort und verschwieg das Ereignis seinen Kameraden, alles in der Hoffnung, es könnte sich um den Robinson Crusoe der Läusewelt, einen einsamen, ohne jegliche Begleiter in fremden Gefilden Gestrandeten, gehandelt haben. Doch wie trügerisch war diese Selbsttäuschung! In 99 von 100 Fällen erwies sich die einsame Laus als Stammvater künftiger Generationen, dem es vor seiner Vernichtung noch gelungen war, unbemerkt seine Saat auszubringen. Nach nur allzu kurzer Zeit sah der Soldat sich dann gezwungen, ein Ein-Mann-Untersuchungskomitee hinter geschlossenen Türen zu bilden und zog sich zu einer angemessen abgeschiedenen Örtlichkeit zurück. Dort setzte er sich nieder, legte seine Kleidungsstücke über seine Knie und konzentrierte sich auf seine "Erntearbeit", wobei er jede Faser so sorgfältig prüfte, als sei er ein Tuchhändler.
Eine lausige Arbeit
Das Gefühl angewiderten Ekels, das man beim ersten Kontakt mit den kleinen Kriechern empfand, wich schon bald einer routinierten Gleichgültigkeit, wenn man sich bewusst wurde, dass es völlig unmöglich war, sich die Läuse gänzlich vom Halse zu halten. Die Geheimhaltung, mit welcher ein Soldat sein erstes "Gefecht ausgefochten" hatte (wie die Läusejagd häufig genannt wurde), wurde aufgegeben und fürderhin wurde der Kampf unter den Augen seiner Kameraden fortgesetzt. Tatsächlich galt es bald als ein Anzeichen für die Reinlichkeit eines Soldaten, wenn man ihn häufig seine Kleidung lausen sah und da es ohnehin jeder tun musste, ergab es keinen Sinn, sich dabei zu verstecken. Bei kaltem Wetter wurden die Gefechte in den Behausungen ausgefochten, aber wenn es draußen warm war, verließen die Männer zu diesem Zwecke gerne das Lager. Man fand sie dann für gewöhnlich in einem nahegelegenen Wald, wo sie alleine oder in kleinen Grüppchen herumsaßen und ihre Opfer zu tausenden vernichteten. Hin und wieder sah man einen Mann, der das Zelt des Quartiermeisters mit einer nagelneuen Uniform über dem Arm verließ, um einen läusefreien Neuanfang zu wagen. Er hängte die frische Uniform über einen Busch, streifte seine alten Kleidungsstücke ab, verbrannte sie und schlüpfte in seinen neuen unionsblauen Rock. So weit, so gut, doch der Soldat konnte sich glücklich schätzen, wenn er nicht binnen einer Woche bereits wieder mit den kleinen Blutsaugern zu kämpfen hatte.
Auf der Suche
Die Läusejagd verschaffte zugegebenermaßen nur geringfügige Erleichterung von den Graurücken und nahm zudem viel Zeit in Anspruch. Heißes Wasser war das Mittel der Wahl, denn es durchdrang jeden Stoff und kochte die noch ungeborenen Millionen, die selbst der gründlichste Soldat nicht alle zwischen seinen Fingern hätte zerquetschen können. So zählebig waren die Tierchen, dass einige Veteranen noch heute beschwören, sie hätten einige von ihnen auf Kleidungsstücken herumkrabbeln gesehen, welche gerade erst aus kochendem Wasser geholt worden waren. Angeblich konnte man sich der völligen Vernichtung der Pediculi nur sicher sein, wenn man das kochende Wasser noch kräftig salzte.
Ich bin überzeugt, dass alle Soldaten hinsichtlich der Graurücken dieselbe Meinung vertraten, nämlich, dass das Angebot die Nachfrage in einem derart unerhörten Maße überstieg, dass das Wohlergehen der Nation daran Schaden nahm. Was der Kartoffelkäfer für die Kartoffel ist, das waren die Kleiderläuse für die Soldaten beider Seiten. Ich wünsche jenem Manne Ruhm und Reichtum, der vor Ausbruch des nächsten großen Krieges ein Mittel erfindet, welches mit der Laus dasselbe tut, was das sogenannte "Pariser Grün" mit dem Kartoffelkäfer tut. [Anm. d. Übers.: Pariser Grün, ursprünglich ein Pigment für Malerfarbe, fand aufgrund seiner hohen Giftigkeit ab der der Mitte des 19. Jahrhunderts weitverbreitete Anwendung als Insektizid.] In Anbetracht dieser Tatsachen ist es wohl verständlich, dass kein guter Soldat sein Bett als Gemeinschaftseigentum behandelt sehen wollte.
Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass kein anderer Vertreter des Insektenreiches dem Soldaten ernstzunehmende Probleme bereitete. Gelegentlich bohrte eine Zecke unbemerkt ihren Kopf in irgendeinen Teil der menschlichen Anatomie, aber diese Tierchen waren weder zahlreich noch richteten sie Schaden an.
Eine Zecke
Ich habe bereits einiges über die Freizeitbeschäftigungen der Soldaten berichtet. Dem bereits Gesagten möchte ich noch zwei weitere Bereiche der häuslichen Tätigkeit hinzufügen, welche bei einigen Männern mehr und bei anderen weniger, ja sehr viel weniger, Zeit in Anspruch nahmen: das Waschen und das Nähen. Einige Soldaten legten im Felde ebenso großen Wert darauf, ihre Unterwäsche mindestens einmal pro Woche zu wechseln, wie sie es im Zivilleben getan hatten. Andere hingegen waren nur unter dem immensen Druck verzweifelter Umstände dazu zu bewegen. Selbst nach all den Jahren ist es noch ekelerregend, daran zurückzudenken, mit welcher Gleichgültigkeit hunderte von Soldaten ihrer Körperhygiene begegneten. Eine Anekdote, die wohl jeder alte Soldat kennt, handelt von einem Manne, der sich nach langer Zeit schließlich genötigt sah, doch einmal ein Bad zu nehmen und beim Entkleiden mehrere Hemden und Socken an sich entdeckte, die er schon lange verloren gewähnt hatte. Diese populäre Geschichte rührte von der Tatsache her, dass sich in jeder Einheit einige Individuen befanden, welche die einfachsten Grundsätze der Reinlichkeit nicht befolgten und welchen man ein derartiges Erlebnis beinahe zutrauen konnte.
Kochwäsche
Wie wurde das Wäschewaschen bewerkstelligt? Wenn die Truppen unweit eines Baches lagerten, erleichterte dies die Angelegenheit durchaus, doch selbst dann noch musste die Wäsche gekocht werden und hierzu gab es nur ein geeignetes Behältnis: den Kessel der Messe. Über Daniel Webster existiert eine wohlbekannte Anekdote: Während seiner Zeit als Außenminister fragte ihn der französische Botschafter in Washington, ob die Vereinigten Staaten wohl die neue Regierung Frankreichs anerkennen würden (es handelte sich hierbei, so glaube ich zumindest, um Louis Napoleons Regierung). Hierauf entgegnete Webster: "Warum nicht? Die Vereinigten Staaten haben die Bourbonen anerkannt, die französische Republik, das Direktorium, den Rat der Fünfhundert, den Ersten Konsul, den Kaiser, Louis XVIII., Charles X., Louis Philippe, den ..." Der Botschafter, von der Stichhaltigkeit der genannten Präzedenzfälle überzeugt, rief schließlich aus: "Genug! Genug!" Hinsichtlich der Verwendung des Kochkessels zur Kleiderwäsche lässt sich ebenso fragen: "Warum nicht?" Wurde er nicht benutzt, um unser Fleisch, unsere Kartoffeln, unsere Bohnen-, Erbsen- und Fleischsuppen, unseren Tee und Kaffee sowie unser Apfel- und Pfirsichkompott zu kochen? Warum also nicht auch unsere Wäsche? Ich möchte dir etwas sagen, lieber Leser: Es mag dir der Gedanke, den Waschkessel als Kochkessel zu verwenden, ein wenig auf den Magen schlagen, aber glaube mir, du würdest dich im Nu daran gewöhnen. Diese vielfältige Nutzung des Kessels der Messe beeinträchtigte unseren Appetit bereits nach kürzester Zeit nicht mehr im Geringsten. Auch stellte sich die Frage nach der "Schicklichkeit" bald nicht mehr, da der Soldat unter gewissen Umständen noch weitaus "Unvorstellbareres" zu erdulden hatte. Zwar wäre es in der Tat himmlisch gewesen, jedem Manne einen exzellenten "Magee Range"-Herd mit kupfernem Abzug und eine eigene Badewanne zur Verfügung zu stellen, aber irgendwo mussten nun mal Abstriche gemacht werden. Alles Große und Sperrige, das nicht zwingend erforderlich war, wurde aus dem Leben des Soldaten verbannt. Aus diesem Grunde konnten wir keine gesonderte Waschküche mit uns führen und unsere Gerätschaften mussten zwei oder drei Funktionen übernehmen.
Waschtag
Man mag sich nun fragen, welche Figur die Soldaten als Waschfrauen abgaben. Nun, einige von ihnen stellten sich ausgesprochen ungeschickt an und erzielten bescheidene Resultate, aber Notwendigkeit ist der beste Lehrer und so übten sich die Männer in etlichen Tätigkeiten, für welche sie zuhause keinen Finger gerührt hätten. Es war jedoch nicht notwendig, dass jeder Mann seine eigene Wäsche wusch, denn in den meisten Kompanien gab es mindestens einen Burschen, der sich bereiterklärte, diese Tätigkeit gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung zu übernehmen und es fand sich in der Regel genügend Kundschaft, um seine dienstfreien Stunden mit Arbeit zu füllen. Das Bügeln konnte entfallen, denn sogenannte "gestärkte Hemden", also Hemden mit einer Hemdenbrust, waren im Heer nahezu unbekannt (mit Ausnahme der Lazarette). Flanellhemden waren das Kleidungsstück der Wahl. Falls ein Mann den Mut besaß, sich dem Spotte seiner Kameraden auszusetzen, indem er einen Hemdkragen trug, so wählte er die Variante aus Papier. Auf Manschetten wurde im Lager gänzlich verzichtet.
Soweit es das Nähen betraf, verrichtete jeder Mann seine eigene Arbeit oder ließ es einfach bleiben, ganz nach Belieben, aber man bezahlte keinen anderen dafür. Ein jeder Soldat besaß eine sogenannte "Hausfrau" oder ein vergleichbares Nähset, das aus den notwendigen Nadeln, Garn, Fingerhut und dergleichen bestand und das ihm seine Mutter, seine Schwester, sein Liebchen oder eine Soldatenhilfsorganisation zugesandt haben mochte. Hieraus bezogen die Männer ihre Materialien zum Nähen und Stopfen.
Eine "Hausfrau"
Es muss gesagt werden, dass der durchschnittliche Soldat den Lockungen und Freuden des Sockenstopfens nicht so zugetan war, wie er es hätte sein sollen. Aus diesem Grunde schob er den Unglückstag beständig vor sich her, bis seine beiden Fersen schließlich "durch die offene Hintertüre" schauten und seine zehn Zehen vor ihren Wohnquartieren in Formation angetreten waren. Diese Vernachlässigung verbesserte immerhin die Belüftung und eröffnete die Möglichkeit, sich die Strümpfe von beiden Enden überzustreifen. Die Aufgabe, den Zehen wieder ein schützendes Obdach zu gewähren, war keine leichte und sie konnte nur auf wenige Arten bewältigt werden. Die wohl zeitsparendste (wenn auch nicht kunstfertigste) bestand wohl darin, das Loch einfach mit einem Stück Faden zuzubinden. Es war dies eine Möglichkeit, den Gordischen Knoten des Sockenstopfens zu lösen, die manch ein moderner Alexander anwandte, allerdings ist mir kein einziger derartiger Fall bekannt, in dem ein Soldat im Nachhinein mit dem Resultat seiner Arbeit zufrieden gewesen wäre.
Dann gab es da noch jene Männer, die ein Netz aus Garn über das Loch nähten, so wie sie es zuhause bei ihren Müttern beobachtet hatten, aber nun weder die Zeit noch die Geduld hatten, die Lücken zwischen den Fäden zu stopfen. Folglich starrten die Zehen und Fersen durch die notdürftigen Gitterstäbe ihres Gefängnisses und ihr erneuter Ausbruch war nur eine Frage von Stunden. Einige der Jungs wurden von ihren Familien mit selbstgefertigten Socken versorgt, welche womöglich ihre lieben, alten Großmütter gestrickt haben mochten. Dabei schien die Geduld, welche ihre Großmütterchen beim Stricken der Socken gezeigt hatten, auf die Empfänger überzugehen, denn sooft eine Näh- oder Stopfarbeit erforderlich wurde, setzten diese sich pflichtbewusst hin und erledigten die Aufgabe so sorgfältig und liebevoll, wie man es sich nur wünschen konnte. Ich mache mich keiner Übertreibung schuldig, wenn ich behaupte, dass die von diesen Männern angefertigten Flicken länger hielten als die Socken selbst.
Bei den Socken, welche aus den Regierungsbeständen an die Männer ausgegeben wurden, sparte man sich in der Regel jeglichen Reparaturversuch, denn sie waren überwiegend von unsagbar schlechter Qualität und weder die Zeit noch den Aufwand wert. Ihre Form ähnelte einem gekrümmten Ofenrohr und hier endeten die Gemeinsamkeiten noch nicht, denn, gleich einem Ofenrohr, hatten auch die Socken nach spätestens 48 Stunden an beiden Enden eine Öffnung.
Auch die Essenszubereitung war eine Tätigkeit, die mehr oder weniger viel Zeit der Soldaten in Anspruch nahm, doch sobald die Armee ein festes Lager bezogen hatte, übernahmen für gewöhnlich Kompanieköche die kulinarische Arbeit. Gelegentlich, wenn eine Kompanie es bevorzugte, wurden die Zutaten für die Rationen roh an die Männer ausgegeben. Es existierte in dieser Hinsicht keine offizielle Vorschrift. Ich möchte behaupten, dass die Soldaten es zumeist bevorzugten, wenn sie ihren Kaffee und Zucker in der unverarbeiteten Form erhielten, da der Alltag des Soldatenlebens rasch einen jeden von ihnen in einen wahrhaften Meister der Kaffeezubereitung verwandelte. Zudem konnten die Männer das Getränk eher nach ihren eigenen Geschmäckern zubereiten als es den Köchen möglich war, denn aus deren Gebräu war nur zu häufig noch eine Andeutung der zahlreichen weiteren Einsatzgebiete des Kochkessels herauszuschmecken. Ferner mochten einige Männer ihren Kaffee stark, andere wiederum schwach, manche wollten ihn süß, manche wollten ihn bitter. Letztere sparten sich ihren Zucker für andere Gerichte auf. Hiervon wird noch die Rede sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit den Militärrationen zuwenden.
In diesem Zusammenhang soll noch ein Umstand erwähnt werden, der so manchem Leser merkwürdig erscheinen mag: die Verwendung von Unmengen grünen Kiefernholzes als Feuerholz in den Winterlagern. Dieses Holz war häufig unsere einzige Wärmequelle. Die Bewohner der Nordstaaten würden eher versuchen, ein Feuer mit einem Eimer Wasser zu entfachen als grünes Kiefernholz zu verwenden. Dieses scheinbare Paradoxon ist jedoch rasch erklärt: Die Kiefern in den südlichen Breitengraden beinhalten weitaus mehr Harz als ihre Verwandten in den nördlichen Breiten. Zudem ist das Kernholz aller Kiefernarten stets verhältnismäßig trocken und im Süden scheint diese Trockenheit sogar noch ausgeprägter zu sein. Das Kernholz wurde als Zunder benutzt und das harzige Splintholz darübergelegt. Bis das Kernholz verbrannt war, hatte sich auch das Splintholz entzündet und gab dann ein brauchbares Feuer ab. Diese Kiefern hatten den Harthölzern den Vorteil voraus, dass sie leichter zurechtzuhauen waren; diesen Vorteil wussten die Soldaten durchaus zu schätzen.
Der Lagerbarbier
In einem festen Lager hatte nahezu jede Einheit ihren eigenen Barbier. Es ist wahr, dass viele Männer während ihrer Zeit im Felde nicht zum Rasiermesser griffen und sich dermaßen bereitwillig lange, wirre Haartrachten und Bärte wachsen ließen, als könnten diese sie in der Schlacht vor dem Feind verbergen. Die Mehrheit der Soldaten besaß ihr eigenes Set der benötigten Toilettenartikel und rasierte sich selbst, wobei die Männer regelmäßig ihr unschuldiges Blut im Dienste ihres Landes vergossen. Der beträchtliche Rest der Soldaten, mochten diese nun ungeübt im Umgange mit dem Messer oder einfach der Tätigkeit einer Selbstrasur abgeneigt sein, suchte den Lagerbarbier auf. Dieser Bursche ging seiner Tätigkeit bei kaltem oder stürmischem Wetter im Inneren seines Zeltes nach, doch für gewöhnlich bezog er seinen Posten hinter dem Zelt, wo er eine Sitzgelegenheit für den (fraglichen) Komfort seiner Opfer platzierte. Dieser Rasierstuhl war von ihm selbst zusammengezimmert. Sein Rahmen bestand aus vier in die Erde gerammten Pfählen, zwei längeren für die hinteren Stuhlbeine und zwei kürzeren für die Vorderbeine. Auf dieser Basis konstruierte der Barbier einen durchaus tauglichen Stuhl. Es waren allerdings längst nicht alle derart Tätigen ausgebildete Meister ihrer Kunst und der Nacken so manches Soldaten wies rötliche Schwellungen auf, wo ihm der Barbier mehr schlecht als recht und ungeschickt die Haare abgekratzt hatte. Die Rasiermesser befanden sich zudem häufig in einem äußerst erbärmlichen Zustande, vergleichbar der "Klinge des Gottvertrauens" mit welcher der Ire in dem alten Lied seine "Himmelherrgott-Rasur" erhält.
Eine weitere Tätigkeit, welcher in jedem Lager stets einige Männer nachgingen, darf an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: das Studium der Gefechtstaktik. Manche gingen ihm unter der Anleitung eines befreundeten Offiziers nach und manche trieb die Ambition auf eine Beförderung an. Andere wollten eine angesetzte Prüfung bestehen, für deren Primus ein Heimaturlaub ausgelobt war. All diese Männer mit ihren grundverschiedenen Motivationen steckten also ihre Nasen in die Bücher. Der Mehrzahl der einfachen Soldaten war jedoch die praktische Seite des Kriegshandwerkes bereits mehr als genug und sie wollten sich nicht auch noch mit der theoretischen Seite herumplagen. Die Männer gaben sich jeder verfügbaren körperlichen und geistigen Zerstreuung hin und taten ihr Bestes, um die Stunden möglichst rasch verstreichen zu lassen. Selbst jene Soldaten, die erst einen winzigen Bruchteil ihrer drei Jahre abgedient hatten, riefen nach jedem vergangenen Tag mit gespieltem Frohsinn aus: "Nur noch zwei Jahre und ein bisschen!"