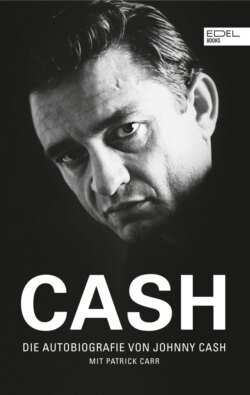Читать книгу CASH - Johnny Cash - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER ÜBERFALL
ОглавлениеCinnamon Hill hat seine eigenen Stimmungen, seine eigene Ausstrahlung und birgt sehr persönliche Erinnerungen.
Hier, wo ich gerade sitze, auf der Veranda an der Nordseite des Hauses, im Schatten der Jasminsträucher, etwa 85 Meter über dem Meeresspiegel, trennen mich nur wenige Meter von dem ruhigen, freundlichen Zimmer, in dem ich mich damals von meiner elementarsten Begegnung mit der Ärzteschaft erholte, meiner Notfall-Bypassoperation im Jahre 1988. Seit 1747, als das Haus erbaut wurde, sind die Menschen immer durch dieses Zimmer gegangen, wenn sie sich bei schlimmen Wirbelstürmen in Sicherheit bringen wollten. Und das, was jetzt das Badezimmer ist, diente damals als Schutzraum bei Hurrikanen und gleichzeitig als Windschutz für das Haus. Es ist aus 1,20 Meter dickem Kalkstein gebaut und weist nach Norden, in die Hauptwindrichtung des Hurrikans, eine keilförmige Konstruktion mit abgerundeten Ecken und schrägem Dach, die die stärksten Sturmböen seitlich nach unten oder nach oben über das Haus hinweglenkt. Sie ist äußerst wirkungsvoll und meines Wissens einzigartig. Ich habe noch nirgends etwas Vergleichbares gesehen. John Carters junge Frau Mary hat die Innenwände mit tropischen Fischen bemalt.
Noch dichter bei mir, direkt zu meinen Füßen, liegt ein anderes Erinnerungsstück: die Haut eines Krokodils, das ich 1976 getötet habe, ein 3,30 Meter langes und 500 Pfund schweres, äußerst zähes und gefährliches altes Tier. In seinen besseren Zeiten gaben wir ihm den Namen »One-Eyed Jack«. Ich verpasste ihm drei Kugeln aus einer rostigen .30-30er mitten ins Gehirn – guter Schuss, muss ich sagen, und das ohne Visier im Dunkeln –, bis er aufhörte, um sich zu schlagen, und wir ihn zu uns ins flache Sumpfboot ziehen konnten, wo er natürlich prompt wieder zum Leben erwachte. Das war kein sehr guter Moment. Mein Freund Ross Kananga, ein Profi auf diesem Gebiet, musste noch fünf Pistolenschüsse auf ihn abfeuern, bis er endgültig Ruhe gab.
Der dortigen Tierwelt haben wir in jener Nacht einen großen Gefallen getan und wir selbst hatten auch etwas davon. Das Fleisch vom Krokodilschwanz schmeckt köstlich, wenn man es in dünne Scheiben schneidet, in Mehl und Gewürzen wendet und dann wie Fisch in der Pfanne brät.
Ich bereue es nicht, dass ich One-Eyed Jack getötet habe, aber inzwischen habe ich aufgehört zu töten. Ich möchte es nicht mehr.
Auf dieser Veranda, hier an dieser Stelle, ist schon vieles entstanden. Billy Graham hat drei seiner Bücher teilweise hier geschrieben, und sie ist einer meiner Lieblingsplätze zum Schreiben. Außerdem ist es natürlich gut möglich, dass einige der Nachkommen der Barretts – die Barretts aus der Wimpole Street, die Familie von Elizabeth Barrett Browning, die ursprünglichen Besitzer des Hauses – einige ihrer Tagebücher, Prosastücke und Gedichte hier geschrieben haben. Auf jeden Fall haben sie hier gelebt und sind hier gestorben; viele von ihnen wurden auf ihrem privaten Friedhof beigesetzt, an einem wunderschönen Flecken unterhalb des Hauses, einem meiner Lieblingsplätze auf dieser Welt. Jeder Einzelne der Männer, Frauen und Kinder, die dort begraben liegen, lebte und starb in diesem Haus, das jetzt mir gehört.
Als John Carter, kurz nachdem er vier geworden war, zum ersten Mal zu dem Friedhof kam und June gerade das Tor öffnete, sagte er etwas zu ihr, das sie zunächst überhaupt nicht verstand: »Moma, mein Bruder Jamie ist hier.«
Sie war total verblüfft, aber dann schaute sie sich um und bückte sich, um die Schrift auf dem allerkleinsten Grabstein zu lesen, einem dieser herzzerreißenden winzigen Denkmäler, bei denen man schon auf den ersten Blick sieht, dass hier ein kleines Kind begraben liegt. Da der Stein auf der einen Seite bereits verwittert war, konnte sie die letzte Ziffer des Geburts- und Todesdatums nicht erkennen, aber die ersten drei Zahlen waren jeweils 177-, und der Vorname des kleinen Barrett war James. Sie konnte es immer noch nicht fassen, aber es stand da und es steht heute noch da.
Vielleicht war es uns vorherbestimmt hierherzukommen. Auf jeden Fall übte das Haus eine enorme Anziehungskraft auf mich aus, als ich es 1974 zum ersten Mal sah. Ich fuhr mit einem Allradwagen in den Bergen umher. Neben mir saß John Rollins, dem das Haus und das ganze Land drum herum gehörte, einschließlich Rose Hall, des größten all der großen Häuser. Als wir Cinnamon Hill erreichten, habe ich mich sofort in das Haus verliebt. Es war zwar in keinem besonders guten Zustand, aber im Grunde sehr solide gebaut – ein Playboy lebte dort in einem einzigen Zimmer, mit nur einem elektrischen Licht und einer Hausangestellten – und mir kam sofort die Idee, dass ich es renovieren und zu einem wundervollen Ferienhaus umbauen könnte. John fand auch Gefallen an der Idee, aber es kam für ihn nicht infrage, es mir zu verkaufen. Er wollte es später einmal für sich selbst nutzen. Wenn ich es herrichten wolle, sagte er, könne ich das gerne tun und ich könne mich jederzeit dort aufhalten.
Ich machte mich an die Arbeit und Ende 1974 war es so weit, dass wir unser erstes Weihnachtsfest auf Jamaika verbringen konnten. Die Vorstellung, im Haus eines anderen zu leben, hat mir allerdings nie besonders behagt und damals gefiel sie mir schon gar nicht. Ich wollte unbedingt, dass das Haus mir gehört.
Inzwischen waren John Rollins und ich gute Freunde geworden. Wir waren uns vom ersten Moment an sympathisch gewesen, denn wir hatten die gleichen Ansichten und eine ähnliche Herkunft – er kam auch von den Baumwollfeldern und hatte in Georgia fast das gleiche Leben geführt wie ich in Arkansas – und deshalb vertraute er mir ein paar seiner Geheimnisse an. Das, worum es hier geht, betraf die Art und Weise, wie er vorging, wenn er ein richtig großes Geschäft abschließen wollte, und das ist etwas, worauf er sich wirklich gut versteht. Er war 1974 schon ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und er hat es seither noch viel weiter gebracht. Er bewegt sich in finanziellen Dimensionen, die meine bei Weitem übersteigen. Das letzte Mal, als ich mich danach erkundigte, gehörten zu seiner Firmengruppe etwa zweihundert Unternehmen, von Reklametafeln in Mexiko über Transportgesellschaften in den Vereinigten Staaten bis hin zu Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt. Eine Zeit lang war er Vizegouverneur von Delaware, seinem heutigen Hauptstandort. Ich bin der Patenonkel seines Sohnes Michael.
Wenn er ein Geschäft erfolgreich zum Abschluss bringen wolle, so erzählte er mir, ziehe er immer seinen dunklen Anzug an – seinen »seriösen Anzug«, wie er ihn nannte – trage sein Angebot vor und am Ende sage er immer: »Wenn wir das so machen könnten, wüsste ich das wirklich sehr zu schätzen.«
Nun, ich habe leider keinen »dunklen Anzug«, hatte auch damals keinen, und die schwarzen Outfits im Stil von Benjamin Franklin oder im Riverboat-Gambler-Look, die ich damals zu besonderen Anlässen gerne trug, waren alles andere als »seriöse Anzüge«. Also ließ ich diesen Teil des Erfolgsrezepts einfach aus, als ich mich kurz nach Weihnachten mit John auf die Veranda setzte.
»Weißt du, John, ich habe dieses Jahr eine Menge Geld in dieses Haus gesteckt«, begann ich. »Es war weit mehr, als ich in ein Haus investieren sollte, in das ich nur ab und zu mal komme, um dort schöne Ferien zu verbringen. Wir haben Leute eingestellt, die hier arbeiten, wir haben das Haus hergerichtet, haben das Gelände hergerichtet. Wir haben vor, einen Swimmingpool anzulegen. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir das Haus verkaufst.«
»Nein«, sagte er. »Das kann ich nicht tun.« Er wollte es immer noch für sich selbst.
Ich drängte. »Aber wir müssen das Haus einfach haben.«
Er ließ sich immer noch nicht drauf ein. »Du kannst es haben, wann immer du willst. Komm einfach vorbei«, sagte er.
»Sieh mal, John, du weißt selbst, dass das so nicht ganz in Ordnung wäre. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, es herzurichten, wenn es eigentlich immer noch dir gehört. Unser Herz hängt inzwischen daran. Wir haben mit unseren eigenen Händen daran gearbeitet. Wir lieben dieses Haus. Wir müssen es dir einfach abkaufen.«
»Ich weiß nicht …«, sagte er.
»Nun, mal angenommen, du würdest es verkaufen. Wenn es so wäre, wie viel würdest du dafür verlangen?«
Er nannte mir eine Summe. Bingo! Jetzt kamen wir der Sache schon etwas näher. Der schwierigste Teil war zumindest geschafft. Ich dachte über seinen Preis nach, beschloss, dass da noch etwas zu machen war, und machte ihm mein Angebot. Dann schaute ich ihm direkt in die Augen und sagte so nüchtern und sachlich wie möglich: »Wenn wir das so machen könnten, wüsste ich das wirklich sehr zu schätzen.«
Er starrte mich einen Moment lang an, dann begann er zu lachen. »Alles klar«, sagte er, »wir sind im Geschäft.«
So machten wir es dann auch und June und ich fingen an, unser Leben mehr und mehr in unser neues Zuhause zu verlagern.
In und um Cinnamon Hill herum ist die Vergangenheit greifbar nahe, überall wird man an frühere Zeiten und frühere Generationen erinnert, mal sehr deutlich, mal weniger direkt. Mehr als ein Jahrhundert lang war hier eine Zuckerplantage. Sie wurde von Tausenden von Sklaven bewirtschaftet, die auf dem gesamten Besitz verteilt gruppenweise in ihren Hütten lebten. All die Hinterlassenschaften jener Menschen, die Metallscharniere von ihren Türen und die Nägel aus ihren Wänden, liegen verborgen im Gestrüpp der Berghänge oder in der Erde unter dem gepflegten grünen Rasen des Golfplatzes, der eine Schleife um mein Haus macht. Ich bezweifle, dass die Urlauber, die auf diesem schönen Golfplatz spielen, sich jemals Gedanken darüber machen oder eine Vorstellung davon haben, was für ein reges Leben hier früher herrschte – obwohl, manche vielleicht schon, das kann man nie wissen. Ich bin mal mit einem Metalldetektor herumgelaufen und habe alle möglichen Dinge gefunden. Hier ist eine Menge passiert.
Ich glaube, es gibt hier Geister. Für viele rätselhafte Dinge, von denen Gäste und Besucher unseres Hauses erzählt oder die wir selbst erlebt haben, gibt es eine einfache physikalische Erklärung – den Ast eines Baumes zum Beispiel, der am Dach des Zimmers entlangstreifte, in dem Waylon und Jessi immer so merkwürdige Geräusche hörten. Aber es gab auch Vorfälle, für die es keine normale Erklärung gibt. So sahen verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten mysteriöse Gestalten – eine Frau, einen kleinen Jungen –, und das über Jahre hinweg. Einmal erschien im Esszimmer, wo wir zu sechst saßen, eine Frau. Wir alle sahen sie. Sie kam durch die Tür, die zur Küche führt, eine Frau in einem langen weißen Kleid, schätzungsweise Anfang dreißig, und schritt durch das Zimmer auf die Doppeltür in der gegenüberliegenden Wand zu. Die Tür war verschlossen und verriegelt. Sie ging hindurch, ohne die Tür zu öffnen, und von der anderen Seite aus klopfte sie dann: rat-tat-tat, rat-tat.
Wir hatten bisher nie Probleme mit diesen Seelen. Ich glaube nicht, dass sie uns etwas Böses wollen, und wir haben absolut keine Angst vor ihnen. Sie haben einfach nichts Furchterregendes an sich.
Als zum Beispiel Patrick Carr hier war, um mit mir an diesem Buch zu arbeiten, wurde er mitten in der Nacht durch ein Klopfen an der Tür neben seinem Bett geweckt, rat-tat-tat, rat-tat, und ihm schoss sofort der Gedanke durch den Kopf: Ach, das ist nur der Geist. Mach dir nichts draus. Schlaf weiter. Er erwähnte den Vorfall sogar erst am darauf folgenden Abend, nachdem wir ihm – zum ersten Mal – von der Lady erzählt hatten, die durchs Esszimmer gegangen war, und dem Klopfen, das wir danach gehört hatten. Daraufhin verriet uns seine Frau, dass sie das Gleiche erlebt habe: das gleiche Klopfen, die gleiche Reaktion. Beide hatten den Vorfall als eine so natürliche Sache angesehen, dass sie einander nicht einmal davon erzählt hatten.
Wir haben also keine Angst. Die einzige wirklich erschreckende Geschichte über Cinnamon Hill gehört ins Reich der Lebenden und führt mir immer wieder vor Augen, dass einige von ihnen – nur ein paar wenige, eine kleine Minderheit – sehr viel gefährlicher sind als alle Toten zusammen.
Es wird langsam dunkel. Hier sitze ich nun in der jamaikanischen Dämmerung mit schlimmen Erinnerungen, düsteren Gedanken.
Jeden Abend etwa um diese Zeit, bei Einbruch der Dunkelheit, gehen wir um das Haus herum und schließen und verriegeln alle Türen. Carl macht das oder ich mache es selbst. Die Türen sind massiv: dickes, hartes Mahagoni aus den umliegenden Bergen, das vor zweieinhalb Jahrhunderten, im Jahre 1747, in die Kalksteinmauern eingebaut wurde. Sie haben schon vieles überstanden: Hurrikane (Dutzende davon), Sklavenaufstände (einschließlich des allgemeinen Aufstands von 1831, bei dem die meisten anderen großen Häuser auf der Insel zerstört wurden) und sogar gelegentlich ein Erdbeben. Sie sind sicher. Die Anwesenheit der Wachmänner, während der Dunkelheit sind es immer mindestens zwei, machen sie noch sicherer. Die Wachmänner gehören nicht zur Familie, aber ich vertraue dem privaten Sicherheitsdienst, für den sie arbeiten. Ein Anruf bei ihrer Zentrale mit meinem Walkie-Talkie, das neben meinem Bett liegt, würde genügen und sofort stünde hier eine ganze Armee bereit.
Nachdem unser Haus ausgeraubt worden war, hatten wir tatsächlich eine Armee hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Ministerpräsident war sehr bestürzt und fürchtete natürlich, dass wir Jamaika für immer verlassen und für tourismusschädigende Publicity sorgen würden. Also ließ er schwer bewaffnete Einheiten der jamaikanischen Streitkräfte in den Wäldern rund um unser Haus stationieren, bis es für uns Zeit wurde, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Ich habe in der Öffentlichkeit nie viel über den Raubüberfall gesprochen, nicht einmal mit meinen Freunden. June hat die Geschichte in ihrem Buch From the Hearterzählt und sie hat auch bei anderen Gelegenheiten darüber geredet. Bei uns ist es so, dass sie meistens das Wort führt, wenn wir in Gesellschaft sind, und ich zuhöre. Es ist doch wirklich interessant, wie sich die Erinnerung zweier Menschen an ein und dasselbe Ereignis in so vieler Hinsicht unterscheiden kann. Ich weiß nicht, wie oft ich schon zuhörte, wenn June und die anderen sich über den Raub unterhielten – na ja, es war eigentlich mehr als ein Raub, es war ein gewaltsamer Überfall auf unser Haus – und jedes Mal dachte, das wusste ich ja gar nicht, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht, ich habe das ganz anders in Erinnerung.
Ich will damit nicht sagen, dass June sich irrt und ich es besser weiß, sondern nur, dass die Erfahrungen und Erinnerungen von uns Menschen sehr subjektiv sind. Man kommt manchmal schon ins Grübeln, ob es so etwas wie »historische Tatsachen« überhaupt geben kann. Ich meine, ich habe gerade Undaunted Courage, den wunderbaren Bericht von Stephen Ambrose über die Lewis-und-Clark-Expedition, gelesen und er hat mir wirklich gut gefallen. Aber es fiel mir auf, wie sehr die anderen Abhandlungen, die ich bereits zu diesem Thema gelesen habe – einige davon waren sehr gut recherchiert und die meisten stützten sich auf Clarks Tagebücher –, sich nicht nur in Bezug auf Details und einzelne Interpretationen unterschieden, sondern auch in grundlegenden chronologischen und geografischen Fragen: Was passierte wem, wo, wann und in welcher Reihenfolge. Und wenn man sich dann die Schriftstücke anderer Mitglieder der Lewis-und-Clark-Expedition ansieht, kommen die Ereignisse noch mehr durcheinander – aber jeder Einzelne, jeder, der im Jahre 1820 dort draußen in der Prärie Tagebuch führte oder zurück nach Washington kam oder zu Hause im Freundeskreis über seine Erinnerungen sprach, war von seinen Darstellungen fest überzeugt. Was natürlich nur allzu menschlich ist. Wenn man zu Stift und Papier greift (oder sich vor einen Kassettenrecorder oder Computer setzt), sind Aussagen wie »ich kann mich nicht daran erinnern« und »ich bin mir nicht sicher, ob es so oder so war« offenbar nicht angebracht, auch wenn sie die Realität genauer widerspiegeln als alles, was man gerade schreiben möchte. Das ist vielleicht keine sehr originelle Überlegung, aber ich will sie im Hinterkopf behalten.
Der Raubüberfall, so wie ich ihn in Erinnerung habe, begann genau um sechs Uhr abends, am ersten Weihnachtsfeiertag 1982. In unserem Haus befanden sich meine Frau June Carter, unser Sohn John Carter, sein Freund Doug Caldwell, Reba Hancock, meine Schwester, Chuck Hussey, ihr damaliger Ehemann, Miss Edith Montague, unsere damalige Köchin und Haushälterin, ihre Stieftochter Karen, Desna, die damals unser Dienstmädchen war und jetzt bei uns kocht und den Haushalt führt, Vickie Johnson aus Tennessee, die nur über Weihnachten bei uns arbeitete, und Ray Fremmer, ein befreundeter Archäologe. Es gab keine Wachen. Damals hatten wir noch keine Wachleute und auch keine verschlossenen Türen. Wir waren im Esszimmer, einem langen, schmalen Raum, der sich über die gesamte Breite des Hauses erstreckt und fast ganz von einem Tisch ausgefüllt wird, an dem zwanzig Personen bequem essen können.
Wir hatten uns gerade zum Abendessen niedergelassen und waren im Begriff, das Tischgebet zu sprechen, als sie plötzlich hereingestürmt kamen, durch alle drei Türen zugleich. Einer hatte ein Messer, einer ein Beil und einer eine Pistole. Alle hatten Nylonstrümpfe über dem Kopf. Sie brüllten los: »Irgendjemand wird hier heute Nacht sterben!« Miss Edith fiel in eine tiefe Ohnmacht.
Wir mussten uns mit dem Bauch auf den Boden legen. Ich schaute rüber zu June und sah, wie sie versuchte, ihre Uhr und ihren Ring zu verstecken. Ich betete, dass sie es nicht bemerken würden. Sie sahen es nicht. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass Ray an diesem Abend seine Waffe nicht bei sich trug, denn wenn er sie dabei hätte, würde er sicher versuchen, irgendetwas damit anzufangen.
Der mit der Pistole sagte: «Wir wollen eine Million Dollar, sonst wird einer von euch sterben.«
Ich war ganz ruhig. Ich hatte sofort erkannt, dass wir nur überleben würden, wenn wir uns ruhig und vernünftig verhielten.
Ich hob meinen Kopf und sah den Mann mit der Waffe an. »Ihr wisst genau, dass eure Regierung uns nie erlauben würde, eine Million Dollar ins Land zu bringen, selbst wenn wir sie hätten, was aber nicht der Fall ist«, sagte ich zu ihm, »aber wenn ihr uns nichts antut, bekommt ihr alles, was wir haben.«
»Ihr habt Geld!«, sagte er mit Nachdruck.
»Ja, wir haben welches«, sagte ich, »aber wir haben keine Million Dollar.« Tatsächlich hatten wir einige Tausend Dollar in meiner Aktentasche unter unserem Bett und natürlich hatte June ihren Schmuck. Für diese Kerle würde schon einiges zusammenkommen, wenn keiner die Nerven verlor.
In dieser Beziehung war es um unsere Gruppe bisher nicht zum Besten bestellt. Desna war in heller Panik und die arme Miss Edith, kaum war sie wieder zu sich gekommen, begann zu schreien: »Ich bekomme einen Herzanfall! Ich bekomme einen Herzanfall!«
Vielleicht bekam sie auch wirklich einen. Die Männer, die uns gefangen hielten, dachten das offenbar, denn sie durfte sich hinsetzen und einer von ihnen sagte zu Desna, sie solle in die Küche rennen und ein Glas Wasser holen. Das war ein aufschlussreicher Moment, ein erstes Anzeichen, dass diese Männer vielleicht keine Profis waren oder zumindest keine Killer. Richtig schwere Jungs hätten sich keine Sorgen um Miss Ediths Gesundheit gemacht und sich ihren hysterischen Anfall nicht bieten lassen. Sie hätten sie benutzt, um ein Exempel zu statuieren, und sie einfach erschossen oder ihr mit dem Beil den Kopf gespalten.
Mir war auch aufgefallen, dass sie noch sehr jung waren. Der mit der Schusswaffe war vielleicht schon über zwanzig, aber die beiden anderen waren noch Teenager und sie waren alle sehr nervös. Das beruhigte mich. Vielleicht war das verkehrt, aber so war es eben. Ich dachte wieder, wenn wir cool bleiben, können wir vielleicht heil aus der Sache rauskommen.
June verlor die Nerven oder zumindest tat sie so, als die Männer anfingen, uns den Schmuck und die Uhren abzunehmen. Sie setzte sich auf und sagte, sie habe Schmerzen in der Brust, sie habe es am Herzen. Ich glaube, das war der Moment, als der Mann mit der Pistole den kleinen Doug CaIdwell hochzog und auf die Beine stellte, ihm die Waffe an die Schläfe drückte und sagte: »Alle tun, was ich sage, oder John Carter wird sterben!»
Ein doppeltes Dilemma für mich. Erstens, sollte ich ihm sagen, dass er nicht John Carter hatte? Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Zweitens, war die Waffe echt? Ich sah sie mir zum ersten Mal genauer an, aber ich konnte es nicht sagen. Ich kenne mich mit Schusswaffen aus – ich bin damit aufgewachsen und habe in meinem Leben schon Hunderte besessen –, aber dieses Teil war mir unbekannt. Sie war klein und sah ziemlich primitiv aus, aber ich kannte mich gut genug aus, um zu wissen, dass das nichts zu sagen hatte: Es konnte genauso gut eine billige, aber trotzdem tödliche Pistole sein wie ein überzeugendes Spielzeug.
Die Frage blieb ungeklärt, zunächst jedenfalls – ich musste also davon ausgehen, dass die Pistole echt war und der Kerl von ihr Gebrauch machen würde, wenn wir ihn zu nervös machten. Dann löste sich das erste Problem von selbst. Als wir wieder aufstehen sollten, um zur zweiten Phase unserer Begegnung überzugehen, sah der Mann mit der Pistole John Carter an und erkannte seinen Fehler. Er stieß Doug beiseite, dann packte er meinen Sohn und drückte die Pistole an seinen Kopf.
Unter diesen Bedingungen begannen wir also mit der eigentlichen Arbeit, gingen von Raum zu Raum durch das Haus und übergaben all unsere tragbaren Wertgegenstände an diese verängstigten, adrenalingeladenen kleinen Gangster – und Junkies, dachte ich. Mit Drogensucht kannte ich mich noch besser aus als mit Waffen. An diesen Jungs spürte man sie.
Wir verbrachten die nächsten zwei Stunden damit, im Haus herumzulaufen, wobei einer von denen ständig die Waffe an John Carters Kopf hielt, während die anderen unsere Sachen durchsuchten.
Sie gingen dabei behutsam und sogar ordentlich vor, fiel mir auf, und stellten nicht das ganze Haus auf den Kopf, wie Profis es getan hätten. Sie waren zunächst ziemlich grob gewesen, vor allem zu den Frauen, hatten Reba herumgeschubst, bis sie fürchterliche Angst bekam und Chuck schon gefährlich wütend wurde. Der mit dem Beil fasste June so grob an, dass er ihr ein Büschel Haare ausriss. Bis wir dann im großen Schlafzimmer waren, hatten sie sich jedoch einigermaßen entspannt. Sie wurden schon fast gesprächig, fragten uns, wie lange wir dieses Jahr Weihnachten bleiben wollten und so weiter. Die ganze Zeit über hatte ich ganz ruhig mit ihnen gesprochen und ihnen offen und ehrlich gesagt, wo sich die Wertsachen befanden, und das zahlte sich jetzt aus. Sie redeten mich jetzt mit »Sir« an. Irgendwann hatte ich zu dem Mann gesagt: »Bitte nehmen Sie die Waffe vom Kopf meines Sohnes weg«, und obwohl er das nicht tat, lag eine klare Botschaft in seiner Antwort: »Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mann.«
Im Schlafzimmer wurde es dann äußerst merkwürdig. Der Mann mit der Pistole stand auf dem Bett, den Lauf seiner Waffe nur wenige Zentimeter von John Carters Kopf entfernt, und begann, ihm nette kleine Fragen zu stellen: »Was machst du so hier? Was würdest du denn gerne in Jamaika unternehmen? Schnorchelst du?«
John Carter antwortete ruhig und freundlich. In dieser wirklich absurden Situation verhielt er sich einfach fabelhaft. Er war erst elf Jahre alt.
»Das ist eine echte Waffe, die ich dir da an den Kopf halte, weißt du das?«, wagte der verrückte Kerl zu sagen.
»Ja, ich weiß«, sagte John Carter. »Ich gehe manchmal mit meinem Dad zum Jagen. Ich kenne mich mit Waffen aus.«
»Möchtest du meine Waffe fühlen?«
Plötzlich wusste ich, was es bedeutet, wenn jemand sagt: »Mir schlug das Herz bis zum Halse.« Mir stockte der Atem.
John Carter zögerte nicht einmal. »Nein, Sir. Ich spiele nicht mit Schusswaffen. Ich habe großen Respekt vor ihnen. Sie sind sehr gefährlich.«
Der Mann mit der Waffe nickte und grinste unter seiner Strumpfmaske. »Hey, du gefällst mir, Mann!«
»Danke, Sir«, sagte John Carter.
Danach entspannte sich die Situation deutlich. Ich glaube, wir hatten jetzt alle das Gefühl, dass die Geschichte ohne Blutvergießen ausgehen würde, und die Räuber wussten inzwischen, dass sie mit einer ziemlich fetten Beute abziehen würden. Reba war die Einzige, die immer noch einen sichtlich verzweifelten Eindruck machte. Der Rest von uns war eifrig darum bemüht, sie einigermaßen zu beruhigen.
Als sie ihre Beute eingesackt hatten, sagte einer der Räuber zu uns: »Wir werden euch im Keller einsperren.« Daraufhin fingen die Frauen wieder an zu schreien, aber ich dachte, dass wir darüber eigentlich ganz froh sein konnten. Das bedeutete, dass sie nicht doch noch in letzter Minute eine böse Überraschung für uns bereithielten, uns zum Beispiel zu töten, um die Zeugen loszuwerden. Ich weiß nicht, für wie sicher sie ihre Verkleidung mit den Strumpfmasken hielten, aber nach über zwei Stunden unter wechselnden Lichtbedingungen kam ich zu dem Ergebnis, dass die Masken ihren Zweck in keiner Weise erfüllten. Bei einer Gegenüberstellung hätte ich wahrscheinlich jeden Einzelnen von ihnen herausdeuten können.
Sie ignorierten die Proteste der Frauen, führten uns nach unten und schlossen uns, wie angekündigt, im Kellergeschoss ein – oder, wie June sagen würde, »im Verlies«. Sie verkeilten die Tür von außen mit einem Stück Holz und dann gingen sie.
Allerdings nur für einen Moment. Einer von ihnen kam gleich noch einmal zurück und schob einen Teller mit Truthahn unter der Tür durch. »Wir wollen doch, dass ihr euer Weihnachtsessen noch bekommt«, sagte er. »Das wollen wir euch nun wirklich nicht nehmen.«
John Carter und Doug waren schon beim Essen, da hörten wir, wie unsere Hunde, die bis dahin keinen Ton von sich gegeben hatten, zu bellen anfingen, als die Räuber sich verabschiedeten.
Wir brauchten eine ganze Weile, aber irgendwann gelang es Chuck Hussey und mir, die Tür aufzubrechen. Danach ging unsere kleine traurige Gruppe aus dem Kellergeschoss nach oben, um die Polizei zu rufen.
Die jamaikanische Polizei fackelt nicht lange. Der Mann mit der Schusswaffe wurde noch in derselben Nacht samt seiner Beute gefasst, und als er sich seiner Verhaftung widersetzte, wurde er getötet. Die anderen, die Kids, wurden ein paar Wochen später hei einem weiteren Raubüberfall in Kingston erwischt und nach kurzer Zeit im Gefängnis kamen auch sie bei einem Ausbruchsversuch ums Leben. So wie ich es verstanden habe, hatten die Wärter ihnen eine Leiter für ein Arbeitsprojekt besorgt und ganz zufällig schon auf der anderen Seite gewartet, als die Jungs über die Mauer geklettert kamen.
Ich war nicht sehr überrascht, als ich es erfuhr. Die Polizei war in der ganzen Angelegenheit äußerst verschwiegen gewesen – sie hatten uns nicht einmal erzählt, dass sie den ersten Mann erwischt hatten –, aber mir fiel jetzt wieder ein, wie mir ein Polizist am Morgen nach dem Überfall unmissverständlich klargemacht hatte, dass man die Räuber auf jeden Fall fangen und dass man sich ihrer schon annehmen würde.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Cash«, sagte er. »Diese Leute werden Sie und Ihre Familie nie mehr belästigen. Darauf können Sie sich verlassen.« Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wird mir klar, dass damals mehr hinter seinen Worten steckte, als mir bewusst war. Vielleicht verstand ich ihn aber auch sehr gut und zog es vor, mir nichts dabei zu denken.
Und was halte ich nun von der ganzen Sache? Wie stehe ich zu den inoffiziell geduldeten Schnellgerichten in der Dritten Welt?
Ich weiß es nicht. Wie denken Sie darüber?
Welche Gefühle habe ich dabei? Wie reagiere ich emotional auf die Tatsache (oder zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit), dass die verzweifelten Junkies, die meine Familie bedroht und traumatisiert haben und uns alle leicht hätten töten können (vielleicht ohne das überhaupt vorgehabt zu haben), für ihre Tat hingerichtet wurden – oder ermordet oder wie Hunde erschossen, was auch immer?
Ich habe keine Antworten darauf. Ich weiß nur eins: Es tut mir weh, wenn ich verzweifelte junge Männer sehe oder eine Gesellschaft, die so viele von ihnen hervorbringt und unter ihnen leidet, und ich hatte das Gefühl, ich würde diese Jungs kennen. Wir waren uns irgendwie ähnlich, sie und ich: Ich wusste, wie sie dachten, ich wusste, was sie brauchten. Sie waren wie ich. Ich wusste auch sofort, wie ich auf die Bedrohung, die sie mir ins Haus brachten, reagieren würde: Ich würde nicht davonlaufen.
Kurz nach dem Überfall sprach ein Reporter die Frage an: »Werden Sie Jamaika jetzt verlassen?«
»Nein, das werden wir nicht«, sagte ich ihm. »Das ist unser Zuhause.Das ist unser Haus. Wir haben das gleiche Recht, hier zu sein, wie alle anderen. Wir werden weiterhin hierherkommen. Wir lassen uns von niemandem verjagen.«
Jedes Wort davon war ernst gemeint, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Die Zweifel, Schuldgefühle und Ängste in mir waren genauso stark wie mein Trotz. Zunächst einmal hatte ich das Gefühl, reichlich naiv und dumm gewesen zu sein, mit meinen Lieben in einem Haus mit offenen Türen zu leben, obwohl die Anzeichen der Gefahr um uns herum deutlich zu erkennen waren – in den lokalen Zeitungen mit ihren Berichten von Mordfällen, schweren Körperverletzungen und Straßenkämpfen in Kingston; in den Augen der Polizisten, der Rastamänner und all der anderen Gruppierungen, die an den politischen Machtkämpfen und Ganjakriegen in Jamaika beteiligt sind; und praktisch sogar vor unserer eigenen Haustür, bei dem malerischen Wasserfall, wo James Bond in Leben und sterben lassen herumturnte und wo sich jeden Tag ein lockerer Haufen von Souvenirverkäufern, Ganjadealern und potenziellen Einbrechern versammelte, um Geschäfte zu machen.
Ich kam schon so lange nach Cinnamon Hill, dass ich fast das Gefühl hatte, diese Typen gehören zur Familie. Einige von ihnen hatte ich hier schon gesehen, als sie erst sechs oder sieben Jahre alt waren. Die Kriminellen, die in mein Haus eingedrungen sind und mit dem Leben dafür bezahlt haben, waren vielleicht Jungs, die ich habe aufwachsen sehen.
Wenn es so wäre, würde das einiges erklären: Warum die Hunde nicht angeschlagen hatten, woher sie gewusst hatten, wo und wann sie uns alle zusammen erwischen würden, warum sie das Haus und seine Bewohner so gut kannten. Die beiden anderen möglichen Theorien, dass es sich entweder um absolut Außenstehende oder aber um sehr vertraute Personen handelte, waren nicht sehr überzeugend. Die hiesigen Ganoven hätten Außenstehende sofort davongejagt, wenn sie mitbekommen hätten, dass sie uns beobachteten, und die uns vertrauten Personen, Miss Edith und ihre Familie, waren über jeden Verdacht erhaben.
Es dauerte noch sehr lange, bis ich nach dem Überfall meinen inneren Frieden wieder gefunden hatte. Ich grübelte noch lange darüber nach, fühlte mich ungerecht behandelt und zugleich schuldig. Ich nahm Schlaftabletten und trug eine Schusswaffe. Mit der Zeit verschwanden diese Nachwirkungen jedoch. Bestehen blieb nur die vernünftigste meiner Konsequenzen: professioneller bewaffneter Schutz rund um die Uhr. Damit konnte ich leben. Mit dem Vertrauensverlust und dem Verlust der Unschuld leben zu müssen war schwerer, aber auch das gelang mir irgendwann. Ich hatte schon immer gewusst, was es bedeutet, wenn man sich in seinem sicheren Zuhause plötzlich gefährdet fühlt.
Die Reaktionen der anderen Opfer auf den Überfall waren sehr unterschiedlich und reichten von Rebas glatter Weigerung, je wieder einen Fuß auf Jamaika zu setzen (sie hat es seither auch nie wieder getan), bis hin zu John Carters offenkundiger Gelassenheit. »Ja, das war vielleicht eine Nacht« ist so ziemlich alles, was er je zu dem Thema gesagt hat. June hat es, glaube ich, geholfen, über die Geschichte zu reden.
Heute kann ich zurückschauen und sehen, dass die ganze Sache im Nachhinein auch ihre guten Seiten hatte. Wenn ich meine Spaziergänge mache oder mit dem Golfcart runter ans Meer fahre, werde ich von den hiesigen Leuten oft angehalten und herzlich begrüßt – »Hallo, Mr. Cash, wie gehts denn so?« –, und ich weiß nicht, wie oft man mir schon für meine Entscheidung gedankt hat, in Jamaika zu bleiben. Seit dem Überfall bin ich in vieler Hinsicht stärker in das Leben auf Jamaika eingebunden, was mir sehr guttut. Heute fühle ich mich in diesem wunderschönen Land wirklich zu Hause und ich liebe und bewundere seine stolzen und freundlichen Bewohner.
Hier sitze ich, in der »blauen Stunde«, wie meine schottischen Vorfahren sagen würden, und beobachte das sanfte Leuchten der untergegangenen Sonne über den Bergen hinter meinem Haus und lausche den Tieren der Nacht, die mit ihren Geräuschen die Abendstille vertreiben – Schichtwechsel in der Natur, hier genauso wie in New York und Washington, D. C.; und in Memphis und Little Rock wird es in etwa einer Stunde so weit sein. Ich denke an meine Kindheit zurück. Ich sitze wieder auf der vorderen Veranda des von der Regierung gebauten Hauses in der Kolonie von Dyess, mit Mom und Dad und meinen Brüdern und Schwestern. Wir sind alle zusammen, während meine Mutter ihre geistlichen Lieder singt und dazu Gitarre spielt. Ihr Gesang verbannt Furcht und Einsamkeit, lässt den schwarzen Hund ganz zahm zu ihren Füßen liegen und übertönt sogar die Schreie der Wildkatzen im Unterholz.
Das sind Klänge, die ich nie wieder hören werde – weder die Wildkatzen noch die tröstliche Stimme meiner Mutter. Aber die Lieder sind mir geblieben.