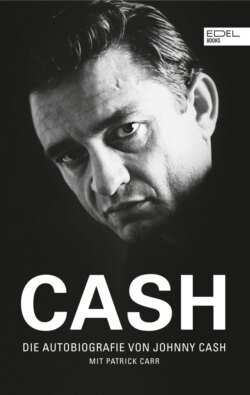Читать книгу CASH - Johnny Cash - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
THE MAN IN BLACK
ОглавлениеIch bin gerade in San Francisco – wir sind gestern Nacht aus Portland über die Bay Bridge gekommen – und bis jetzt hatte ich ziemlich viel zu tun. Heute Morgen wurde ich von einem BBC-Team in meiner Suite interviewt und fotografiert und das war ziemlich anstrengend. Ich finde es schon unangenehm, wenn ich länger als ein paar Minuten Fragen über mich beantworten soll, geschweige denn eine Stunde. Mittags ging ich dann mit einigen Leuten essen, die mit einem meiner Projekte zu tun haben – ein Arbeitsessen, könnte man sagen, oder eine »Lunchbesprechung« –, und das dauerte auch ziemlich lang und ermüdete mich. Ich schaute ständig aus dem Fenster und fragte mich, wie die Luft da draußen wohl riecht, wie sich der Wind anfühlt, wie schön es wäre, wenn ich einfach nur die Straße entlanglaufen könnte. Lohnsklaven werden, fern von ihren Lieben, in Büros, Fabriken und Werkstätten eingesperrt. Sklaven des Ruhmes wie ich werden, fernab von Fremden, in Hotels, Studios und Limousinen eingesperrt.
Jetzt ist gerade die Zeit für mein Nickerchen. Ich arbeite heute Abend, und wenn ich nicht ausgeruht bin, geht das sicher in die Hose. Ich würde mich mies fühlen, schlecht singen und die Leute bekämen nichts für ihr Geld. Billy Graham hat mich darauf gebracht: Wenn du eine Abendvorstellung hast, sagte er, dann leg dich nachmittags etwas hin und ruh dich aus, auch wenn du nicht richtig schläfst. Das war der wertvollste Rat seit Jahren, vielleicht der wertvollste überhaupt.
Der Auftritt heute Abend findet in Santa Cruz statt, einer Universitätsstadt etwa zwei Stunden von hier hinter den Bergen südlich von San Francisco, und ich rechne mit einem völlig anderen Publikum als in Portland. Das war so ziemlich das »durchschnittlichste« Publikum, das ich mir vorstellen kann: vorwiegend Berufstätige mittleren Alters. Heute Abend ist da wahrscheinlich kaum einer über vierzig, der keinen Doktortitel hat, und es würde mich nicht sehr wundern, wenn es dort etwas Randale gibt. Wenn es morgen nicht dazu käme, wäre das geradezu ein Schock. Wir spielen nämlich im Fillmore und das wird sicher wild: Rock ‘n’ Roll pur. Wir müssen bis dahin unbedingt Rusty Cage auf die Reihe kriegen; uns erwartet ein dementsprechendes Publikum. Das wird eine aufregende Sache.
Ich denke über mein BBC-Erlebnis nach. Der Interviewer war gut, offensichtlich ein alter Hase, aber trotzdem waren es nahezu die gleichen Fragen wie in all den anderen Interviews, die ich in der letzten Zeit gegeben habe. Sie wollten alle etwas über meine aktuelle Arbeit hören – was insofern verständlich ist, als sie ihre Informationen alle aus der gleichen Pressemappe haben – und früher oder später landen die meisten dann bei den gleichen paar Fragen, die mir schon seit vierzig Jahren gestellt werden.
Es gibt drei davon.
Frage eins: Weshalb saß ich im Gefängnis?
Ich saß nie im Gefängnis. Das Gerücht kam auf, weil ich Folsom Prison Blues schrieb und sang, meinen Hit von 1955 aus der Sicht eines verurteilten, reuelosen Mörders. Und zwölf Jahre später nahm ich ein Konzertalbum namens Johnny Cash At Folsom Prison auf. In Wahrheit verbüßte ich zu keiner Zeit und an keinem Ort jemals eine Strafe in irgendeiner Strafanstalt. In meinen Amphetaminjahren verbrachte ich ein paar Nächte im Gefängnis, aber ich kam immer am nächsten Morgen schon wieder raus: Insgesamt waren es sieben Vorfälle, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, wo man sich nach dem jeweiligen Recht dafür entschied, mich hinter Schloss und Riegel zu bringen, weil es für alle das Beste sei. Das waren keine besonders lehrreichen Erfahrungen, allerdings weiß ich noch, wie ich in Starkville, Mississippi, lernte, dass es keine gute Idee ist, zu versuchen, die Gitterstäbe einer Gefängniszelle mit den Füßen aufzutreten. In der Nacht brach ich mir einen Zeh.
Es gibt Leute, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass in meiner Version keine Verbrechen vorkommen. Gelegentlich habe ich mich schon mit Leuten darüber gestritten, weil sie felsenfest davon überzeugt waren, dass ich früher ein gewalttätiges Verbrecherleben geführt hätte, egal, was ich sagte. Das Einzige, was ich diesen Leuten anbieten kann, ist eine Entschuldigung: Es tut mir leid, aber diese Zeile in Folsom Prison Blues, bei der immer noch die stärkste Resonanz aus dem Publikum kommt, vor allem von den Zuschauern, die eher aus der alternativen Szene kommen – »I shot a man in Reno just to watch him die« [Ich erschoss einen Mann in Reno, nur um ihn sterben zu sehen] –, ist frei erfunden, nicht autobiografisch. Ich saß mit einem Bleistift in der Hand da und versuchte, mir den schlimmsten Grund auszudenken, den ein Mensch haben kann, einen anderen zu töten, und das kam dabei heraus. Ich bin allerdings ziemlich schnell darauf gekommen.
Frage zwei ist da schon schwieriger: Wie schreibe ich meine Songs?
Es gibt keine Formel, kein Patentrezept. Es geschieht auf alle möglichen Arten und deshalb fällt die Antwort von Song zu Song unterschiedlich aus. I Walk the Line schrieb ich zum Beispiel, als ich 1956 durch Texas tourte und es mir schwerfiel, der Versuchung zu widerstehen, meiner Frau zu Hause in Memphis untreu zu sein. Ich verarbeitete diese Gefühle in den Anfangszeilen eines Songs und sang Carl Perkins vor einem Auftritt die ersten zwei Strophen hinter der Bühne vor.
I keep a close watch on this heart of mine.
I keep my eyes wide open all the time.
I keep the ends out for the tie that binds.
Because you're mine, I walk the line.
I find it very easy to be true.
I find myself alone when each day's through.
Yes I'll admit that I'm a fool for you.
Because you're mine, I walk the line.
Ich wache sehr über mein Herz.
Meinen Augen entgeht nichts.
Doch ich lasse mich auf nichts ein, denn ich bin bereits vergeben.
Du gehörst zu mir,
Und deshalb halte ich mich an die Regeln.
Es fällt mir sehr leicht, treu zu sein.
Am Ende eines Tages hin ich immer allein.
Ja, ich gebe zu, dass ich verrückt nach dir bin.
Du gehörst zu mir,
Und deshalb halte ich mich an die Regeln.
»Was hältst du davon?«, fragte ich. »Ich nenne es Because You're Mine.«
»Hmm«, sagte Carl. »Ich glaube, I Walk the Line wäre besser als Titel.« Dann ging er auf die Bühne und ich schrieb den Song zu Ende, während er seinen Auftritt hatte. Das ging mir schnell und einfach von der Hand, fast ohne nachzudenken.
Woher die Gefühle in dem Song stammen, ist klar. Woher das Tempo und die Melodie kommen, ist nicht so leicht zu erkennen: von einem Spulen-Tonbandgerät in einer Kaserne der US Air Force im Jahr 1951 in Landsberg in Deutschland.
Ein Tonbandgerät war damals eine absolute Neuheit, Hightech vom Feinsten. Ich hatte das einzige auf dem gesamten Stützpunkt, gekauft beim PX von Ersparnissen aus den monatlich fünfundachtzig Dollar, die mir Vater Staat für meinen Einsatz im Kalten Krieg bezahlte. Es war schon ein faszinierendes Teil und stand im Mittelpunkt des kreativen Lebens der Landsberg Barbarians: ich, zwei andere Flieger mit Gitarren und einer aus West Virginia mit einer Mandoline, die er sich von zu Hause hatte schicken lassen. Wir saßen immer in der Kaserne zusammen und verschandelten die neuesten Countrysongs oder die Gospelsongs aus unserer Jugend – wir kamen alle vom Land, deshalb kannte sie jeder – und mit diesem Tonbandgerät konnten wir uns das Ergebnis sofort anhören. Einfach unglaublich. Ich habe heute noch ein paar dieser Tonbänder, inzwischen auf Kassette überspielt. Wir waren ziemlich primitiv, aber wir hatten unseren Spaß.
Eines dieser Barbarian-Bänder brachte mich auf die Melodie von I Walk the Line. Ich hatte Nachtschicht von elf bis sieben und hörte im Funkraum die Russen ab. Als ich morgens in die Kaserne zurückkehrte, entdeckte ich, dass sich irgendjemand an meinem Tonbandgerät zu schaffen gemacht hatte. Zum Test legte ich ein Tonband von den Barbarians ein und bekam einen höchst merkwürdigen Sound zu hören, ein eindringliches Geleier, voll von seltsamen Akkordwechseln. Es kam mir vor wie eine Art gespenstische Kirchenmusik und am Ende war da etwas, was so klang, als würde einer »Vater« sagen. Ich ließ es tausendmal laufen, weil ich nicht schlau daraus wurde, und fragte sogar ein paar Katholiken in meiner Einheit, ob sie es von irgendeinem Gottesdienst her kannten (sie kannten es nicht). Schließlich kam ich der Sache doch noch auf den Grund: Irgendwie hatte sich das Band verdreht, sodass ich die Gitarrenakkorde der Barbarians rückwärts hörte. Das Geleier und diese merkwürdigen Akkordwechsel blieben mir im Gedächtnis und tauchten in der Melodie von I Walk the Line wieder auf.
© Author's Collection
In Deutschland für die US-Luftwaffe, 1952
Bei der Luftwaffe habe ich Dinge gelernt, die jedem Soldaten beim Militärdienst beigebracht werden: zu fluchen, nach Frauen Ausschau zu halten, zu trinken und mich zu prügeln. Darüber hinaus habe ich eine ziemlich ungewöhnliche Fähigkeit erworben: Sollte jemand einmal herausfinden wollen, was ein Russe einem anderen per Morsezeichen mitteilt, dann bin ich genau der richtige Mann.
Auf diesem Gebiet war ich hervorragend. Mein linkes Ohr war so gut, dass ich in Landsberg, von wo aus der Sicherheitsdienst der US Air Force weltweit den Funkverkehr überwachte, als absolutes Ass galt. Ich wurde immer geholt, wenn es besonders schwierig wurde. Ich schnitt die ersten Meldungen von Stalins Tod mit. Ich ortete das Signal des ersten sowjetischen Düsenbombers auf seinem Jungfernflug von Moskau nach Smolensk. Wir alle wussten, worauf wir achten mussten, aber ich war derjenige, der es hörte. Ich konnte erst gar nicht glauben, was der russische Funker da machte. Er sendete fünfunddreißig Wörter pro Minute von Hand, so schnell, dass ich dachte, es wäre eine Maschine, bis ich hörte, wie er sich verhaspelte.
© Author's Collection
Bei der Arbeit im Studio
Der war wirklich außergewöhnlich, aber auch die meisten seiner Genossen waren schnell genug, um die besten Amerikaner wie armselige, langsame Amateure wirken zu lassen. Das spielte jedoch keine Rolle. Unsere Ausrüstung war so gut, dass sie nirgends in der Welt einen Ton von sich geben konnten, ohne dass wir es hörten. Mit unserem Empfänger bekamen wir sogar WSM herein. Manchmal saß ich sonntags morgens in Deutschland und hörte »Saturday Night at the Grand Ole Opry«, live aus Nashville, Tennessee, genau wie zu Hause.
Ich hörte den Feind bei der Luftwaffe jeden Tag, aber ich kam nie auch nur in die Nähe eines Einsatzes. Ich hatte mich eine Woche vor Ausbruch des Koreakriegs gemeldet, darum steckte ich bereits in der ganzen Maschinerie drin, und nachdem sie meine Eignung festgestellt, mich ausgebildet und dem Sicherheitsdienst zugeteilt hatten, kam Korea nicht mehr infrage. Ich hatte nur noch die Wahl zwischen Deutschland und der Insel Adak, die zur Inselgruppe der Aleuten vor Alaska gehört. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer: ewiges Eis oder gutes Essen und »Fräuleins«? Ich entschied mich für Landsberg.
Ich war, wie die meisten Landjungs aus den Südstaaten, beim Militär gelandet, weil es keine bessere Möglichkeit gab, aus den Baumwollfeldern herauszukommen. Ich hatte bereits den anderen üblichen Weg ausprobiert, nämlich nach Norden zu gehen, um eine Arbeit in der Fabrik zu bekommen. In meinem Fall hieß das, nach Pontiac in Michigan zu trampen und mich bei der Fisher Body Company ans Band zu stellen, wo ich eine Presse bediente, die Löcher in die Deckenbespannung von 51er-Pontiacs stanzte – aber das war nichts für mich. Die Arbeit war entsetzlich und die Unterbringung keinen Deut besser: eine Pension voller Männer, die tranken und fluchten und sich schlimmer aufführten, als es mein zartes junges Gemüt vom Lande verkraften konnte. Nach drei Wochen hatte ich genug und trampte wieder nach Hause, mit mehr Geld in der Tasche, als ich je in meinem Leben gesehen hatte.
Zu Hause lief gar nichts. Unser Land war erschöpft und brachte kaum noch einen Ballen Baumwolle pro Hektar hervor. Die einzige Arbeit, die ich finden konnte – in einer Margarinefabrik, in der mein Vater als Hilfsarbeiter angefangen hatte –, war weit schlimmer, als Löcher in Pontiacs zu stanzen. Zuerst ließen sie mich Beton gießen, aber dafür war ich zu schmächtig, ein langes dürres Klappergestell, also setzten sie mich zur Tankreinigung ein. Ich musste für wenig Geld in einem unglaublichen Dreck und einer unvorstellbaren Hitze arbeiten. Danach fand ich die Aussicht auf eine staatliche Lohnüberweisung und eine saubere blaue Uniform ziemlich verlockend, ich verpflichtete mich für vier Jahre.
In letzter Zeit beobachte ich, wie mein Haar allmählich ergraut, mein Gang langsamer wird und meine Energiereserven jedes Jahr ein bisschen nachlassen und dann wundere ich mich manchmal schon, wie ich in der Blüte meines Lebens so viel Zeit für die US Air Force und den Kalten Krieg opfern konnte. Damals schien es jedoch genau das Richtige zu sein. Wir Jungs wollten unserem Land dienen.
Wie schon gesagt, habe ich beim Militärdienst gelernt, was alle dort lernen. Zum Beispiel habe ich einiges über Gewalt erfahren.
Bei der Luftwaffe habe ich meinen ersten Rassenaufstand erlebt. Ich war in einem neunstöckigen Gebäude in Bremerhaven, unser Übergangsquartier nach unserer Reise von den Staaten über den Atlantik, als ich plötzlich wütendes Geschrei hörte. Ich schaute nach unten und dort sah ich sie, Weiße und Schwarze, Waffenbrüder – die Rassentrennung beim amerikanischen Militär war gerade aufgehoben worden –, die aufeinander losgingen, mit allem, was sie hatten. Mehrere Männer wurden gnadenlos zusammengeschlagen oder mit Messern verletzt und es ist ein Wunder, dass keiner dabei ums Leben kam. Viele von ihnen landeten im Krankenhaus oder im Militärgefängnis.
Ich hatte diese Schlägerei kommen sehen, denn schon an Bord war es zu starken Spannungen gekommen und seit wir in Bremerhaven gelandet waren, hatte es viel böses Blut gegeben – typisches Männergehabe, bei dem die Männer sich selbst und andere zum Kampf anstachelten –, aber ich wollte nichts damit zu tun haben und ich konnte wirklich nicht verstehen, warum sich so viele daran beteiligten. Für mich war es kein Problem, mit Schwarzen in einer Kaserne zu leben, und ich konnte mir nicht vorstellen, sie jemals so zu hassen, dass ich einen Privatkrieg gegen sie führen würde.
Eine Sache noch zu der Schlägerei. Dort in Bremerhaven waren viele Männer zusammen, Schwarze und Weiße, die man ständig dazu ermutigt hatte, Menschen zu töten (Nordkoreaner, Chinesen, Russen). Und jetzt wurden sie auf engstem Raum zusammengepfercht, mit der Anweisung, sich während der langen, anstrengenden und langweiligen Reise und der anschließend auferlegten Untätigkeit an Land wie Gentlemen zu benehmen. Sie waren wie Dampfkessel, die kurz vorm Explodieren standen.
Was meine persönliche Gewaltlosigkeit betrifft, so hielt sie in Landsberg nicht lange an. Nachdem ich einmal gelernt hatte, Bier zu trinken und nach Mädchen Ausschau zu halten, hatte ich auch schnell raus, wie man die harten Sachen trinkt und Streit sucht. Streit zu finden war nicht schwer. Die US-Armee hatte keinen Stützpunkt in der Nähe und somit hatten wir keine Gelegenheit, unsere natürlichen Feinde zu bekämpfen, aber die Deutschen stellten sich bereitwillig zur Verfügung. Irgendeiner bot sich immer an. Es war nichts weiter als eine nette Abendunterhaltung für zornige junge Männer und heißblütige Wächter der Demokratie.
Die Luftwaffe erweiterte meinen Horizont auch in anderer Beziehung. Ich war in London und sah die Queen (genauer gesagt, ihre Krönung im Jahr 1953). Ich war in Oberammergau, wo die berühmten Passionsspiele stattfinden, und ging angeln (Bayern ist die beste Gegend der Welt zum Forellenangeln). Ich ging nach Paris und schaute mir die Mädchen im Folies Bergère an. Ich war in Barcelona und schaute mir überall die Mädchen an. Ich war in Kellern, in denen Flamencogitarre gespielt wurde. Ich kaufte mir meine erste Gitarre für zwanzig D-Mark, damals etwa fünf Dollar, und trug sie durch den kalten deutschen Winter zum Stützpunkt zurück. Diesen Fußmarsch werde ich nie vergessen, sechseinhalb Kilometer durch knietiefen Schnee. Ich war total steif gefroren.
Bis dahin hatte ich mich mit Singen begnügen müssen, und natürlich sang ich ständig, sowohl alleine als auch mit den anderen Jungs. In gewisser Weise war es genau wie damals in Arkansas, nur waren die Umgebung und der Inhalt der Lieder meist etwas anders. Während der Grundausbildung auf dem Luftwaffenstützpunkt Lackland in San Antonio habe ich es am Anfang wirklich vermisst, mit all den anderen zusammen in der Kirche zu singen, aber unser Gesang beim Marschieren war auch ganz lustig. Ich kann mich noch an das erste Lied erinnern, das wir auf diese Art gesungen haben, eine Gemeinschaftsarbeit, die mein gesamtes Geschwader von siebenundfünfzig Mann zusammen geschrieben und während des Marsches gesungen hat:
Oh, there's a brownnose in this flight.
And his name is Chester White.
He's got a brown spot on his nose.
And it grows and grows and grows.
Oh, wir haben einen Arschkriecher im Geschwader.
Und sein Name ist Chester White.
Er hat einen braunen Fleck auf der Nase.
Und der wächst und wächst und wächst.
Meine Gitarre hatte ich übrigens bis 1957, als mein Bruder Tommy und einer meiner Neffen in meinem Haus in Memphis herumtobten und sie aus Versehen zertrümmerten. Sie verschwiegen mir den Vorfall, bis ich eines Tages durch Zufall merkte, dass sie fehlte. Es machte mir nicht viel aus. Bis dahin hatte ich schon eine Martin.
Bei der Luftwaffe schätzte man vor allem meine nicht musikalischen Talente und versuchte mich zu halten, indem man mich kurz vor Ablauf meiner Dienstzeit beförderte. »Wir haben Sie etwas vorzeitig zum Stabsfeldwebel ernannt, Feldwebel Cash, und wir bitten Sie, sich ernsthaft zu überlegen, ob Sie sich nicht weiterverpflichten und für eine Karriere bei der Armee entscheiden wollen« –, aber es kam viel zu schwach und viel zu spät. Sie hatten mich drei Jahre lang in Deutschland behalten, hatten mir keinen einzigen Heimflug und nur drei Telefongespräche nach Hause in die Staaten genehmigt und obendrein sagten sie mir noch, dass ich den Sicherheitsdienst nie verlassen würde, wenn ich bei der Air Force bliebe.
»Was ist, wenn ich in die Band der Air Force eintreten möchte?«, fragte ich.
»Unmöglich«, sagten sie. »Sie haben einen Geheimhaltungseid geleistet. Sie können nirgendwo hin. Sie sind immer noch dabei, selbst wenn Sie entlassen sind.« Einen schrecklichen Moment lang dachte ich, sie würden versuchen, mich lebenslang an sich zu binden, aber das taten sie nicht. Sie ließen mich gehen.
Es war gut, dass sie mich gehen ließen. Das Bier und die Wurst schmeckten hervorragend, aber ich sehnte mich danach, wieder im Süden zu sein – »where the livin’ was easy, where the fish were jumpin’, where the cotton grew high«.
Frage drei ist einfach: Warum trage ich immer Schwarz?
Genau genommen trage ich nicht immer Schwarz. Wenn ich nicht im Licht der Öffentlichkeit stehe, trage ich, was ich will. Doch auf der Bühne trage ich aus einer Reihe von Gründen immer noch Schwarz.
Erstens gibt es da den Song Man in Black, den ich 1971 geschrieben habe. Ich hatte damals eine eigene, landesweit ausgestrahlte Fernsehshow und mir wurde von so vielen Reportern die Frage Nummer drei gestellt, dass ich die Gelegenheit wahrnahm, mit einer Botschaft zu antworten. Ich trage Schwarz, sang ich, »for the poor and beaten down, livin’ in the hopeless, hungry side of town« [für die Armen und Unterdrückten, die im trostlosen, hungrigen Teil der Stadt leben]. Ich trage es »for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times« [für den Gefangenen, der für sein Verbrechen längst gebüßt hat, der nur noch dort sitzt, weil er ein Opfer seiner Zeit ist]. Ich trage es für »the sick and lonely old« [die kranken und einsamen Alten], und »the reckless whose bad trip left them cold« [die Leichtsinnigen, die ein Fehltritt zu Fall brachte]. Und mit dem Vietnamkrieg vor Augen, der mich genauso schmerzlich berührte wie die meisten anderen Amerikaner, trage ich es »in mournin’ for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men. I wear it for the thousands who have died, believin’ that the Lord was on their side« [in Trauer um die Leben, die hätten gelebt werden können, um die hundert prächtigen jungen Männer, die wir jede Woche verlieren. Ich trage es für die Tausende, die in dem Glauben gestorben sind, Gott stünde ihnen bei]. Der letzte Vers brachte es auf den Punkt:
Well, there's things that never will be right, I know,
And things need changin' everywhere you go,
But until we start to make a move to make a few things right,
You'll never see me wear a suit of white.
Oh, I'd love to wear a rainbow everyday,
And tell the world that everything's okay,
But I'll try to carry off a little darkness on my back,
Till things are brighter, I'm the Man in Black.
Es gibt Dinge, die nie in Ordnung sein werden, das weiß ich,
Und wo man auch hinschaut, muss sich etwas ändern,
Aber bevor wir nicht anfangen, ein paar Dinge in Ordnung zu bringen,
Werdet ihr mich nie einen weißen Anzug tragen sehen.
Ach, ich würde so gern jeden Tag in den Farben des Regenbogens gehen,
Und der ganzen Welt sagen, dass alles in Ordnung ist,
Aber ich versuche, auf meinem Rücken ein bisschen Dunkelheit davonzutragen,
Bis es etwas heller um uns wird, bleibe ich der Mann in Schwarz.
Abgesehen davon, dass der Vietnamkrieg vorbei ist, sehe ich heute kaum einen Grund, meine Einstellung zu ändern. Die Alten werden immer noch übergangen, die Armen sind immer noch arm, die Jungen sterben immer noch zu früh und wir tun nicht viel dafür, die Dinge zu verbessern. Es ist immer noch viel Dunkelheit davonzutragen.
Es gibt für mich noch andere Gründe, Schwarz zu tragen. Sie hängen mit meinem allerersten öffentlichen Auftritt zusammen, damals in einer Kirche im Norden von Memphis, noch bevor ich irgendwelche Platten aufgenommen oder das Gebäude von Sun Records auch nur betreten hatte. Ich hatte mich allerdings schon mit Marshall Grant und Luther Perkins zusammengetan, sodass wir zumindest theoretisch eine Band waren. Und wir fanden, dass wir auch wie eine Band aussehen sollten. Dummerweise hatte keiner von uns irgendwelche Klamotten, wie sie eine »richtige« Band tragen würde – ich besaß keinen Anzug, nicht einmal eine Krawatte –, aber jeder von uns hatte ein schwarzes Hemd und eine Bluejeans. Also wurde das zum Outfit unserer Band und da die Leute in der Kirche uns zu mögen schienen und Musiker zutiefst abergläubisch sind – wenn sie etwas anderes behaupten, dann lügen sie –, schlug ich vor, bei dem Schwarz zu bleiben.
Marshall und Luther blieben eine Zeit lang dabei, bei mir war es für immer. Meine Mutter konnte es allerdings nicht ausstehen. Nach meinen ersten Plattenerfolgen gab ich schließlich nach und begann, die knalligen Klamotten zu tragen, die sie für mich nähte – ich erinnere mich an einen besonders festlichen weißen Anzug, der mit glitzerndem Blau besetzt war –, aber darin fühlte ich mich ganz und gar nicht wohl und so ging ich wieder zum Schwarz über. Und von allem anderen mal abgesehen, war der eigentliche Grund letzten Endes der, dass ich mich einfach darin wohlfühlte. Ich trug Schwarz, weil es mir gefiel.
Courtesy of Grand Old Opry (Johnny with Ernest Tubb, 1956)
Mit Ernest Tubb, 1956. Den Anzug mit dem weißen Jackett trug ich einzig und allein meiner Mutter zuliebe.
Ich trage immer noch Schwarz und es hat immer noch eine Bedeutung für mich. Es ist nach wie vor mein Zeichen der Rebellion – gegen den Stillstand, gegen unsere scheinheiligen Gotteshäuser, gegen Menschen, die sich anderen Ideen gegenüber verschließen.