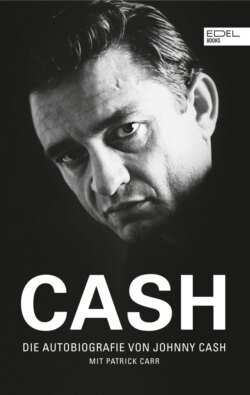Читать книгу CASH - Johnny Cash - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AUF DEN BAUMWOLLFELDERN
ОглавлениеIch fühle mich meiner Kindheit innerlich noch sehr nahe, aber wenn ich mich so umschaue, kommt es mir manchmal vor, als ob sie einer längst vergangenen Welt angehört. Kann man sich in den USA der späten Neunzigerjahre überhaupt noch vorstellen, wie ganze Familien, Mädchen und Jungen von acht bis achtzehn an der Seite ihrer Eltern, auf den Baumwollfeldern arbeiten und in der Julihitze, vom Morgengrauen bis zur Dämmerung, ihre Müdigkeit durch das Singen von Spirituals vertreiben? Gibt es überhaupt noch Orte, wo ein Junge nach dem Frühstück das Haus verlassen und mit nichts als einer Angelrute unterm Arm den ganzen Tag herumstreunen und die Gegend erkunden kann, alleine, unbeaufsichtigt und frei von Angst und ohne dass man sich Sorgen um ihn machen müsste?
Vielleicht gibt es das noch. Ich hoffe es. Aber ich vermute eher das Gegenteil. Ich glaube, selbst wenn es solche Orte gibt, haben unsere Fernseher uns dafür blind gemacht.
Neulich habe ich mich mit einem Freund darüber unterhalten, dass das Landleben, wie ich es noch kannte, vielleicht wirklich der Vergangenheit angehört. Und wenn Leute, die etwas mit Musik zu tun haben, Künstler wie Fans, von »Country« reden, heißt das nicht, dass sie das Land und das Leben, das davon abhängt und geprägt wird, kennen oder sich auch nur dafür interessieren. Sie reden vielmehr von einer Vorliebe – einem bestimmten Aussehen, einer Gruppe, der man angehört, einer Musikrichtung, die man als die eigene bezeichnen kann. Aber das geht an der entscheidenden Frage vorbei: Steckt hinter den Symbolen des modernen »Country« überhaupt noch etwas oder sind die Symbole selbst schon die ganze Story? Sind die Hüte, die Stiefel, die Pick-up-Trucks und Honky-Tonk-Posen die letzten Überreste einer sich auflösenden Kultur? Damals in Arkansas brachte ein Lebensstil eine bestimmte Art von Musik hervor. Bringt heute eine bestimmte Art von Musik einen bestimmten Lebensstil hervor? Vielleicht ist das auch in Ordnung. Ich weiß es nicht.
Vielleicht bin ich auch nur etwas befremdet, weil ich mich ausgeschlossen fühle. Auf jeden Fall hat das Establishment der Countrymusik, einschließlich des Countryradios und des Countrymusikverbands, offenbar beschlossen, dass, was immer »Country« auch sein mag, einige von uns jedenfalls nicht dazugehören.
Ich frage mich, wie viele dieser Leute jemals einen Sack Baumwolle gepflückt haben. Ich frage mich, ob die wissen, dass mich ihre Vorgänger, bevor ich in den Neunzigern zum »Non Country«-Künstler erklärt wurde, bereits in den Fünfzigern als »non country« bezeichnet haben, genau wie in den Sechzigern und Siebzigern (in den Achtzigern war ich sozusagen unsichtbar).
Aber das macht mir wenig aus. Es ist nichts im Vergleich zu meiner Freude darüber, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues kreatives Leben zu beginnen – ich dachte, es würde sich vielleicht schon dem Ende zuneigen –, oder im Vergleich zu der freudigen Erregung, die mich erfasst, wenn ich vor einem gespannten jungen Publikum spiele. Manchmal fühle ich mich genau wie damals, 1956 auf Tour, in den ersten Tagen des Rock ‘n’ Roll mit Carl, Roy, Jerry Lee, Elvis und all den anderen Rebellen aus Memphis.
Aber vor dem Rock ‘n’ Roll gab es natürlich Country und vor Memphis gab es – für mich jedenfalls – Arkansas.
Soweit ich mich erinnern kann, war der erste Song, den ich gesungen habe, I Am Bound for the Promised Land. Ich saß hinten auf einem Tieflader auf dem Weg nach Dyess, Arkansas. Hinter mir lag das erste Haus, an das ich mich erinnern kann: Das Haus an der Bahnlinie draußen im Wald bei Kingsland in Arkansas, wo meine Familie nach einer Reihe von Umzügen gelandet war, die durch die schlechten Verhältnisse zur Zeit der Depression diktiert wurden. Es war eine wirklich armselige Behausung, drei Zimmer hintereinander, das klassische shotgun house. Es bebte jedes Mal wie der Teufel, wenn ein Zug vorbeifuhr. Es war allerdings nicht so schlimm wie das Haus, in dem ich geboren wurde. Ich kann mich zwar nicht an die Zeit erinnern, als ich dort lebte, aber ich habe es einmal gesehen, als ich meinen Großvater besuchte. Es war eine Art letzte Zuflucht. Die Fenster hatten keine richtigen Scheiben und im Winter hängte meine Mutter Decken oder irgendetwas anderes davor. Aus dem wenigen, was wir hatten, holten meine Eltern ganz schön viel heraus.
Das neue Haus, zu dem uns der Tieflader brachte, war da etwas ganz anderes. Es war das Ergebnis einer brandneuen Politik, des New Deal. Spät im Jahr 1934 hatte Daddy von einem neuen Programm erfahren, das von der Federal Emergency Relief Administration durchgeführt wurde. Mithilfe dieses Programmes sollten Farmer wie er, die durch die Depression in den Ruin gestürzt wurden, aufs Land umgesiedelt werden, das die Regierung gekauft hatte. Später einmal erklärte er das so: »Wir hörten, dass wir ohne jegliche Anzahlung 80 Hektar Land kaufen konnten, mit einem Haus und einer Scheune, und dass sie uns ein Maultier und eine Kuh und im ersten Jahr Lebensmittel stellen würden, bis wir die eigenen ersten Erträge hätten und es zurückzahlen könnten, und wir mussten tatsächlich nichts bezahlen, bis wir die Ernte eingeholt hatten.« Genau darum ging es bei diesem Deal, und noch um einiges mehr: An sechsundvierzig verschiedenen Orten in den ländlichen Gebieten der USA wurden solche »Kolonien« auf einer genossenschaftlichen Basis errichtet. In der Siedlung, in die wir zogen, hatten wir und alle anderen Familien einen Anteil am Gemischtwarenladen, an der Konservenfabrik, an der Baumwollentkörnungsmaschine und an anderen Einrichtungen; wir alle waren dafür verantwortlich und wir alle waren an einem eventuellen Profit beteiligt. Die Baumwolle, die wir erzeugten, wurde der Gemeinschaftsernte zugeführt, die sich in größerem Umfang zu besseren Preisen verkaufen ließ als einzelne kleine Erntemengen. Ich wuchs also, wie schon gesagt, in einer Art Sozialismus auf. Vielleicht wäre »Kommunalismus« ein besseres Wort.
Unsere neue Gemeinde wurde nach dem Administrator des FERA-Programms für Arkansas, W. R. Dyess, benannt. Insgesamt umfasste sie eine Fläche von ungefähr 6500 Hektar Deltaland in Mississippi County. Die Straßen waren angelegt wie die Speichen eines Wagenrades. Wir wohnten in Straße 3, Hausnummer 266, etwa vier Kilometer vom Zentrum entfernt.
Ich kann mich noch genau an die Fahrt zum Haus erinnern. Wir brauchten zwei Tage für die 400 Kilometer von Kingsland dorthin, zuerst auf Schotterstraßen und dann auf unbefestigten Straßen, die sich durch den starken, bitterkalten Regen in Schlammpisten verwandelten. Wir mussten am Straßenrand übernachten, in dem Lastwagen, den die Regierung uns zur Verfügung gestellt hatte. Wir Kinder schliefen hinten, nur durch eine Plane vom Regen getrennt, und hörten Mama zu, wie sie weinte und sang.
Manchmal weinte sie und manchmal sang sie und manchmal war es schwer zu sagen, was es nun gerade war. Wie meine Schwester Louise später mal sagte, war dies eine der Nächte, in denen das einfach nicht zu unterscheiden war. Es klang alles gleich.
Als wir schließlich in Dyess waren, kam der Lastwagen die unbefestigte Straße zu unserem Haus nicht hoch. Also musste Daddy mich die letzten hundert Meter auf seinem Rücken durch den dicken schwarzen Arkansasschlamm – wir nannten ihn Gumbo – tragen. Von dort aus sah ich also zum ersten Mal das Gelobte Land: ein nagelneues Haus mit zwei großen Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, einer Küche, einer vorderen Veranda und einer hinteren Veranda, einer Toilette auf dem Hof, einer Scheune, einem Hühnerstall und einer Räucherkammer. Für mich ein unermesslicher Luxus. Es gab natürlich kein fließendes Wasser und keinen Strom; von solchen Wunderdingen hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt.
Das Haus und die Nebengebäude waren schlicht und einfach, aber solide gebaut und identisch mit all den anderen Gebäuden der Kolonie. Alle waren nach demselben Plan von demselben dreißig Mann starken Bautrupp errichtet worden, der zur Fertigstellung eines Anwesens jeweils zwei Tage brauchte und dann zum nächsten überging. Ich kann mich noch lebhaft an den Anblick der leeren Farbeimer erinnern. Es waren fünf Stück. Sie standen mitten im Wohnzimmer auf dem Boden, die einzigen Gegenstände im ganzen Haus: grün für die Verzierungen, weiß für alles Übrige. Wir richteten uns in der ersten Nacht so gut wie möglich ein. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns damals warm hielten.
© Carrie Rivers Cash
Die hintere Veranda unseres Hauses in Dyess, Arkansas
Am nächsten Tag zog sich Daddy ein Paar hüfthohe Wasserstiefel an und ging hinaus, um sich ein Bild von unserem Land zu machen. Es war Dschungel – richtiger Dschungel. Pappeln und Ulmen, Eschen und Hickorybäume sowie Buscheichen und Zypressen. Die Bäume, Kletterpflanzen und Büsche bildeten an manchen Stellen ein solches Dickicht, dass es kein Durchkommen mehr gab. Ein Teil stand unter Wasser, ein Teil war reinster Schlamm – aber Daddy erkannte sofort, was man daraus machen konnte. »Wir haben gutes Land bekommen«, sagte er nur, als er zurückkam. Er war erfüllt von einer Hoffnung und Dankbarkeit, die wir alle spüren konnten. Das sagte alles.
Das Land war verdammt schwer zu roden, aber Daddy und mein ältester Bruder Roy, damals fast vierzehn, waren von frühmorgens bis spätabends bei der Arbeit, sechs Tage in der Woche. Sie begannen an der höchsten Stelle und arbeiteten sich Meter um Meter nach unten vor. Mit Sägen, Äxten und langen Macheten bahnten sie sich ihren Weg und dann sprengten und verbrannten sie die Baumstümpfe. Bis zur Pflanzungszeit im ersten Jahr hatten sie über einen Hektar fertig. Auf zwei Dritteln der Fläche wurde Baumwolle angepflanzt, die für den Verkauf bestimmt war. Von dem Erlös zahlte Daddy der Regierung das erste Geld zurück. Das restliche Drittel nutzten wir für den Anbau von Tierfutter und Nahrungsmitteln für unseren eigenen Bedarf: Getreide, Bohnen, Süßkartoffeln, Tomaten und Erdbeeren.
Die Ernte war gut in diesem ersten Jahr und die Cashs kamen ein gutes Stück voran. Im nächsten Frühling war ich fünf und bereit für die Baumwollfelder.
Musiker aus dem Süden, die meiner Generation angehören, schwarze und weiße Bluesmusiker, Hillbilly- und Rockabillysänger, hört man oft davon erzählen, wie sie damals Baumwolle pflückten (und alles dafür taten, aus den Baumwollfeldern herauszukommen), aber ich habe mich schon oft gefragt, ob die Leute, die uns zuhören und die meist jünger und/oder städtischer sind als wir, sich wirklich eine Vorstellung von dem Leben machen können, über das wir reden. Ich glaube, die meisten Leute wissen heute nicht einmal, was Baumwolle überhaupt ist, außer dass es sich um einen angenehmen Stoff handelt. Vielleicht würden sie es ja gerne wissen. Vielleicht auch meine Leser – und sei es nur aus Interesse an dem Hintergrund der Musik. Immerhin kommen enorm viele Grundmuster der Blues- und Countrymusik zweifellos aus den Baumwollfeldern: So manch ein richtungsweisender Song wurde im wahrsten Sinne des Wortes hier erschaffen und viele weitere wurden mündlich überliefert.
Wie war das also damals mit uns und der Baumwolle?
Wir pflanzten die Samen im April, und wenn wir hart genug arbeiteten und unsere Arbeit Früchte trug und der Mississippi, »the Big Muddy«, das Land nicht mit Schlamm überschwemmte und keine Heerscharen von Raupen drüber herfielen und wir von keiner anderen Naturkatastrophe heimgesucht wurden, dann öffneten sich im Oktober an den etwa 1,20 Meter großen Pflanzen die ersten Blüten. Bald danach begannen wir mit dem Pflücken, obwohl das Pflücken erst dann effektiv wurde, wenn die Pflanzen nach einem strengen Frost ihre Blätter verloren, sodass die Samenkapseln besser zu sehen waren. Gepflückt wurde bis in den Dezember, bis der Winterregen einsetzte und die Baumwolle langsam dunkel wurde und dadurch an Qualität und Wert verlor. Heute besprühen sie die Pflanzen mit Chemikalien, sodass die Blätter früher abfallen, und ernten dann mit Maschinen. Sie verschmutzen das Grundwasser und machen den Boden kaputt. Wir verwendeten auf unserem Boden nie irgendwelche Chemikalien – nicht dass ich etwas gegen Düngemittel hätte, wenn sie maßvoll eingesetzt werden –, wir konnten sie uns einfach nicht leisten.
Unsere Baumwolle gehörte zur Sorte »Delta Pine«, die nach ihren langen Fasern benannt wurde. Sie waren länger als bei den meisten anderen Baumwollsorten, die damals in den Vereinigten Staaten in größeren Mengen angepflanzt wurden. Wer immer ihr diesen Namen gegeben hat, muss dabei an Kiefernnadeln gedacht haben. Unser fruchtbarer, unberührter Deltaboden ließ sie wunderbar gedeihen und in den ersten paar Jahren, bevor der Boden ausgezehrt war, hatten wir hervorragende Erträge. Ich weiß noch, wie Daddy damit prahlte, dass er aus einem Hektar fünf Ballen herausholte, was in anderen Teilen des Landes unvorstellbar war: schulterhohe Pflanzen, dicht besetzt mit Samenkapseln, und reinste »Strict High Middlin’«-Baumwolle.
Ich glaube, das sollte ich erklären. »Strict High Middlin’«, wie auch der geläufige Ausdruck »Fair to Middlin’«, was so viel wie »mittelprächtig« heißt, war eine Güteklasse für Baumwolle. Wenn wir unsere Ernte zur Entkörnungsmaschine brachten, nahm dort jemand ein Messer und schnitt in die Ballen. Der Fachmann zog ein paar Fasern heraus und spielte einige Zeit damit herum. Dann traf er seine Entscheidung, schrieb die Güteklasse auf und hängte den Zettel an den Ballen. Am meisten interessierte ihn die Länge der Fasern, ihre Stärke und ihre Farbe. Und die Güteklassen, nach denen er einteilen musste, hießen, wenn ich mich recht erinnere, »Strict High Middlin’« [höchste Güteklasse], »High Middlin’«, »Fair to Middlin’«, »Middlin’«, »Low Middlin’« und »Strict Low Middlin’« [unterste Güteklassel. Diese Qualitätsbezeichnungen waren äußerst wichtig: Wenn man die Ballen auf den Markt brachte, bekam man für einen Ballen »Strict Low Middlin’« vielleicht 28 Cent pro Pfund, während man für »Strict High Middlin’« 35 Cent für ein Pfund bekam.
Nach den sensationellen Erträgen der ersten Jahre war Daddy schon zufrieden, wenn unser Land wenigstens noch »Fair to Middlin’« hervorbrachte, selbst wenn die Erträge immer weiter zurückgingen. Und als ich dann ein Teenager war, konnten wir froh sein, wenn wir zweieinhalb Ballen aus einem Hektar erzielen konnten; üblich waren eher eineinviertel oder eineinhalb Ballen Baumwolle je Hektar. Das ging schließlich so weit, dass wir aus einem Hektar nicht mal mehr zwei Ballen herausholen konnten. Damals begannen viele Farmer in Dyess, ihre Anteile zu verkaufen. Daddy aber machte weiter. Er ging zur Verwaltung und pachtete ein Stück Land von der Nachbarfarm. Das half zwar, aber das Land war nicht so gut wie unseres und deshalb brachte es nicht viel. Daddy machte jedoch das Beste daraus; er konnte sehr hart arbeiten und er war klug und achtete mit großer Sorgfalt auf einen regelmäßigen Fruchtwechsel und eine gute Bewässerung. Ich glaube, er experimentierte sogar mit anderen Baumwollsorten, aber er kam immer wieder auf »Delta Pine« zurück. Jedenfalls ist das die einzige Sorte, an die ich mich erinnern kann.
Wie ich schon sagte, konnten wir uns keine Düngemittel leisten; uns blieb also nur die Möglichkeit, mithilfe von Fruchtwechseln die Mineralien in den Boden zurückzuführen. Nach den ersten sieben Jahren oder so, als ich etwa zehn war, mussten wir damit anfangen, einzelne Baumwollfelder in Sojabohnen- oder Getreidefelder umzuwandeln. Schon davor hatten wir ein Stück Land vollständig opfern müssen, um darauf einen Alfalfa-Acker anzulegen, damit wir Winterfutter für unsere Kuh und unser Maultier hatten, die beide absolut lebensnotwendig für uns waren. Wo Alfalfa einmal angepflanzt wurde, braucht man gar nicht erst zu versuchen, etwas anderes anzupflanzen, da die Alfalfa-Pflanzen jedes Jahr wiederkommen und man sie nicht unterpflügen kann.
Ich begann auf den Feldern als Wasserjunge, was genau das ist, wonach es klingt: Man schleppt Trinkwasser zu den Erwachsenen und älteren Kindern. Mit acht Jahren schleifte ich dann aber auch einen Baumwollsack mit mir herum. Wir trugen nicht diese netten Körbe, die man in den Filmen immer sieht, sondern hatten schwere Säcke aus grobem Leinen mit geteerten Böden. Die der kleineren Kinder waren knapp zwei Meter lang, die der großen und der Erwachsenen knapp drei. Wir füllten diese Säcke fast bis zum Rand, dann schüttelten wir sie, drückten die Baumwolle fest nach unten und pflückten weiter. Bis man den vollen Sack dann zum Wagen schleppte, waren fast dreißig Pfund Baumwolle drin, beziehungsweise vierzig oder fünfzig Pfund, wenn man einen Drei-Meter-Sack hatte. Wenn ich zehn Stunden lang richtig hart ranging, konnte ich fast dreihundert Pfund pflücken; an den meisten Tagen waren es eher zweihundert.
Es war nicht kompliziert. Man stellte einfach nur den Wagen am Ende einer Reihe ab und lief dann darauf zu. Wenn man zu zweit war, nahm man sich beispielsweise drei Reihen auf einmal vor und teilte sich die mittlere. Daddy pflückte immer zwei Reihen auf einmal. Ich pflückte immer nur eine Reihe. So erweckte man den Anschein, als ob es schneller ginge – vor den anderen natürlich, aber, was noch wichtiger war, auch vor sich selbst. Glaubt mir, ich nutzte jede Gelegenheit, mich zu motivieren.
Die Arbeit war wirklich nicht zu empfehlen. Sie war anstrengend, der Rücken tat furchtbar weh und man schnitt sich die Hände auf. Das hasste ich am meisten. Die Samenkörner waren spitz und wenn man sich beim Zugreifen nicht richtig konzentrierte, verletzte man sich an ihnen. Nach ein, zwei Wochen waren die Finger mit kleinen roten Wunden übersät, einige davon ziemlich schmerzhaft. Meine Schwestern hielten das kaum aus. Natürlich gewöhnten sie sich daran – so wie alle –, aber man hörte sie oft jammern, besonders als sie noch sehr jung waren. So gut wie jedes Mädchen, das ich in Dyess kannte, hatte diese pockennarbigen Finger. Die Hände von Daddy sahen genauso schlimm aus wie die der anderen, aber er schien es nicht einmal zu bemerken.
Natürlich war das Pflanzen und das Pflücken nicht alles, was die Baumwolle uns abverlangte. Die eigentliche Arbeit erfolgte dazwischen. Wenn die Saat einmal ausgebracht war, musste das Unkraut bekämpft werden, und das war ein ordentliches Stück Arbeit: Die Kletterpflanzen, die beim Roden des Landes auf Bodenhöhe abgeschnitten wurden, schossen Ende März, Anfang April wieder in die Höhe und von da an wuchsen sie schneller, als wir sie zurückschneiden konnten. Wir standen da draußen und kämpften uns durch das mehr als drei Hektar große Feld, jeder mit einer Hacke bewaffnet und einer Feile, mit der sie praktisch stündlich geschärft wurde, und wenn wir das Ende der Reihe erreicht hatten, die wir gerade gejätet hatten, schauten wir zurück und sahen, wie schon wieder neue Triebe zwischen den Baumwollpflanzen wucherten. In der ersten Juliwoche waren die Baumwollpflanzen ungefähr dreißig Zentimeter hoch, das Unkraut aber schon fast fünfzig oder sechzig. Die wuchernden Gräser gehörten zu unseren schlimmsten Feinden und dann gab es diese Kletterpflanzen, die wir Kuhkrätze nannten, lange Schlingpflanzen, die sich um die Baumwollstängel legten und sie zu ersticken drohten.
Wir arbeiteten also weiter und weiter und weiter. Hin und wieder gab es eine Pause, wenn es zu stark regnete, um auf die Felder zu gehen, aber damit war nichts gewonnen: Das Unkraut wuchs auch ohne uns und nach einem guten Regen wuchs es sogar noch besser.
Der August mit seiner drückenden Hitze war unsere sogenannte Schonzeit, wenn es schien, als ob Gott eine kleine Pause einlegte und die Gräser, Kletterpflanzen und das Unkraut langsamer wachsen ließ. Zwei, drei Wochen lang arbeiteten wir nur drei Tage pro Woche auf den Baumwollfeldern. Das war allerdings genau die Zeit, um Kartoffeln zu ernten, Heu zu schneiden, es in die Scheune zu bringen und all diese Dinge eben. Es nahm also überhaupt kein Ende, die Arbeit ging immer weiter. Und dennoch, wir schafften es, das Unkraut zu jäten. Wir kamen mit der Baumwolle voran und das war das Wichtigste: Was auch immer passierte, mit der Baumwolle ging es weiter.
Es gab natürlich auch Kräfte, gegen die wir machtlos waren. Der Mississippi stand in dieser Hinsicht an erster Stelle – mein Song Five Feet High and Rising [Fünf Fuß hoch und steigend] beruht auf meiner eigenen Erfahrung und nicht auf irgendeinem Buch –, aber es gab auch noch andere Naturgewalten, die die Arbeit und den Ertrag eines ganzen Jahres zunichte machen konnten. Wir hatten zwar keine Baumwollkapselkäfer – in Texas war das ein größeres Problem –, aber einmal fielen Heerscharen von Raupen über unsere Felder her. Sie traten in riesigen Massen auf, es waren Millionen, und auf dem Land, das auf ihrem Weg lag, hinterließen sie eine ähnliche Spur der Verwüstung wie damals die Jungs von General Sherman in Georgia. Man erfuhr schon vorher, dass sie kamen, zuerst von meilenweit entfernt wohnenden Farmern, dann von denen aus der Nähe, bis die Raupen auf dem Nachbargrundstück waren, und dann waren sie plötzlich auf dem eigenen Land und machten sich über die gesamte Ernte her. Sie wanderten von einem Feld zum nächsten und fraßen – fraßen schnell–, um dann weiterzuwandern. Und man konnte nichts dagegen tun. Man konnte so viele von ihnen zerquetschen, wie man wollte, Tag und Nacht, wenn es einen glücklich machte, aber das machte nicht den geringsten Unterschied. Zuerst fraßen sie die Blätter von den Pflanzen und dann die Blüten und dann die Samenkapseln, und das wars dann.
Die Raupen waren der Fluch eines jeden Baumwollfarmers in Arkansas. Heute – wer hätte das je gedacht? – macht sich darüber kaum noch jemand Gedanken; man sprüht ein Bekämpfungsmittel und vergisst sie einfach.
Das soll nicht heißen, dass die Farmer heutzutage keine Sorgen mehr hätten. Die haben sie sicher noch und werden sie wohl auch immer haben. Aber ich bin mir sicher, dass sie auch noch einige der Freuden genießen, die mir mein junges Leben versüßten. Wenn sich zum Beispiel im Oktober die Baumwolle langsam öffnete, war das einfach herrlich. Zuerst waren es wunderschöne weiße Blüten und dann, nach etwa drei Tagen, wurden sie rosa, die ganzen Felder. Was für ein Anblick.
Und das war noch nicht alles. Unter diesen rosafarbenen Blüten erschienen winzig kleine, zarte Samenkapseln, ein süßer Leckerbissen. Ich pflückte sie immer und aß sie, solange sie noch so zart waren, bevor sie anfingen faserig zu werden, und ich liebte ihren Geschmack. Meine Mutter sagte ständig: »Iss keine Baumwolle. Davon bekommst du Bauchweh.« Aber ich kann mich an kein Bauchweh erinnern. Ich erinnere mich nur an ihren Geschmack. Wie süß sie war.