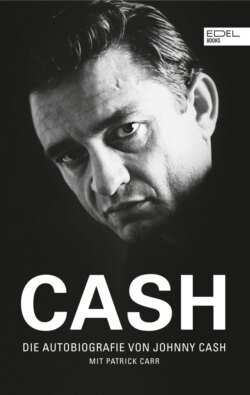Читать книгу CASH - Johnny Cash - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE GABE
ОглавлениеIch habe ein Zuhause, das mich überall hinbringt, wo ich hinmuss, das mich sanft wiegt und sehr behaglich ist, in dem ich in den Bergen einnicken und in der Ebene wieder aufwachen kann: Ich meine natürlich meinen Bus.
Ich liebe meinen Bus. Ich habe ihn schon sehr lange und er fährt jetzt besser als je zuvor, wahrscheinlich weil wir ihm im Laufe der Jahre so viel Gewicht aufgeladen haben. Er war immer äußerst zuverlässig. Abgesehen von einem neuen Motor sind in siebzehn Jahren keine größeren Reparaturen angefallen und er hat uns kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten und Kanada gebracht, ohne uns auch nur ein einziges Mal auf dem Highway stehen zu lassen. Wir nennen ihn »Unit One«.
Er ist wie ein zweites Zuhause für mich. Wenn ich mal wieder aus irgendeinem Flugzeug steige und mir den Weg durch irgendeinen Flughafen bahne, erfasst mich eine Woge der Erleichterung, wenn ich den großen, schwarzen MCI am Straßenrand auf mich warten sehe. Ah! – Sicherheit, Vertrautheit, Abgeschiedenheit. Auf jeden Fall Friede. Mein Kokon.
Ich habe in Unit One meinen eigenen, speziellen Bereich, etwa in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterachse, ein bequemer Platz zum Reisen. Ich sitze an einem Tisch mit Sitzbänken an beiden Seiten, wie in einem Speiseabteil, mit meiner Zeitung oder meinem Buch – June und ich haben beide einen enormen Bedarf an Lesematerial, alles von der Bibel bis hin zu Schundromanen –, und wenn ich schlafen möchte, verwandelt sich das Abteil in ein Bett. Es ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet: Badezimmer, Küche, Kühlschrank, Kaffeekanne, Stereoanlage, Video und Sitzgelegenheiten für Besuch. Durch die Vorhänge an den Fenstern kann ich mich von der Welt draußen abschotten oder beobachten, wie sie an mir vorbeizieht. Ein Navajo-Traumfänger und ein Kreuz der heiligen Brigitta beschützen mich im Schlaf.
Das Leben auf Tour ist so vorhersehbar, so vertraut. Ich bin jetzt schon seit vierzig Jahren unterwegs und wer wissen möchte, was sich in all dieser Zeit wirklich verändert hat, dem werde ich es gerne sagen. Damals, 1957, gab es noch kein »Extra Crispy«. Abgesehen davon ist alles beim Alten geblieben.
Das vermittelt vielleicht eine Vorstellung davon, was beim Leben auf Tour wirklich zählt und warum sich nie wirklich etwas daran ändern wird. Alles wird etwas schneller und größer und ein ganzes Stück bequemer (solange man Konzertkarten verkauft), aber es läuft immer wieder auf die gleichen Fragen raus: »Wo sind wir?« und »Wer hat die ganzen Äpfel gegessen?« und »Was fürn Auftritt ist heute dran?« und »Wie weit ist es his zum nächsten Joghurteis?«
Mich amüsiert der Gedanke an junge Musiker, die all das gerade entdecken, die gerade erst anfangen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die, mit etwas Glück, bis ins einundzwanzigste Jahrhundert hinein ihr Leben bestimmen wird. Ich selbst bin schon so lange auf Tour und kenne alles so gut, dass ich nur einen Blick aus dem Busfenster werfen muss, wenn ich irgendwo in den Vereinigten Staaten aufwache, um meinen Standort auf fünf Meilen genau bestimmen zu können. Irgendjemand sagte mal zu mir, das sei eine besondere Begabung, genau wie ich mich noch an einen Song erinnern kann, den ich vor langer Zeit vielleicht ein- oder zweimal gehört habe – das kann drei oder vier Jahrzehnte oder sogar fünf oder sechs zurückliegen –, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit Begabung zu tun hat. Ich glaube, dahinter steckt einfach sehr, sehr viel Erfahrung. Wie es im Song so schön heißt: Mann, ich war schon überall. Und das zweimal.
Ich bin gerade in Oregon und fahre in südwestlicher Richtung aus Portland hinaus, durch dichtes, dunkles Grün und zartgrauen Nebel, eingehüllt in meinen Kokon aus vertrauten Busgeräuschen. Wir steuern auf die offene Hügellandschaft und die weiten, sanften Täler Nordkaliforniens zu. Ich weiß natürlich genau, wo ich bin. Dieses Land erkennt man an seinen Bäumen.
Meine Gedanken schweifen ab. Sie bleiben an einem Problem hängen, das die Band und ich mit unserer Bühnenversion von Rusty Cage haben, dem Song von Soundgarden, den ich für das Album Unchained aufgenommen habe. Danach wenden sie sich wieder der Betrachtung meiner Lebensgeschichte zu. Ich denke über Pete Barnhill nach, einen Freund, den ich kennenlernte, als ich etwa dreizehn war. Pete lebte drei oder vier Kilometer von unserem Haus entfernt, unten bei dem Entwässerungsgraben in der Nähe der Stelle, wo ich an jenem Tag angeln war, als sich mein Bruder Jack verletzte. Er hatte eine Gitarre, eine alte Flattop-Gibson. Außerdem hatte er Kinderlähmung, später Polio genannt, durch die sein rechtes Bein verkrüppelt und der rechte Arm bis auf die Hälfte der normalen Größe verkümmert war. Er hatte gelernt, damit umzugehen. Im Covertext zu American Recordings schrieb ich über ihn:
Mit seiner linken Hand spielte er die Akkorde, während er mit der winzigen rechten Hand einen perfekten Rhythmus dazu schlug. Ich dachte, wenn ich so gut Gitarre spielen könnte wie er, würde ich irgendwann im Radio singen.
Jeden Nachmittag nach der Schule ging ich zu Pete nach Hause und blieb dort bis lange nach Einbruch der Dunkelheit. Wir sangen zusammen oder ich sang zu den Songs von Hank Snow, Ernest Tubb und Jimmie Rodgers, die er spielte. Pete brachte mir meine ersten Akkorde auf der Gitarre bei. Aber da ich zu kleine Hände hatte, konnte ich sie nie richtig spielen.
Der lange Heimweg durch die Nacht war unheimlich. Auf dem Schotterweg war es entweder stockdunkel oder der Mond schien, und dann wirkten die Schatten noch bedrohlicher. Die Wildkatzen klangen noch näher und ich hatte das sichere Gefühl, dass auf jedem dunklen Fleck auf der Straße eine Mokassinschlange lag, die nur darauf wartete, mich zu töten.
Aber ich sang den ganzen Heimweg über – Songs, die Pete und ich gesungen hatten. Ich stellte mir den Klang der Gibson vor und sang mich durch die Dunkelheit. Ich beschloss, dass diese Art von Musik von nun an mein Zaubermittel sei, das mich durch alle dunklen Orte der Welt bringen würde.
Pete inspirierte mich auf vielerlei Art. Als ich klein war, kannte ich, abgesehen von meiner Mutter, niemanden, der Gitarre spielen konnte, und ich hielt ihn für den besten Gitarrenspieler der Welt. Ich fand ihn wunderbar, und die Töne, die er erzeugte, geradezu himmlisch.
Eines Tages sagte ich zu ihm: »Weißt du was, Pete, du hast zwar Kinderlähmung, aber kannst verdammt gut Gitarre spielen.«
Seine Antwort hat mich damals tief beeindruckt: »Manchmal, wenn man eine Gabe verliert, bekommt man eine andere dafür.«
Von dem Moment an war er für mich kein Krüppel mehr. Er war für mich einer, der eine Gabe besaß. Es tat mir weh, wenn sich die anderen Kinder über ihn lustig machten. Wenn sie ihn sahen, wie er die drei oder vier Kilometer von zu Hause in die Stadt humpelte, ahmten sie ihn immer nach. Ich ahmte ihn natürlich auch nach, aber in anderer Hinsicht: Von ihm habe ich meinen Gitarrenstil, mit dem Daumen die Melodie zum Rhythmus zu spielen.
Pete war genauso musikbegeistert wie ich – er war der Erste, den ich kannte, dem es genauso ging wie mir – und wir waren beide ganz wild aufs Radio. Es bedeutete für uns die ganze Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, dass wir keinen Fernseher hatten, aber wir hatten auch keinen Plattenspieler oder sonst irgendetwas, mit dem wir neue, unbekannte Musik hören konnten. Das Radio war für uns unentbehrlich, ja geradezu lebensnotwendig.
Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als wir unseres bekamen, ein Sears Roebuck aus dem Versandhandel mit einer großen »B«-Batterie. Wir kauften es mit dem Geld von Daddys Staatsdarlehen in dem Jahr, als er und Roy anfingen unser Land zu roden. Ich kann mich noch an den ersten Song erinnern, den ich in diesem Radio gehört habe, Hobo Bill's Last Ride von Jimmie Rodgers, und wie real, wie vertraut mir das Bild des Mannes erschien, der einsam und allein in einem kalten Güterwaggon starb. Ich hörte die Sender WLW aus New Orleans, WCKY aus Cincinnati, XEG aus Fort Worth und XERL aus Del Rio in Texas. Ich erinnere mich an die Sendung »Suppertime Frolics« um sechs Uhr abends von WJJD in Chicago, die »Grand Ole Opry« von WSM in Nashville, die jeden Samstagabend kam, den »Renfro Valley Barn Dance« und die »Wheeling Jamboree« von WWVA in Wheeling, West Virginia. Ich weiß noch, wie ich Roy Acuff hörte, Ernest Tubb, Eddy Arnold, Hank Williams. Ich hörte mir alle Sendungen mit Popmusik an – Bing Crosby, die Andrews Sisters – und Gospel und Blues, alles von der Chuck Wagon Gang bis Pink Anderson und Sister Rosetta Tharpe. Ich weiß noch, dass ich fünfzehn Minuten länger Mittagspause von der Feldarbeit machen durfte, damit ich mir die Sendung mit den Louvin Brothers, »High Noon Roundup«, von WMPS in Memphis anhören konnte. Ich weiß noch, wie Daddy jeden Abend um fünf nach acht direkt nach der Übertragung der Nachrichten ins Bett ging und Jack und mir zurief: »Okay Jungs, Zeit zum Schlafengehen! Sonst kommt ihr morgen früh nicht aus dem Bett, wenn die Arbeit losgeht. Löscht das Licht! Macht das Radio aus!« Jack drehte dann seine Öllampe etwas herunter und beugte sich über seine Bibel. Ich drehte das Radio etwas leiser und presste mein Ohr direkt ans Gerät. Die Musik, die ich hörte, wurde das Wichtigste in meinem Leben.
Daddy gefiel das gar nicht. »Du verschwendest deine Zeit, wenn du die ganze Zeit vor dem Radio hockst und dir diese alten Platten anhörst«, sagte er immer. »Das hat mit dem wirklichen Leben nichts zu tun, verstehst du? Diese Menschen sind nicht wirklich da. Da sitzt nur irgendein Typ und spielt Platten ab. Warum hörst du dir diesen Schwindel überhaupt an?«
Ich sagte dann: »Aber es ist genauso wirklich wie in dem Moment, als sie es gesungen und aufgenommen haben. Es ist genau das Gleiche.«
»Nein, es ist nicht das Gleiche, es ist nur ein Platte.«
»Das ist mir egal. Es hört sich gut an. Mir gefällt es.«
»Diese ganzen Leute werden dir noch völlig den Kopf verdrehen«, sagte er abschließend. »Das hält dich alles nur davon ab, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du wirst es nie zu etwas bringen, solange du diese Musik im Kopf hast.«
Ich hasste es, so etwas zu hören, aber vielleicht war es auch zu etwas gut. Ich wollte ihm unbedingt beweisen, dass er sich irrte. Und ich wollte auch beweisen, dass Mom recht hatte. Sie hatte erkannt, dass die Musik genauso in mir steckte wie in ihr und wie schon in ihrem Vater, John L. Rivers, der das »Shape Note System«, eine einfache Notenschrift, und vierstimmigen Gesang unterrichtete und Vorsänger in seiner Kirche war. Man sagt, dass er ein großartiger Sänger war, gut genug, um Profi zu werden. Die Leute kamen aus der ganzen Umgebung, um ihn zu hören.
Ich habe ihn als einen sehr netten Mann in Erinnerung. Er und meine Großmutter Rivers waren zwei herzensgute Seelen, wie das Salz der Erde, und in ihrer Gemeinde waren sie allseits beliebt und respektiert. Lange nachdem Großvater Rivers gestorben war, fuhr ich einmal nach Chesterfield County in South Carolina, wo er zur Welt gekommen und aufgewachsen war. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, etwas über ihn zu erfahren, als ich das Büro der Entkörnungsanlage »Rivers Cotton Gin« betrat und fragte: «Kennt hier irgendjemand John L. Rivers, der als junger Mann nach Arkansas gezogen ist?« Doch sie antworteten wie aus einem Munde: »Wir kennen ihn alle.« Dann schickten sie mich die Straße runter zum Ahnenforscher Edgar Rivers. Edgar setzte sich mit mir auf die Veranda hinter seinem Haus und erzählte mir eine Geschichte.
Einige Jahre nachdem er sich in Arkansas niedergelassen hatte, erhielt Großvater Rivers einen Brief aus seiner früheren Heimat, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Farmen in Chesterfield County von Mehltau heimgesucht worden waren und die Farmer nun kein Saatgut für das nächste Jahr hatten. Ob er, falls er etwas übrig hätte, es ihnen vielleicht irgendwie zukommen lassen könnte?
Er konnte. Er kratzte alles Saatgut zusammen, das er entbehren konnte, spannte die Pferde vor seinen Wagen, fuhr damit von Südwest-Arkansas nach South Carolina – damals eine furchtbar lange und anstrengende Reise – und lieferte die Saat rechtzeitig zur Frühjahrsauspflanzung ab. Die Farmer von Chesterfield County konnten in jenem Jahr eine gute Ernte einfahren.
Nachdem er die Geschichte zu Ende erzählt hatte, ging Edgar in seine Küche und kam mit einem frischen Maiskolben in der Hand auf die Veranda zurück. Er habe ihn an diesem Morgen erst gepflückt, sagte er, der erste Mais in diesem Jahr aus seinem Garten. Er schälte ihn und zeigte ihn mir. Er sah gut aus: ein großer, langer und gesunder goldgelber Maiskolben.
»Das ist John L. Rivers Yellow«, sagte er, »der gleiche Mais, den dein Großvater aus Arkansas mitgebracht hat. Wir essen ihn heute noch.«
Das war ein wunderschöner Moment.
Mom hat Großvater Rivers' Begabung und seine Liebe zur Musik geerbt. Sie konnte Gitarre spielen und auch Geige. Außerdem konnte sie gut singen. Den ersten Gesang in meinem Leben hörte ich von ihr und das erste selbst gesungene Lied, an das ich mich erinnern kann, war eines der religiösen Lieder, die sie als Kind gelernt hatte. Ich war ungefähr vier Jahre alt und saß auf der Veranda vor unserem Haus direkt neben ihr auf einem Stuhl. Sie sang »What would you give« und ich stimmte ein und sang die Zeile weiter – »in exchange for your soul?«
Wir sangen im Haus, auf der Veranda, überall. Wir sangen auf den Feldern. Daddy pflügte irgendwo alleine vor sich hin und wir Kinder waren bei Mom, hackten entlang der Baumwollreihen und sangen. Ich fing meistens mit irgendwelchen Popsongs an, die ich im Radio gehört hatte, und meine Schwester Louise und ich forderten uns immer gegenseitig heraus: »Ich wette, den kennst du nicht!« Meist kannte ich sie und stimmte ein, lange bevor sie zu Ende gesungen hatte. Später am Tag sangen wir alle zusammen irgendwelche Hillbillysongs und modernere Sachen, alles, was gerade aktuell war – I'm My Own Grandpa, Don't Telephone, Tell a Woman –, und dann, wenn die Sonne schon fast im Westen stand und unser Schwung allmählich nachließ, gingen wir zu Gospels über: Zunächst die mitreißenden, temporeichen Songs, um uns noch mal zu motivieren, und dann, während die Sonne immer tiefer sank, die langsameren Spirituals. Nach Jacks Tod sangen wir immer all die Lieder, die wir bei seiner Beerdigung gesungen hatten. Unsere Tage auf dem Feld endeten immer mit Life's Evening Sun Is Sinking Low.
Mom glaubte an mich. Sie wollte, dass ich Gesangsunterricht nahm, und als Bezahlung wusch sie die Wäsche der Lehrer. Mit der Arbeit eines ganzen Tages verdiente sie drei Dollar, den Preis für eine Unterrichtsstunde. Ich wollte das überhaupt nicht, aber sie bestand darauf und ich war froh, dass sie es tat. Als ich zur ersten Übungsstunde erschien, entdeckte ich auch gleich einen guten Grund, noch eine zweite Stunde zu nehmen: Die Lehrerin war jung, nett und sehr hübsch.
Offenbar war sie aber nicht für mich bestimmt. Mitten in meiner dritten Stunde, nachdem sie mich bei den Songs Drink to Me Only with Thine Eyes, I'll Take You Home Again, Kathleen und den ganzen anderen alten irischen Balladen begleitet hatte, klappte sie den Deckel ihres Klaviers zu.
»Okay, das reicht«, sagte sie. »Ich möchte, dass du mir jetzt etwas ohne Begleitung vorsingst, irgendetwas, was dir gefällt.« Ich sang ihr einen Song von Hank Williams vor. Ich glaube, es war Long Gone Lonesome Blues.
Als ich fertig war, sagte sie: »Nimm nie wieder Gesangsunterricht. Lass dir bloß nicht durch mich oder irgendjemand anderen deinen Gesangsstil verändern.« Dann schickte sie mich nach Hause.
Ich bedauerte es, diese hübsche Lady nun nicht mehr sehen zu können, aber ich nahm mir ihren Rat zu Herzen und heute bedaure ich das in gewisser Weise auch. Es wäre gut, wenn ich mehr über meine Stimme erfahren hätte, wie ich sie im Laufe der Zeit hätte schützen und kräftigen können, anstatt sie so zu missbrauchen und zu schädigen, wie ich es getan habe.
Das erinnert mich an den Tag, als ich in den Stimmbruch kam und meine Mutter zum ersten Mal diese neuen Basstöne von mir hörte. Ich kam singend zur Hintertür herein und sie wandte sich erschrocken vom Herd ab und fragte: »Wer war das?«
Ich sang ihr noch etwas mehr vor und erforschte meinen neuen Stimmumfang. Als ich entdeckte, wie tief ich runterkam, füllten sich ihre Augen mit Tränen und sie sagte: »Du klingst genauso wie mein Daddy.« Dann sagte sie: »Diese Gabe ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Vergiss das nie.«
Ich glaube nicht, dass Mom sich damals wirklich fragte, wer da wohl gesungen hatte; sie wusste, dass ich es war. Und es war, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal, dass sie meine Stimme als »eine Gabe« bezeichnete. Von da an verwendete sie immer diesen Ausdruck, wenn sie über meine Musik sprach. Ich glaube, das hat sie ganz bewusst getan, um mich immer daran zu erinnern, dass die Musik in mir etwas ganz Besonderes war, etwas, das Gott mir gegeben hatte. Meine Aufgabe war, darauf aufzupassen und sie richtig einzusetzen. Ich trug sie in mir, doch ich besaß sie nicht.
© Author's collection
Schulporträt aus der 12. Klasse