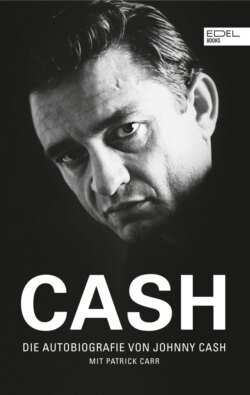Читать книгу CASH - Johnny Cash - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JACK
ОглавлениеUnsere Räucherkammer war ein schlichter Bretterbau von vielleicht vier mal vier Metern – keine primitive Hütte, sondern eine gute, dichte und stabile Konstruktion –, in der wir unser Fleisch räucherten. Alle Fleischvorräte mussten geräuchert werden, denn ohne Kühlvorrichtung, die wir natürlich nicht besaßen, wären sie sonst verdorben. Alle Leute, die auf dem Land lebten, hatten eine Räucherkammer, jedenfalls wenn sie nicht zu arm waren.
Außer dem Fleisch, das dort gerade hing, gab es nur zwei Dinge in unserer Räucherkammer: einen Salzbehälter, in dem das Pökelfleisch – Schinken, Schweineschulter, Speck – eingesalzen beziehungsweise »eingezuckert« wurde, wie wir es nannten. Und in der gegenüberliegenden Ecke war eine kleine Brennkammer, die Daddy gebaut hatte. Wenn wir Fleisch räucherten, sorgten wir dafür, dass darin Tag und Nacht grüne Hickoryzweige vor sich hin schwelten, und im Sommer hielten wir sie ständig in Betrieb, um die Insekten fernzuhalten und Bakterien abzutöten. Der Geruch nach verbranntem Hickoryholz, der immer über unserem Hof lag, hat sich mir tief eingeprägt.
Und genau in diese Räucherkammer führte mich Daddy, finster und fremd für mich in seinem Schmerz und seiner Erschütterung, und zeigte mir die blutigen Kleider von Jack.
Jack war mein großer Bruder und mein Held: mein bester Freund, mein großer Kumpel und mein Beschützer. Wir passten gut zusammen, Jack und ich; wir hatten glückliche Zeiten miteinander, ich liebte ihn.
© Ray Cash
Mit Jack (links) und Reba (im Hintergrund)
Und ich bewunderte ihn wirklich. Ich blickte zu ihm auf und respektierte ihn. Er war sehr reif für sein Alter, rücksichtsvoll, verlässlich und ausgeglichen. Er hatte so ein gefestigtes Wesen – eine solche Ernsthaftigkeit, könnte man sagen, auch in moralischer Hinsicht, solch eine gravitas –, dass keiner auch nur auf die Idee kam, an der Ernsthaftigkeit und Richtigkeit seiner Entscheidung zu zweifeln, als er verkündete, er fühle sich von Gott dazu berufen, Prediger zu werden. Jack Cash wäre sicher ein hervorragender Geistlicher geworden, darüber waren sich in Dyess alle einig. Wenn ich ihn als Vierzehnjährigen vor Augen habe, in dem Alter, als er starb, sehe ich ihn als Erwachsenen, nicht als einen Jungen.
Jack hatte eine sehr klare und feste Vorstellung von Recht und Unrecht, aber er konnte auch sehr lustig sein. Er war ein toller Angelpartner und Spielkamerad. Er war fit und stark, geradezu in perfekter körperlicher Verfassung, und er war ein kraftvoller Schwimmer und schneller Läufer. Natürlich konnten wir Jungs vom Land alle auf Bäume klettern wie die Eichhörnchen, aber er war schon außergewöhnlich. Er war so stark, dass er sogar an einem Seil hochklettern konnte, ohne die Füße zu benutzen.
Das imponierte mir sehr, denn ich war ein schwächlicher Typ, dürr und mager, und hatte überhaupt keine Kraft. Als Jack vierzehn war, hatte ich bereits beschlossen, dass Zigaretten schmecken. Ich fing mit zwölf an, regelmäßig zu rauchen. Ich stahl meinem Daddy Tabak, schnorrte bei anderen Kindern Zigaretten und ganz selten mal kaufte ich mir eine Packung »Prince Albert« oder manchmal auch »Bull Durham« oder »Golden Grain« und rollte mir selbst welche.
Ich war ziemlich geschickt darin, war ein begabter Raucher. Ich wusste, dass es schlecht und selbstzerstörerisch war, nicht nur weil der Pfarrer es sagte, sondern auch weil es einleuchtend war. Schon damals – egal was die älteren Leute heute sagen – wusste jeder, dass Rauchen schädlich ist, aber ich war nie einer, der sich von solchen Überlegungen davon abhalten ließ, ins eigene Verderben zu laufen. Jack wusste, dass ich rauchte, und konnte das überhaupt nicht gutheißen, aber er kritisierte mich nicht. Heute würde man sagen, er brachte mir bedingungslose Liebe entgegen. In dem Jahr, als er starb, hatte ich sogar schon angefangen, in seiner Gegenwart zu rauchen.
Es war der 12. Mai 1944, an einem Samstagmorgen. Ich hatte vor, angeln zu gehen. Jack wollte zum Arbeiten in die landwirtschaftliche Werkstatt der Highschool gehen, wo er einen Job hatte und am Sägetisch Eichenbäume zu Zaunpfählen zersägte. Er zögerte es hinaus. Er nahm einen der Wohnzimmerstühle, balancierte ihn auf einem Bein und drehte ihn immer wieder um die eigene Achse. Ich hatte meine Angel an die Veranda gelehnt. Als ich zur Haustür hinausging, sagte ich: »Komm doch, Jack. Komm mit mir angeln!«
»Nein«, sagte er, nicht sehr überzeugt. »Ich muss arbeiten gehen. Wir brauchen das Geld.« Er verdiente drei Dollar für einen ganzen Tag Arbeit.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater im Haus gewesen wäre, nur an meine Mutter, die sagte: »Jack, du wirkst so, als hättest du das Gefühl, du solltest lieber nicht gehen«, und an ihn, der sagte: »Nein. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas passieren wird.«
»Bitte geh nicht«, sagte sie und ich fiel ein: »Geh mit mir angeln, Jack. Komm, wir gehen angeln.« Aber er blieb dabei: »Nein, ich muss los. Ich muss zur Arbeit. Wir brauchen das Geld.« Schließlich setzte er den Stuhl auf dem Boden ab und ging schweren Herzens mit mir zur Tür hinaus. Ich weiß noch, wie meine Mutter dastand und uns zusah, als wir aufbrachen. Keiner sagte etwas, aber sie beobachtete uns. Das tat sie normalerweise nicht.
Das Schweigen hielt an, bis wir die Abzweigung erreichten, an der ein Weg ins Stadtzentrum und der andere zu unserem Angelplatz führte.
Jack fing an herumzublödeln. Er imitierte Bugs Bunny und sagte: »Was liegt an, Doc? Was liegt an, Doc?«, mit dieser albernen Stimme, die so gar nicht zu ihm passte.
Ich spürte, dass die Fröhlichkeit nur vorgetäuscht war. Ich versuchte es noch einmal: »Geh mit mir angeln, Jack. Komm schon, lass uns gehen.«
Es war nichts zu machen. »Nein, ich muss arbeiten gehen«, sagte er wieder.
Und das tat er dann auch. Er bog ab in Richtung Schule und ich ging weiter zu unserem Angelplatz. Solange ich ihn noch hören konnte, plapperte er dieses dämliche, unnatürliche »Was liegt an, Doc? Was liegt an, Doc?« vor sich hin.
Am Angelplatz angekommen, saß ich erst mal eine ganze Weile einfach nur da, ohne die Leine auch nur ins Wasser zu werfen. Schließlich warf ich sie doch aus, aber ich spielte nur damit herum, patschte mit der Leine aufs Wasser, machte nicht einmal den Versuch, einen Fisch zu fangen.
Es war schon merkwürdig. Es war, als ob ich gewusst hätte, dass irgendetwas nicht stimmte, doch ich konnte nicht sagen, was es war. Ich dachte dabei nicht einmal an Jack. Ich spürte nur, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Nach einer Weile zog ich meine Angelschnur aus dem Wasser und legte mich auf die Uferböschung – ich lag einfach nur da. So blieb ich eine lange Zeit reglos liegen, bevor ich aufstand, meine Angelrute schnappte und mich auf den Heimweg machte. Ich erinnere mich, dass ich sehr langsam ging, viel langsamer als sonst.
Als ich an die Abzweigung kam, an der ich mich von Jack getrennt hatte, sah ich meinen Vater schon kommen. Er saß in einem Auto, ich glaube, es war ein Model A, das Auto des Pfarrers. Daddy hielt auf meiner Höhe an und sagte: »Schmeiß deine Angel in den Graben und komm rein, JR. Lass uns nach Hause fahren.«
Ich spürte, dass da irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Ich wollte meine Angel behalten, aber Daddy machte einen so verzweifelten Eindruck, dass ich gehorchte. Ich warf die Angel einfach in den Graben und stieg ins Auto. »Was ist los, Daddy?«, fragte ich. »Jack ist sehr schwer verletzt«, sagte er.
Danach sagte er nichts mehr und ich fragte nicht nach. Als wir zu Hause ankamen, etwa eine Meile hinter der Kreuzung, holte er hinten aus dem Auto eine braune Einkaufstüte heraus.
»Komm mit rüber in die Räucherkammer«, sagte er mit leiser, tonloser Stimme. »Ich möchte dir etwas zeigen.« Die Tüte war voller Blut.
In der Räucherkammer zog er Jacks Kleider aus der Einkaufstüte, legte sie auf den Boden und zeigte mir, wo die Kreissäge Jack von den Rippen abwärts über den Bauch bis runter in die Leistengegend zerschnitten hatte. Sein Gürtel und das Hemd und die Hose seiner Khakiuniform, alles war zerfetzt und blutig, geradezu getränkt in Blut.
Daddy sagte: »Jack hat sich an der Säge verletzt und ich fürchte, wir werden ihn verlieren.« Dann weinte er. Es war das erste Mal, dass ich ihn weinen sah.
Er weinte nicht lange. Dann sagte er: »Ich bin nach Hause gekommen, um dich zu holen. Jack ist im Krankenhaus im Zentrum. Lass uns dorthin fahren und nach ihm schauen. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir ihn lebend sehen.«
Wir sahen Jack noch lebend. Als wir im Krankenhaus ankamen, war er bewusstlos, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, aber er starb noch nicht. Am Mittwoch, vier Tage nach seiner Verletzung, hielten alle Kirchengemeinden der Stadt einen Gottesdienst für ihn ab und am nächsten Morgen war er erstaunlicherweise wieder bei Bewusstsein. Er sagte, er fühle sich gut, und er sah gut aus. Er lag im Bett, in prächtiger Verfassung, wenn man so will, und las seine Post – er hatte einen Brief von seiner Freundin bekommen – und lächelte glücklich. Meine Mutter, mein Vater und ich glaubten an ein Wunder. Jack würde leben!
Der alte Dr. Hollingsworth wusste es besser. Er hatte Jack operiert, nachdem er eingeliefert worden war, und er sagte uns immer wieder: »Machen Sie sich jetzt bloß keine allzu großen Hoffnungen. Ich musste zu viel aus ihm herausnehmen und … na ja, es ist eigentlich wirklich nichts mehr da drin. Sie sollten die Familienangehörigen kommen lassen, die ihn noch einmal sehen wollen, bevor er geht.« Das taten wir – Roy war in Texas, glaube ich, und meine ältere Schwester Louise war in Osceola in Arkansas –, aber wir hatten immer noch Hoffnung.
Nicht sehr lange. Am Freitag verschlechterte sich Jacks Zustand wieder. In dieser Nacht schliefen wir im Krankenhaus, in den Betten, die Dr. Hollingsworth für uns acht organisiert hatte: Daddy, die drei Mädchen, die drei Jungs und Mom.
Am Samstagmorgen wachte ich in aller Frühe auf und hörte Daddy weinen und beten. Ich hatte ihn vorher auch noch nie beten sehen. Als er sah, dass ich wach war, sagte er: »Komm mit in sein Zimmer. Wir wollen uns von ihm verabschieden.«
Wir gingen hinein. Alle weinten. Meine Mutter stand am Kopfende von Jacks Bett, meine Brüder und Schwestern drum herum. Daddy führte mich zum Kopfende gegenüber meiner Mutter und wir hörten, wie Jack wirres Zeug redete: »Die Maultiere sind los, lasst sie nicht ins Maisfeld, fangt die Maultiere ein!« Aber plötzlich wurde er ruhig und klar. Er schaute sich um und sagte: »Ich bin froh, dass ihr alle da seid.«
Er schloss seine Augen: »Es ist ein schöner Fluss«, sagte er.
»Er fließt in beide Richtungen … Nein, da gehe ich nicht entlang … Ja, das ist die Richtung, in die ich will … Aaaah, Mama, kannst du es nicht sehen?«
»Nein, mein Junge, ich kann es nicht sehen«, sagte sie.
»Aber kannst du die Engel hören?«
»Nein, mein Junge, ich kann keine Engel hören.«
Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Ich wünschte, du könntest es«, sagte er. »Sie sind so schön … Es ist so wundervoll, und wie schön es dort ist.«
Dann bewegte er sich nicht mehr. Er hatte eine Darmvergiftung und das Zeug lief ihm aus dem Mund über die Brust. Er war von uns gegangen.
Jack zu verlieren war schrecklich. Es war damals schlimm und es ist heute noch ein großer, kalter, trauriger Fleck in meinem Herzen und meiner Seele. Schmerz und Verlust kann man nicht einfach verdrängen. Man kann sich drehen und wenden wie man will, aber früher oder später muss man sich einfach damit auseinandersetzen. Man muss da durchgehen, um hoffentlich auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Die Welt, die einen dann erwartet, wird nie mehr dieselbe sein wie die Welt, die man verließ.
Einige Dinge dieser Welt ändern sich jedoch nicht. Ich sehe die Armut um mich herum in Jamaika, wie hart das Leben für viele Menschen hier ist, wie sie sich endlos abmühen für einen geringen Lohn und noch weniger Hoffnung in ihrem Leben, nichts als Träume und Fantasien. Das führt mir wieder vor Augen, was mich an Jacks Tod heute noch am meisten bedrückt. Die Tatsache, dass seine Beerdigung am Sonntag, dem 21. Mai 1944, stattfand und Montagmorgen, am 22. Mai, unsere ganze Familie wieder auf den Baumwollfeldern stand. Alle, auch meine Mutter, die gerade ihren Sohn begraben hatte, arbeiteten und absolvierten ihren üblichen Zehnstundentag.
Ich sah mit an, wie meine Mutter auf die Knie fiel und ihren Kopf auf die Brust sinken ließ. Mein armer Daddy ging zu ihr hinüber und fasste sie am Arm, aber sie schüttelte ihn ab.
»Ich stehe erst auf, wenn Gott mir aufhilft!«, sagte sie voller Wut und Verzweiflung. Und kurz darauf war sie wieder auf den Beinen und hackte weiter.
Damit man sich keine allzu romantischen Vorstellungen macht von dem guten, natürlichen, mit harter Arbeit verbundenen und charakterformenden Landleben, das wir damals geführt haben, muss man sich nur das Bild von Carrie Cash in Erinnerung rufen, da unten im Schlamm zwischen den Baumwollreihen, am schlimmsten Tag, den eine Mutter erleben kann. Wenn es heißt, die Baumwolle war der König des ländlichen Südens, dann stimmt das in mehr als einer Beziehung.
Nach Jacks Tod fühlte ich mich, als wäre ich selbst gestorben. Ich spürte einfach kein Leben mehr in mir. Ich war furchtbar einsam ohne ihn. Ich hatte keinen anderen Freund.
Zunächst wurde es eher schlimmer als besser. Ich erinnere mich, wie ich in jenem Sommer 44 mit dem Bus zu einem Pfadfinderlager fuhr und über nichts anderes redete als über Jack, bis mich ein paar von den anderen Kindern zum Schweigen brachten: »Hey, Mann, wir wissen jetzt, dass dein Bruder tot ist und dass du ihn gemocht hast, es reicht jetzt, okay?«
Das hatte gesessen. Ich hörte ganz auf, über Jack zu reden. Jeder wusste, wie ich mich fühlte und wie meine Mutter sich fühlte. Sie brauchten niemanden, der ihnen das erzählte. Und deshalb, ja: furchtbar einsam. Das trifft es wohl am besten.
Es wurde ein bisschen besser, als einige meiner Klassenkameraden anfingen, sich um meine Freundschaft zu bemühen, besonders ein Junge namens Harvey Glanton, der für den Rest der Schulzeit mein bester Freund wurde. Seine Freundschaft gab den Anstoß dafür, dass ich langsam wieder herausfand aus der tiefsten Dunkelheit, die ich je erlebt hatte.
Eine wirklich treibende Kraft war natürlich der Sex. Mit etwa fünfzehn hatte ich die Mädchen entdeckt. Sie halfen mir sehr über meine Einsamkeit hinweg. Als sich meine Hormone langsam in Bewegung setzten, setzte auch ich mich in Bewegung.
Jack ist nicht wirklich gegangen, jedenfalls nicht mehr als andere auch. Er übt nach wie vor einen starken Einfluss auf mich aus. Als wir Kinder waren, versuchte er, mich vom Weg des Todes auf den Weg des Lebens zu bringen, mich zum Licht hin zu führen, und seit er gestorben ist, sind seine Worte und sein Beispiel wie Wegweiser für mich. Die wichtigste Frage bei vielen der Probleme und Krisen in meinem Leben war: »Was hätte Jack getan? Welche Richtung hätte er eingeschlagen?«
Ich bin natürlich nicht immer diesen Weg gegangen, aber ich habe zumindest gewusst, wo er war. Mit anderen Worten, mein Gewissen hat immer ganz gut funktioniert – selbst in all den Jahren, als ich mich fast selbst zerstörte und anderen viel Leid zufügte – trotz all meiner Bemühungen, es auszuschalten. Das dunkle Tier in mir wütete weiter und tat, wozu es Lust hatte (und manchmal tut es das heute noch), aber es wurde dabei ständig von dieser leisen, klaren Stimme des Gewissens gequält.
Und noch etwas anderes über Jack: Als ich aufwuchs, hieß es von den Älteren immer: »Diese jungen Leute werden noch alle in der Hölle landen«, genau wie es die modernen Erwachsenen über die heutige Jugend sagen und meine Generation über die Kids der Sechzigerjahre. Ich habe das nie geglaubt, weder heute noch damals. Ich urteilte nach dem, was ich sah und hörte: Ich hatte Jack vor Augen und ich wusste, dass es noch viel mehr Jungs wie ihn gab. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas geändert hat. Das war in den Sechzigerjahren so, als ich What Is Truth? schrieb und aufnahm, und das ist heute noch so. Also soll mir keiner damit kommen, die »Generation X« sei die »verlorene Generation«. Ich sehe zu viele gute Kids da draußen, Kids, die willens und bereit sind, einen guten Weg zu gehen, genau wie Jack. Allerdings haben sie mehr Ablenkung. Für die Jungen gibt es kein einfaches Leben mit einfachen Entscheidungen mehr.
Jack ist noch immer bei mir. Er war in den Liedern, die wir bei seiner Beerdigung gesungen haben – Peace in the Valley, I'll Fly Away, How Beautiful Heaven Must Be, in allen –, und diese Lieder haben mir ein Leben lang Kraft gegeben. Wo immer ich auch bin, muss ich nur eines davon anstimmen und spüre sofort, wie sich ein innerer Friede in mir ausbreitet, während mich die Gnade unseres Herrn erfüllt. Sie sind ungeheuer kraftvoll, diese Songs. Es gab Zeiten, da waren sie mein einziger Rückhalt, die einzige Tür, die aus der Finsternis hinausführte, weg von den Orten, wo das dunkle Tier haust.
Jack erscheint mir auch persönlich. Seit er tot ist, taucht er alle paar Monate in meinen Träumen auf, manchmal sogar öfter, und er hat sich mit mir weiterentwickelt. Wenn June oder John Carter oder andere Mitglieder meiner Familie in meinen Träumen erscheinen, sind sie normalerweise jünger, als sie eigentlich sind, aber Jack ist immer zwei Jahre älter als ich. Als ich zwanzig war, war er zweiundzwanzig, als ich achtundvierzig wurde, war er bereits fünfzig, und als ich ihn das letzte Mal sah, vor etwa drei Wochen, hatte er graue Haare und einen schneeweißen Bart. Er ist Prediger, genau wie er sein wollte, ein guter Mann und eine hoch angesehene Persönlichkeit.
Er ist auch immer noch sehr weise. Meistens habe ich in meinen Träumen von Jack irgendein Problem oder tue gerade etwas Fragwürdiges und ich merke, wie er mich ansieht und lächelt, als wolle er sagen: »Ich kenne dich, J. R. Ich weiß, was wirklich in dir vorgeht …« Jack kann ich nichts vormachen.