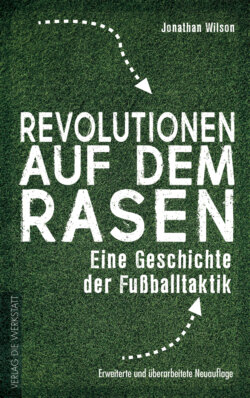Читать книгу Revolutionen auf dem Rasen - Jonathan Wilson - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 4
Wie der Faschismus das Kaffeehaus vernichtete
Herbert Chapman war ein Einzelfall. Er hatte mit einer einzigen Änderung auf ein spezifisches Problem reagiert, und der englische Fußball folgte ihm, weil er die Wirksamkeit seines Systems mit drei Verteidigern erkannte. Keineswegs aber war damit ein Zeitalter englischer Taktiker eingeläutet. „Leider blieb der alte Gipsabdruck erhalten“, schrieb Willy Meisl. „Es gab keinen Fußballmagier oder -professor, der ihn in Stücke geschlagen und in eine andere Form gegossen hätte.“ Wenn überhaupt, tat man lieber so, als ob es die taktische Veränderung nie gegeben hätte und die altehrwürdige Schottische Furche intakt geblieben sei.
Als die FA die Rückennummern 1939 zur Pflicht machte, ignorierte sie sämtliche neueren Entwicklungen und legte fest, dass der rechte Verteidiger die 2 tragen musste, der linke Verteidiger die 3, der rechte Läufer die 4, der Mittelläufer die 5, der linke Läufer die 6, der Rechtsaußen die 7, der rechte Halbstürmer die 8, der Mittelstürmer die 9, der linke Halbstürmer die 10 und der Linksaußen die 11 – ganz so, als ob das 2-3-5 immer noch der Standard sei und alle anderen Formationen nichts weiter als Variationen dieses Grundprinzips. Mannschaften, die im W-M-System spielten, wurden damit nach moderner Schreibweise 2, 5, 3 – 4, 6 – 8, 10 – 7, 9, 11 aufgestellt. In Großbritannien werden deshalb die Begriffe „centre-half “, also die Position des Mittelläufers, und „centre-back“, die Position des Innenverteidigers, synonym verwendet.
Die Zeitungen ignorierten die Realität ebenfalls und druckten die Mannschaftsaufstellungen noch bis in die 1960er Jahre so ab, als wenn jede Elf 2-3-5 spielte. Zwar wurde beim Spiel des FC Chelsea gegen die Budapester Mannschaft Vörös Lobogó im Jahr 1954 der Versuch unternommen, die ungarische Aufstellung in der Stadionzeitung korrekt wiederzugeben – man war infolge von Englands 3:6-Niederlage gegen Ungarn in Wembley ein Jahr zuvor auf die taktischen Feinheiten aufmerksam geworden. Doch beharrte man weiterhin darauf, dass das eigene W-M-System eigentlich einem 2-3-5 entsprach. Nur aufgrund dieser konservativen englischen Sichtweise war es Peter Doherty, Trainer der Doncaster Rovers, in den 1950er Jahren möglich, mit der List eines gelegentlichen Trikottausches seiner Spieler Verwirrung bei den Gegnern zu stiften. Schließlich waren die ja daran gewöhnt, ihre direkten Gegenspieler an der Rückennummer zu erkennen.
Nummerierungsschema des 2-3-5
Nummerierungsschema des W-M-Systems in England
Bevor die Bedeutung der Taktik allgemein anerkannt wurde, musste das Spiel erst von einer Gesellschaftsschicht aufgegriffen werden, die es instinktiv theoretisierte und analysierte. Einer Schicht, die sich bei der abstrakten Spielvorbereitung ebenso wohlfühlte wie bei der Umsetzung auf dem Platz. Einer Schicht, der nicht jenes Misstrauen gegenüber dem Intellektualismus innewohnte, das in Großbritannien vorherrschte. Genau dies war im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit der Fall. Was die Uruguayer und Argentinier praktisch vorführten, wurde von einem – größtenteils jüdischen – Teil des österreichischen und ungarischen Bürgertums in erklärende Worte gefasst. Die moderne Spielauffassung und die Diskussion darüber stammen aus den Kaffeehäusern Wiens.
In den 1920er Jahren boomte der Fußball in Österreich. 1924 wurde eine Profiliga mit zwei Klassen gegründet. Im November des gleichen Jahres fragte das Neue Wiener Journal: „Und welche Stadt sieht Sonntag für Sonntag selbst bei wenig einladendem Wetter zumindest 40.000 bis 50.000 Zuschauer auf allen Sportplätzen versammelt? Wo noch interessiert sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung für den Ausgang der Wettspiele, so dass man in den Abendstunden auf der Straße, in der Elektrischen, in den Gast- und Kaffeehäusern, im Kino und fast jeden zweiten Menschen von den Ergebnissen der Meisterschaftsspiele und von den Aussichten der Klubs in den nächsten Kämpfen sprechen hört?“ Die Antwort war simpel: Abgesehen von Großbritannien nirgendwo sonst in Europa.
Doch während in Großbritannien die Spiele im Pub diskutiert wurden, tat man dies in Österreich im Kaffeehaus. In Großbritannien hatte der Fußball seinen Ursprung an den Privatschulen, war in den 1930er Jahren aber längst zu einem Sport der Arbeiterklasse geworden. In Mitteleuropa verlief die Entwicklung weniger geradlinig. Hier war Fußball von der englandverrückten Mittelklasse eingeführt worden, die Arbeiterklasse hatte ihn rasch übernommen, bevor die Intellektuellen das Spiel schließlich an sich rissen, obgleich sich die Mehrheit der Spieler weiterhin aus der Arbeiterschaft rekrutierte.
In Mitteleuropa war der Fußball fast ausschließlich ein urbanes Phänomen, das sich auf Wien, Budapest und Prag konzentrierte. In diesen Städten war auch die Kaffeehauskultur am stärksten verwurzelt. Das Kaffeehaus erlebte gegen Ende des Habsburgerreiches seine Blütezeit und wurde zu einem öffentlichen Salon – zu einem Ort, an dem sich einerseits Männer und Frauen aller Klassen mischten, der sich andererseits durch seine künstlerische und durch die Boheme geprägte Atmosphäre auszeichnete. Dort lasen die Leute Zeitung, holten ihre Post und gereinigte Wäsche ab und spielten Karten und Schach. Kandidaten aus der Politik nutzten das Kaffeehaus als Bühne für Versammlungen und Debatten, während Intellektuelle und ihre Gefolgsleute die Ereignisse des Tages diskutierten: Kunst, Literatur, Theater – und im Laufe der 1920er Jahre in wachsendem Maße auch Fußball.
Zu jedem Klub gehörte ein bestimmtes Kaffeehaus, in dem sich Spieler, Anhänger, Funktionäre und die schreibende Zunft mischten. Die Fans von Austria Wien beispielsweise trafen sich im Café Parsifal und die von Rapid Wien im Café Holub. Der Nabel der Fußballszene in der Zwischenkriegszeit war jedoch das Ring-Café. Zunächst kam dort vor allem die englandverrückte Kricket-Gemeinde zusammen. Bis 1930 war es dann zum Zentrum der Fußball-Gemeinde geworden. Einem in den Nachkriegsjahren erschienenen Artikel in der Welt am Montag zufolge war es eine Art revolutionäres Parlament von Fußballfanatikern, in dem kein Verein die Oberhand gewinnen konnte, weil ganz einfach jeder Wiener Fußballklub vertreten war.
Die Wirkung des Fußballs auf die Kultur im weiteren Sinne lässt sich durch die Karriere von Rapid Wiens Mittelstürmer Josef Uridil verdeutlichen. Er stammte aus einem der Wiener Vororte – in jener Zeit unruhige Arbeiterviertel – und wurde für seine körperbetonte Spielweise gefeiert, entsprach sie doch den proletarischen Wurzeln des Vereins. Uridil war der erste Fußballheld der Kaffeehäuser. 1922 widmete ihm der bekannte Kabarettist Hermann Leopoldi das Lied „Heute spielt der Uridil“. Es hatte einen solchen Erfolg, dass Uridil selbst unter denjenigen berühmt wurde, die sich nicht für Fußball interessierten. Er begann, für eine Reihe von Produkten – von Seife bis hin zu Fruchtsaft – Werbung zu machen, und trat ab Februar 1924 als Ansager in einer Konzerthalle auf. Zur selben Zeit zeigten die Kinos den Film Pflicht und Ehre, in dem Uridil sich selbst spielte.
In dieser Atmosphäre zündete auch Hugo Meisls „Wunderteam“. Die österreichische Nationalmannschaft zeigte bereits in den späten 1920er Jahren eine Aufwärtstendenz. So verpasste sie beim ersten Coupe Internationale européenne, einem von mehreren europäischen Nationalmannschaften ausgespielten Pokal, nur knapp den Sieg. An diesem über 30 Monate zwischen 1927 und 1930 ausgetragenen und im Ligamodus gespielten Turnier nahmen neben Österreich die Tschechoslowakei, Ungarn, Italien und die Schweiz teil, nicht jedoch die Teams von der britischen Insel. Österreich verlor drei der ersten vier Spiele, fertigte dann Ungarn mit 5:1 und den späteren Sieger Italien mit 3:0 ab und wurde mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Im Ring-Café war man unzufrieden und plädierte für eine Berufung Matthias Sindelars. Bei Sindelar handelte es sich um einen talentierten, fast schon intellektuellen Stürmer, der für die stark mit dem jüdischen Bürgertum in Verbindung gebrachte Austria Wien antrat.
Sindelar gehörte zu einem neuen Schlag von Mittelstürmern. Er war ein Spieler von solch schmächtiger Statur, dass er den Spitznamen „Der Papierene“ erhielt. Der Hauch von Genie, der ihn umgab, veranlasste einige Schriftsteller zu einem Vergleich seiner Kreativität mit ihrer eigenen: Er hatte ein gutes Gefühl für Timing und Dramaturgie sowie ein Gespür für das Spontane und verfügte über eine ausgefeilte Technik. In der 1978 erschienenen Ausgabe seiner Anekdotensammlung Die Erben der Tante Jolesch schrieb der Schriftsteller Friedrich Torberg, einer der führenden Köpfe der Kaffeehaus-Autoren, über Sindelar: „[E]r verfügte über einen so unglaublichen Variations- und Einfallsreichtum, dass man tatsächlich niemals wissen konnte, welche Spielanlage von ihm zu erwarten war. Er hatte kein System, geschweige denn eine Schablone. Er hatte – man wird diesen Ausdruck gestatten müssen – Genie.“
Hugo Meisl dagegen hatte seine Zweifel. Er ließ Sindelar zwar 1926 im Alter von 23 Jahren in der Nationalmannschaft debütieren. Doch obwohl Meisl zu den Vorreitern einer neuen Auffassung von Fußball gehörte, war er tief in seinem Herzen konservativ geblieben. Was auch immer er in taktischer Hinsicht tat, erinnerte an die Glasgow Rangers von 1905, deren Stil er auf nostalgische Art und Weise wiederzubeleben versuchte. Meisl bestand auf einem von Kombinationen geprägten Passspiel, ignorierte den Trend zum dritten Verteidiger und war der Überzeugung, dass ein Mittelstürmer vor Kraft strotzen sollte – ähnlich wie Uridil.
Matthias Sindelar, der „Papierene“.
Auch wenn Uridil und Sindelar beide Söhne mährischer Einwanderer waren, beide in Vororten Wiens aufwuchsen und beide zu Stars wurden – auch Sindelar spielte in einem Kinofilm mit und besserte sein Gehalt als Fußballer durch Werbung für Armbanduhren und Milchprodukte auf –, hatten sie ansonsten doch nur wenig gemeinsam. Im Gegensatz zum zerbrechlichen Kreativgeist Sindelar galt Uridil als „Tank“, der sich dank seiner Körperkraft im Spiel durchsetzte.
1931 gab Meisl dem öffentlichen Druck schließlich nach, berief Sindelar und machte ihn zum Stammspieler der Nationalmannschaft. Die Wirkung war außerordentlich. Am 16. Mai 1931 besiegte Österreich die schottische Auswahl mit 5:0. Zwar traten die Schotten ohne Spieler der Rangers oder Celtics an, hatten sieben Debütanten in ihren Reihen und verloren aufgrund einer Verletzung frühzeitig Daniel Liddle. Zudem war Colin McNab nach einem Schlag an den Kopf gegen Ende der ersten Halbzeit nur noch physisch anwesend. Dennoch ließ der Daily Record keinen Zweifel daran, was er vor Ort hatte miterleben dürfen. „Deklassiert!“, hieß es in dicken Lettern. Nur die Heldentaten von Torhüter John Jackson hatten eine noch schlimmere Demütigung verhindert.
Zwei Tage zuvor war auch England in Paris von Frankreichs Elf mit 2:5 nach Hause geschickt worden. Somit markiert diese Woche aus heu tiger Sicht einen Meilenstein. Nun war offensichtlich geworden, dass die übrige Welt Großbritannien fußballerisch eingeholt hatte – auch wenn das britische Zeitungen und Fußballfunktionäre natürlich immer noch anders sahen. Die Arbeiter-Zeitung fing die Stimmung perfekt ein. „War es elegisch, den Abstieg eines Ideals, das die Schotten bis gestern für uns gewesen sind, sehen zu müssen, so war es umso erquickender, Zeuge eines Triumphs zu sein, der einer wirklich künstlerischen Leistung entsprach“, schrieb sie. „Elf Fußballer, elf Professionals – gewiss, es gibt noch wichtigere Dinge in der Welt, aber es ist schließlich doch ein Dokument wienerischen Schönheitssinnes, wienerischer Fantasie und wienerischer Begeisterung.“
Doch das „Wunderteam“ fing gerade erst an. Es spielte ein traditionelles 2-3-5, hatte in Josef Smistik einen eleganten Mittelläufer und mit Sindelar einen unorthodox auftretenden Mittelstürmer, der ein solch flüssiges Kombinationsspiel ermöglichte, dass das System als „Scheiberln“ bzw. im Englischen als „Danubian Whirl“, also Donauwirbel, bekannt wurde. Mit dem Scheiberln gewann Österreich neun der folgenden elf Spiele bei zwei Unentschieden. Man erzielte dabei 44 Tore und gewann 1932 die zweite Auflage des Europapokals der Nationalmannschaften. In den Kaffeehäusern herrschte Jubelstimmung: Ihre Lebensart hatte sich durchgesetzt, und das hauptsächlich wegen Sindelar, einem Spieler, der in der ihnen eigenen, romantisierenden Sichtweise das fleischgewordene Kaffeehaus war. „Er spielte Fußball, wie ein Meister Schach spielt: Mit weiter gedanklicher Konzeption, Züge und Gegenzüge vorausberechnend, unter den Varianten stets die aussichtsreichste wählend“, schrieb der Theaterkritiker Alfred Polgar in seinem Nachruf in der Pariser Tageszeitung, einem wegen seiner Verknüpfung so vieler grundsätzlicher Aspekte sehr bemerkenswerten Artikel.
Der angesprochene Nachruf enthielt zunächst die Analogie zum Schach, die auch Galeano zur Beschreibung der Uruguayer in den 1920er Jahren verwendet hatte und die Anatolij Selenzow im Zusammenhang mit Walerij Lobanowskyjs Dynamo Kiew später ebenfalls gebrauchen sollte. Außerdem wurde der Einfluss Jimmy Hogans und seiner Besessenheit mit der sofortigen Ballkontrolle spürbar, als Polgar nämlich fortfuhr: „[Er war] ein Fallensteller und Überrumpler ohnegleichen, unerschöpflich im Erfinden von Scheinangriffen, denen, nach der dem Gegner listig abgeluchsten Parade, erst der rechte und dann unwiderstehliche Angriff folgte.“
Vielleicht am bemerkenswertesten ist jedoch, dass Polgar die Gedanken des Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould über die „Allgemeingültigkeit der Exzellenz“ vorwegnahm. „Ich bestreite die Unterschiede gar nicht, die es bei Stil und Inhalt zwischen sportlicher und gewöhnlicher wissenschaftlicher Leistung gibt“, so vermerkte Gould, „doch liegen wir gewiss falsch, wenn wir den Sport als einen Hort animalischer Instinkte betrachten. … Der Erfolg der größten Athleten kann nicht allein aufgrund ihrer körperlichen Gabe zustande kommen. … Eines der faszinierendsten und unbestreitbaren Merkmale großer sportlicher Leistung liegt in der Unmöglichkeit, bestimmte zentrale Fähigkeiten mit gezielter Überlegung zu steuern. Die notwendige Handlung gewährt ganz einfach nicht genügend Zeit für aufeinanderfolgende bewusste Entscheidungen.“ Und Polgar schrieb über Sindelar: „Er hatte sozusagen Geist in den Beinen, es fielen ihnen, im Laufen, eine Menge Überraschendes, Plötzliches ein, und Sindelars Schuss aufs Tor traf wie eine glänzende Pointe, von der aus der meisterliche Aufbau der Geschichte, deren Krönung sie bildete, erst recht zu verstehen und zu würdigen war.“
Im Dezember 1932 kam es zur bis dahin größten Bewährungsprobe des „Wunderteams“: England. England stellte bei Weitem nicht die beste Mannschaft der Welt, stand als Mutterland des Fußballs aber weltweit weiterhin in hohem Ansehen. Zudem war England zu Hause gegen nicht-britische Gegner noch ungeschlagen. Zwar hatte Spanien 1929 Englands Verwundbarkeit durch einen Sieg in Madrid offengelegt. Zwei Jahre später wurde es in Highbury, London, jedoch mit 7:1 vom Platz gefegt. Beflügelt durch den Sieg gegen Schottland waren viele Österreicher indessen äußerst hoffnungsfroh. Der stets zum Pessimismus neigende Meisl allerdings machte sich Sorgen und wandte sich an seinen alten Freund und Mentor Jimmy Hogan.
Von England enttäuscht, war Hogan 1921 in die Schweiz gezogen und hatte dort drei Jahre lang die Young Boys Bern und später den FC Lausanne-Sport trainiert. Danach ging er zurück nach Budapest und war beim nun als FC Hungária firmierenden MTK tätig. Schließlich folgte er einem Ruf als Berater des DFB nach Deutschland, wo er gleichzeitig den Dresdner SC trainierte. Zu seinen dortigen Schülern gehörte Helmut Schön, der beim Erfolg der westdeutschen Auswahl bei der WM 1954 Sepp Herbergers Assistent war und das Land bei der WM 1974 auch selbst zum Sieg führen sollte. Wo immer er sich gerade aufhielt, propagierte Hogan einen technisch versierten Fußball und trug so dazu bei, dass der englische Fußball vom europäischen Festland bald überholt wurde.
Zunächst begegnete man ihm in Deutschland mit Misstrauen. Als sich diverse Trainer über seine mangelnden Deutschkenntnisse beschwerten, bat ihn der DFB, sich durch einen auf Deutsch gehaltenen Vortrag zu bewähren. Bereits der Anfang war holprig: Hogan stellte sich versehentlich als „einen Professor der Sprachen, nicht einen Meister des Fußballs“ vor. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Als er die Bedeutung des aktiven Mitdenkens beim Fußball betonen wollte, erklärte er seinem amüsierten Publikum, dass Fußball nicht nur ein Spiel des Körpers, sondern auch des Ausschusses sei. Hogan wurde mit Hohn und Spott bedacht, woraufhin er eine zehnminütige Pause für sich verlangte und das Rednerpult verließ.
Als er zurückkehrte, trug Hogan seine Spielkleidung von den Bolton Wanderers. Er zog seine Socken und Schuhe aus, verkündete, dass drei Viertel der deutschen Spieler nicht ordentlich gegen einen Ball treten könnten, und donnerte mit seinem rechten Fuß einen Ball barfuß in eine gut 15 Meter entfernte Holzvertäfelung. Als der Ball zu ihm zurücksprang, unterstrich er die große Bedeutung der Beidfüßigkeit und drosch einen weiteren Schuss gegen die Paneele, dieses Mal mit dem linken Fuß. Das Holz zerbrach daraufhin in zwei Teile. Nachdem Hogan auf diese Weise seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatte, unternahm er eine Vortragsreise und sprach in nur einem einzigen Monat zu insgesamt 5.000 Fußballern im Dresdner Raum. Als Hogan 1974 starb, verfasste der damalige DFB-Generalsekretär Hans Paßlack einen Brief an Hogans Sohn Frank, in dem er schrieb, Hogan sei der Begründer des „modernen Fußballs“ in Deutschland gewesen.
Da ihm die politische Situation Sorgen bereitete, verließ Hogan Deutschland in Richtung Racing Club de Paris. Dabei nähte er seine Ersparnisse in den Saum seiner Knickerbockers ein, um die Beschränkungen bei der Devisenausfuhr zu umgehen. In Frankreich hatte er allerdings Probleme, in einem mit Stars gespickten Team die Disziplin aufrechtzuerhalten, und kehrte schließlich nach Lausanne zurück. Dort fand er dann keine gemeinsame Linie mit dem Vereinsvorsitzenden, der der Ansicht war, dass man für vergebene Chancen Strafgelder an die Spieler verhängen müsse. Als Hogan schließlich den Ruf Meisls vernahm, lechzte er geradezu nach einer Herausforderung.
Man muss dazu sagen, dass Österreich ihn oder zumindest jemanden von außen benötigte, um eine Bestätigung der eigenen Fähigkeiten zu finden. Zwei Wochen vor dem Spiel in London konnte die Mannschaft gegen eine bunt zusammengewürfelte Wiener Elf nur mit Mühe sowie einem kränkelnden und weit unter seinen Möglichkeiten bleibenden Matthias Sindelar mit 2:1 gewinnen. Ein Problem waren ganz offensichtlich die Nerven, überdies war man wegen der Fitness von Adolf Vogl und Friedrich Gschweidl besorgt. Nichtsdestotrotz war ganz Österreich gespannt. Auf dem Heldenplatz versammelte sich eine große Menschenmenge, um der über drei Lautsprecher übertragenen Radioreportage zu lauschen. Der Finanzausschuss des Parlaments unterbrach sogar extra seine laufende Sitzung, um der Übertragung beiwohnen zu können.
Das „Wunderteam“ legte einen suboptimalen Start hin, und England führte nach 26 Minuten bereits mit zwei Toren. Beide Treffer hatte Blackpools Stürmer Jimmy Hampson erzielt. In der 51. Minute verkürzte Österreich, nachdem Karl Zischek durch eine Kombination zwischen Sindelar und Anton Schall entscheidend in Szene gesetzt worden war. In der folgenden Druckphase traf Walter Nausch noch den Pfosten, doch England fing sich bald wieder. Schließlich fälschte der sich wegduckende Schall einen Freistoß von Eric Houghton ab, und der Ball flog an Rudi Hiden vorbei ins österreichische Tor. Mit vollendeter Ballkontrolle und einem kühlen Abschluss schoss Sindelar zwar noch das 2:3, doch beinahe im Gegenzug stellte England durch einen Distanzschuss von Sam Crooks den alten Abstand wieder her. Dennoch herrschte Ratlosigkeit bei den Engländern, wenn sich die Österreicher nach Ballverlust ganz routiniert in die Verteidigung zurückfallen ließen. Die Österreicher hingegen spielten weiterhin überlegen und zogen ihr Passspiel auf, dem allerdings der Druck nach vorne fehlte. Zwar traf Zischek fünf Minuten vor dem Abpfiff noch einmal nach einer Ecke, doch kam dieser Treffer zu spät, und Österreich verlor mit 3:4. Die technisch hochwertige Leistung der Österreicher aber blieb in prägender Erinnerung. „Eine Offenbarung“, meinte die Daily Mail, während die Times den Österreichern den „moralischen Sieg“ zusprach und von ihrem „geschickten Passspiel“ schwärmte.
Hugo Meisl, der Vater des „Wunderteams“.
Zwei Jahre später trat eine als Wiener Auswahl verkaufte Elf, die im Grunde genommen die österreichische Nationalmannschaft darstellte, in Highbury gegen Arsenal an. Damals nämlich sah die FIFA es nicht gerne, wenn Vereins- und Nationalmannschaften gegeneinander spielten. Die Österreicher verloren mit 2:4, woraufhin Roland Allen im Evening Standard kommentierte: „Sobald Österreich gelernt hat, wie es seine Cleverness in zählbare Erfolge ummünzt, und sobald es … das Gewinnen von Fußballmatches so hervorragend organisiert, wie es das bereits mit der Zähmung des Balls getan hat, dann wird es [alle] aufmerken und davon Notiz nehmen lassen.“ Dem englischen Fußball hatte die Stunde geschlagen, doch niemand in England realisierte den Ernst der Lage.
Stattdessen hielt man die beiden Spiele für eine Bestätigung des Klischees, dass den Mannschaften vom europäischen Festland in den letzten 30 Spielminuten die Durchschlagskraft fehle. Nun war das im Hinblick auf die Österreicher zwar nicht ganz falsch. Allgemeinere Lehren über die Zirkulation des Balles wurden aber trotzdem nicht gezogen. Meisls Angewohnheit, in idealistischen Wendungen zu reden, verbesserte die Situation auch nicht gerade. Das englische Angriffsspiel, urteilte Meisl, sei für den Mitteleuropäer nicht schön anzuschauen. Dieses Spiel bestünde darin, den Abschluss vor dem Tor dem Mittelstürmer und den Flügelstürmern zu überlassen, während man den Halbstürmern die Aufgabe des Bindeglieds zwischen Abwehr und Angriff zuweise und sie mehr als Außenverteidiger denn als Eingreifer einsetze. Der Mittelstürmer, der auf dem europäischen Festland wegen seiner technischen Beschlagenheit und taktischen Intelligenz der Führungsspieler sei, beschränke seine Aktivitäten in England darauf, die Fehler der gegnerischen Abwehr auszunutzen.
Meisl war jedoch voll des Lobes ob des britischen Spieltempos und meinte, dass es seine eigenen Spieler „verwirrt und desorientiert“ habe: Dass das schnelle Passspiel der Engländer mit seinen hohen Bällen nicht so präzise sei, glichen sie durch hohes Tempo und eine körperbetonte Spielweise aus, meinte Meisl. Damit bestätigte er die gängigen Klischees: auf der einen Seite das körperlich starke, schnelle und zähe England, auf der anderen der technisch versierte, geduldige und offensichtlich nicht sonderlich kampfstarke Kontinent.
Im Mai 1936 konnte Österreich in Wien schließlich den von Meisl so ersehnten Sieg gegen England feiern. Als er Hogan vor dem Spiel seine Mannschaft präsentierte, äußerte dieser Zweifel am Stehvermögen der Halbstürmer. Meisl entgegnete, dass er in den ersten 20 Minuten die vorentscheidende Führung erzielen und diese dann in der verbleibenden Spielzeit verteidigen wolle. Der Plan ging auf. Sindelar lockte den Vorstopper John Barker wiederholt aus der Verteidigung – ähnlich, wie es Nándor Hidegkuti 17 Jahre später mit Harry Johnstons machen sollte. Schnell lag England mit zwei Toren im Rückstand. Zwar verkürzte George Camsell in der zweiten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff noch auf 1:2, das änderte aber nichts an Österreichs Überlegenheit – auch wenn Meisl an der Seitenlinie sichtlich nervös war. „Wir wussten nicht, wo uns der Kopf stand“, gestand Jack Crayston. „Und es war widerlich heiß.“ Britische Mannschaften haben noch nie gut ausgesehen, wenn die Hitze ein stumpfsinniges Anstürmen über längere Zeit nicht zulässt und Ballkontrolle die bessere Wahl wäre.
Nichtsdestotrotz hatte der Niedergang des „Wunderteams“ zu diesem Zeitpunkt längst begonnen. Die Österreicher mussten ihre führende Stellung auf dem Kontinent an die Italiener abtreten. Hinsichtlich der taktischen Formation wählte Italien – beinahe aus Versehen – einen Mittelweg zwischen dem englischen W-M-System und dem 2-3-5 der Donaustaaten. Der entscheidende Unterschied aber lag in ihrem Ethos. Der italienische Fußball „glich seine im Vergleich zum europäischen Rivalen [Österreich] weniger starke technische Beschlagenheit … durch seine forsche Art und die hervorragende Kondition der Spieler aus“, schrieb Glanville. Der Glaube an den Primat der Athletik mag im Faschismus ganz natürlich gewesen sein, er entsprach allerdings auch den Vorlieben des italienischen Nationaltrainers Vittorio Pozzo. Der Visionär mit dem buschigen Haar wurde zum führenden Genie des italienischen Fußballs der Zwischenkriegszeit.
Pozzo war 1886 in der Nähe von Turin auf die Welt gekommen. Er machte zunächst als vielversprechender Sprinter auf sich aufmerksam und gewann bei den Studentenspielen von Piemont den 400-Meter-Lauf. Zum Fußball kam er erst, nachdem ihn sein Freund Giovanni Goccione, der spätere Mittelläufer von Juventus Turin, damit aufgezogen hatte, „wie ein Automobil zu laufen“. Goccione schlug Pozzo vor, mal „mit einem Ball vor sich“ loszurennen. Pozzo wurde allerdings nie ein großer Spieler und absolvierte stattdessen ein Studium.
Zunächst studierte er an der Internationalen Handelsschule in Zürich, wo er Englisch, Französisch und Deutsch lernte, und dann in London. Der dortigen italienischen Gemeinde bald überdrüssig, zog es ihn Richtung Norden nach Bradford. Dort verschafften ihm die Beziehungen seines Vaters eine Stelle in der Wollproduktion. Ganz unvermittelt verliebte sich Pozzo in England samt dessen Fußball. Der Drang, seine neue Heimat besser kennenzulernen, zeigte sich in der Teilnahme an anglikanischen Gottesdiensten – trotz seiner katholischen Wurzeln. Seine Woche folgte bald dem englischen Muster: am Sonntag in die Kirche, fünf Tage arbeiten und am Samstag Fußball. Als seine Eltern ihn nach Italien zurückbeorderten, damit er in der Maschinenbaufirma seines Bruders aushelfe, weigerte sich Pozzo. Sein Vater strich ihm daraufhin den Unterhalt. Dennoch blieb Pozzo in England, wo er sich durch Sprachunterricht über Wasser hielt.
Pozzos Lieblingsmannschaft war Manchester United. Das lag hauptsächlich am Stil der legendären Abwehrreihe mit Dick Duckworth, Charlie Roberts und Alec Bell. Bald hing Pozzo nach den Spielen regelmäßig am Spielerausgang von Old Trafford herum. Als er eines Samstags endlich genügend Mut gesammelt hatte, sprach er Roberts an. Pozzo erzählte ihm, dass er ein glühender Verehrer sei und wie sehr er sich darüber freuen würde, sich mit ihm über das Spiel zu unterhalten. So begann ihre lange Freundschaft, aus der sich jener Stil entwickelte, den Pozzo seine italienische Mannschaft 20 Jahre später spielen lassen sollte. Er verabscheute die Taktik mit drei Verteidigern und verlangte von seinen Mittelläufern, dass sie – ähnlich wie Roberts – lange Pässe auf die Flügel schlagen konnten. In diesem Punkt war Pozzo absolut eisern, was beispielsweise nach seiner erneuten Ernennung zum Nationaltrainer im Jahr 1924 dazu führte, dass er sich, ohne zu zögern, von Fulvio Bernardini trennte. Das Idol des römischen Publikums war nun einmal eher ein „Träger“ denn ein „Verteiler“.
Zur Hochzeit seiner Schwester kehrte Pozzo schließlich doch nach Italien zurück und wurde prompt von seiner Familie daran gehindert, nach England zurückzukehren. Allerdings erhielt er bald den Posten des Generalsekretärs des italienischen Fußballverbandes, und anlässlich der Olympischen Spiele 1912 in Stockholm wurde er erstmals Trainer der Nationalmannschaft. Nachdem die Italiener knapp gegen Finnland verloren und dann gegen Schweden gewonnen hatten, bezogen sie von Österreich eine derbe 1:5-Packung. Diese Niederlage war eine große Enttäuschung, auch wenn sie nicht unerwartet kam. Die eigentliche Bedeutung dieses Spiels lag jedoch darin, dass sich Pozzo und Meisl hier zum ersten Mal begegneten. Sie schlossen Freundschaft und sollten doch den Rest ihres Lebens Rivalen bleiben.
Nach einer 1:3-Niederlage gegen Österreich im Dezember 1912 trat Pozzo zurück und begann wieder zu reisen. Während des Ersten Weltkriegs diente er als Major bei den Gebirgsjägern. 1924 ernannte man ihn nach einer 0:4-Niederlage gegen Österreich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris zum zweiten Mal zum Nationaltrainer. Italien legte dort einen vielversprechenden Auftritt hin und schlug Spanien und Luxemburg, bevor man sich der Schweiz knapp geschlagen geben musste. Kurze Zeit später starb Pozzos Frau, und er legte sein Amt erneut nieder. Die folgenden fünf Jahre arbeitete er in leitender Position bei Pirelli und wanderte in seiner Freizeit mit seinem Schäferhund in den Bergen. 1929 trat der italienische Verband ein weiteres Mal an ihn heran. Nun blieb Pozzo 20 Jahre lang Trainer der italienischen Nationalmannschaft. In dieser Zeit sollte er aus Italien eine der besten Mannschaften Europas, wenn nicht der Welt machen.
Bei seiner ersten Amtsübernahme 1912 hatte Pozzo ein aufgeblähtes Meisterschaftssystem mit 64 Vereinen vorgefunden. Als er versuchte, die oberste Klasse stärker zu straffen, trat eine Reihe von Klubs aus dem Verband aus. Bei seiner dritten Berufung war dagegen inzwischen eine Profiliga etabliert, und das faschistische Regime, das Sport als wirkungsvolles Propagandamittel erkannt hatte, investierte eifrig in Stadien und Infrastruktur. Mussolinis Pressemann Londo Ferretti drückte es nach dem WM-Triumph des Landes 1938 in Lo Sport Fascista so aus: „Ob innerhalb oder außerhalb unserer Grenzen, ob wir es zur Schau tragen oder nicht, wir Italiener erschauderten und erschaudern nach wie vor … vor Glückseligkeit und sehen in diesen Vollblutathleten, die so zahlreiche edle Gegner besiegen, ein Symbol für den überwältigenden Marsch der Italiener Mussolinis.“
Inwieweit sich Pozzo mit der faschistischen Ideologie einließ, bleibt ungeklärt. Auf jeden Fall aber führten seine Verbindungen zu Mussolini in den 1950er und 1960er Jahren zu seiner Isolation. Auch wurde das Stadio delle Alpi, das anlässlich der Weltmeisterschaft 1990 vor den Toren Turins errichtet wurde, aus diesem Grunde nicht nach Pozzo benannt. Später tauchten Indizien auf, die eine Kooperation mit dem antifaschistischen Widerstand belegen sollen. Demnach habe Pozzo die Partisanen in der Gegend um Biella mit Lebensmitteln versorgt und alliierten Kriegsgefangenen zur Flucht verholfen.
Kein Zweifel besteht hingegen daran, dass Pozzo den vorherrschenden Militarismus voll ausnutzte, um seine Machtposition gegenüber der Mannschaft zu sichern und sie zu motivieren. „Hat man mehr als einen Verantwortlichen, führt das zu Kompromissen, und die waren niemals das Fundament einer großen Fußballmannschaft“, sagte er. Pozzo hatte eine geschickte Art der Menschenführung und entwickelte einen strengen, autoritären Stil, um mit den häufig von den Fans ihrer Klubs so verehrten Spielern umzugehen. Beispielsweise pfiff er sämtliche Trainingsspiele persönlich und verwies einen Spieler des Feldes, sobald er das Gefühl hatte, dass dieser aus persönlichen Animositäten heraus einen Mannschaftskameraden nicht anspielte. Berief Pozzo zwei Spieler, von deren gegenseitiger Antipathie er wusste, zwang er sie, sich ein Zimmer zu teilen.
Am umstrittensten aber war sein Nationalismus. Einmal zum Beispiel war die Mannschaft auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn in Budapest, das Italien mit 5:0 gewann. Pozzo unterbrach die Reise am monumentalen Soldatenfriedhof von Redipuglia und ließ die Spieler die Schlachtfelder von Oslava und Gorizia aus dem Ersten Weltkrieg besichtigen. „Ich erklärte ihnen, dass es gut war, wenn jener traurige und schreckliche Anblick sie betroffen gemacht habe. Denn was immer man bei dieser Reise von uns erwartete, so war es doch nichts im Vergleich zu denen, die in den umliegenden Bergen ihr Leben verloren hatten“, schrieb er in seiner Autobiografie. Bei anderen Gelegenheiten marschierte er an der Spitze seiner Spieler voran und stimmte das patriotische Lied „La leggenda del Piave“ an.
Trotz alledem war Pozzo englandbegeistert genug, um sich für den Fairplay-Gedanken zu begeistern und die verderblichen Folgen der Siegprämien, die bald zur Normalität in der Liga wurden, zu verurteilen. „Es geht nur noch um das Siegen um jeden Preis“, sagte er. „Hier zeigt sich die bittere Missgunst gegenüber dem Gegner. Der alles beherrschende Gedanke ist das Ergebnis und seine Auswirkungen auf die Tabelle.“
Pozzo tendierte zu einem klassischen 2-3-5. Allerdings fehlte ihm für ein gutes Funktionieren des Systems noch ein Mittelläufer mit ausreichender Schnelligkeit und Kreativität. Pozzo griff auf Luis Monti zurück, der bei der WM 1930 noch für Argentinien aufgelaufen war. 1931 wechselte Monti zu Juventus Turin und wurde zu einem der Oriundi, jener dank ihrer italienischen Wurzeln für ihre Wahlheimat spielberechtigten südamerikanischen Akteure. Monti hatte bei der Vertragsunterzeichnung bereits ein Alter von 30 Jahren und zudem Übergewicht. Auch nach einem Monat individuellen Trainings war er nicht sonderlich schnell. Seine Fitness dagegen erwies sich als gut, und wegen seiner Fähigkeit, Räume abzudecken, erhielt er den Spitznamen „Doblo ancho“, „der doppelt Breite“.
Pozzo, der möglicherweise von einem bei Juventus bereits etablierten System beeinflusst wurde, stellte Monti als Centro mediano auf, die italienischen Entsprechung des Mittelläufers. Bei gegnerischem Ballbesitz ließ Monti sich zurückfallen und deckte den gegnerischen Mittelstürmer, bei eigenem Ballbesitz aber rückte er auf und wurde zum Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel. Damit war er zwar kein dritter Verteidiger – die Bedeutung des W-M-Systems (des Sistema, wie Pozzo es in Abgrenzung zur traditionellen Metodo nannte) erkannte man in Italien laut Glanville erst 1939 durch einen Artikel Bernardinis nach einem 2:2 Italiens gegen England –, spielte aber weiter zurückgezogen als ein traditioneller Mittelläufer. Dementsprechend ließen sich auch die beiden Halbstürmer zur Unterstützung der Außenläufer nach hinten fallen. Der Form nach entsprach dies einem 2-3-2-3, also einem W-W. Der Journalist Mario Zappa beschrieb dieses System in der Gazzetta dello Sport als „ein Spielmodell, das eine Synthese der besten Elemente aller am meisten bewunderten Systeme ist“.
Die Formation ist das eine, die Spielweise das andere. Trotz seiner Skrupel war Pozzo durch und durch Pragmatiker. Es gibt keinen Zweifel daran, dass er über eine technisch versierte Mannschaft verfügte, die dies 1931 schon vor Montis Berufung mit einem 3:0-Sieg über Schottland unter Beweis gestellt hatte. Der Corriere della Sera wusste über die unglückseligen britischen Touristen zu berichten: „Diese Männer sind schnell, athletisch gut trainiert und erscheinen sicher in der Schussund Kopfballtechnik, doch beim klassischen Spiel mit flachen Bällen sehen sie wie Anfänger aus.“ Solch eine Kritik wäre für jede Mannschaft hart gewesen. Für Spieler, die in der feinen Tradition des schottischen Kurzpassspiels aufgewachsen waren, war sie vernichtend.
Vittorio Pozzo führte Italien 1934 und 1938 zum Weltmeistertitel.
Zur damaligen Zeit verglich man den großen Mittelstürmer Guiseppe Meazza, der 1930 sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hatte, regelmäßig mit einem Stierkämpfer. Einem populären Schlager jener Jahre zufolge „traf er im Rhythmus eines Foxtrotts“. Dieses Gespür für Freude und Elan sollte jedoch bald verschwinden. Zwar blieb Meazza ein eleganter Stürmer, und auch an der Qualität von Spielern wie Silvio Piola, Raimundo Orsi oder Gino Colaussi konnte kein Zweifel bestehen. Allerdings wurden körperliche Robustheit und Kampfstärke immer wichtiger. In einem Kommentar in Lo Stadia hieß es dazu 1932: „Im zehnten Jahr des faschistischen Zeitalters wird die Jugend für die Schlacht gestählt und für den Kampf und stärker für das Spiel als solches; man kann Mut, Entschlossenheit und einen Stolz nach Art der Gladiatoren, die zu den erlesenen Eigenschaften unserer Rasse gehören, nicht außen vor lassen.“
Pozzo gehörte auch zu den frühen Befürwortern der Manndeckung. Es ging nun im zunehmenden Maße nicht mehr nur darum, das eigene Spiel aufzuziehen, es sollte auch das Spiel des Gegners verhindert werden. In einem 1931 in Bilbao ausgetragenen Freundschaftsspiel gegen Spanien beispielsweise ließ er Renato Cesarini als Manndecker gegen Ignacio Aguirrezabala spielen. Pozzo vertrat die Ansicht, dass „das ganze System zusammenbricht, wenn ich es schaffe, den Kopf abzuschlagen, mit dem die elf Gegenspieler denken“.
Bekümmerte dies damals noch nur Puristen, wurde die Moral der Italiener unter Pozzo erstmals ernsthaft bei der Weltmeisterschaft 1934 hinterfragt. Nachdem Italien ein Jahr zuvor gegen die weiterhin in ihrer Isolationshaltung verharrenden Engländer 1:1 gespielt hatte, zählte man als Heimmannschaft zu den Favoriten. Das galt ganz besonders unter dem Eindruck, dass sich das österreichische „Wunderteam“ bereits auf dem absteigenden Ast befand. Ausnahmsweise einmal schien Meisls Pessimismus gerechtfertigt zu sein, als er sich über das Fehlen seines Torhüters Hiden und den Erschöpfungszustand seiner Spieler, die mit ihren Vereinsmannschaften auf Auslandstourneen unterwegs gewesen waren, beklagte. Er behauptete allerdings auch, dass es für den Titel gereicht hätte, wenn er Arsenals Mittelstürmer Cliff Bastin hätte ausleihen können. Indirekt erkannte Meisl mit dieser Äußerung die englische Kritik an der fehlenden Durchschlagskraft seines Teams an.
Italien und Österreich mit Pozzo und Meisl trafen im Halbfinale aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt war das Turnier bereits in Verruf geraten. Österreich war daran alles andere als unschuldig, beteiligte es sich beim Viertelfinalsieg über Ungarn doch an einer Rauferei. Allerdings hatte in erster Linie das 1:1-Unentschieden zwischen Italien und Spanien in einem weiteren Viertelfinalspiel für einen Skandal gesorgt. Ungeachtet seiner Klasse spielte Monti auch gern mal recht schmutzig. So bearbeitete er Spaniens Torhüter Ricardo Zamora derart, dass dieser beim Wiederholungsspiel am folgenden Tag nicht mehr auflaufen konnte. Die Quellen sind sich zwar uneinig darüber, ob drei oder vier Spanier verletzungsbedingt vom Platz mussten. Auf jeden Fall aber fühlten sich die Iberer verschaukelt, als Italien durch einen Flugkopfball Giuseppe Meazzas mit 1:0 gewann.
Der erwartete Wettstreit der Stile im Halbfinale wurde dann zu einem Reinfall. Monti nahm Sindelar komplett aus dem Spiel, Österreich schoss während der ersten 40 Minuten nicht einmal aufs Tor, und Italien gewann das Spiel mit dem Tor des Tages. Meazza ging dabei den für Hiden eingesprungenen Ersatztorwart Peter Platzer heftig an, und Enrique Guaita, ein weiterer Oriundo, drückte den herrenlosen Ball über die Linie.
So war es nun an der Tschechoslowakei, die im anderen Halbfinale Deutschland ausgeschaltet hatte, die Ehre der Donaustaaten zu verteidigen. Zeitweise ließen die Tschechoslowaken Italien tatsächlich alt aussehen und gingen in der 76. Minute durch Antonín Puč in Führung. František Svoboda traf noch den Pfosten, und Jiří Sobotka ließ eine weitere hochkarätige Chance aus, bevor Orsi neun Minuten vor Schluss der Ausgleich gelang. In der siebten Minute der Nachspielzeit flankte der humpelnde Meazza von rechts, und Angelo Schiavio, der später erklärte, vom „Mut der Verzweiflung“ getrieben worden zu sein, hämmerte den Ball an Josef Čtyřoký vorbei zum Siegtreffer ins Tor.
Italien – Österreich 1:0, WM-Halbfinale, San Siro, Mailand, 3. Juni 1934.
Mussolinis Italien hatte seinen so sehnsüchtig erhofften Sieg errungen, auch wenn die Methoden, mit denen man gewann, anderswo einen faden Beigeschmack hinterließen. „In der Mehrzahl der Länder hielt man die Weltmeisterschaft für ein sportliches Fiasko“, sagte der belgische Schiedsrichter John Langenus, „weil es neben dem Siegeswillen keinen sportlichen Gedanken gab und weil darüber hinaus ein ganz bestimmter Geist auf dem gesamten Wettbewerb lastete.“
Im November des gleichen Jahres trug ein Aufeinandertreffen zwischen Italien und England – die sogenannte „Schlacht von Highbury“ – dazu bei, diesen Eindruck weiter zu verfestigen. Nachdem sich Monti nach einem Zweikampf mit Ted Drake in der zweiten Minute den Fuß gebrochen hatte, fiel Italiens Reaktion überaus drastisch aus. „Was die Italiener angeht, hätte man während der ersten Viertelstunde gar keinen Ball auf dem Platz gebraucht“, sagte Stanley Matthews. „Die verhielten sich wie Besessene und traten auf alles und jeden ein, der sich bewegte.“ England konnte aus Italiens Disziplinlosigkeit Nutzen schlagen und führte bald mit 3:0. Nachdem Pozzo seine Mannschaft in der Halbzeitpause beruhigt hatte, spielte Italien dann aber mitreißend und verkürzte im zweiten Durchgang noch auf 2:3.
Unter ihrer aggressiven und schmutzigen Schale waren die Italiener indes fraglos begabt und verteidigten den Weltmeistertitel 1938 mit einer Mannschaft, die Pozzo für seine beste überhaupt hielt. Wiederum lag der Schwerpunkt auf einer stabilen Defensive. „Das größte Geheimnis der italienischen Auswahl ist ihre Fähigkeit, mit der geringstmöglichen Anzahl Männer anzugreifen, ohne die beiden Verteidiger jemals von ihrer Defensivaufgabe abzuziehen“, schrieb Zappa. Zu diesem Zeitpunkt war Österreich bereits von Deutschland „angeschlossen“ worden. Das aus den beiden Halbfinalisten von 1934 gebildete Team schnitt allerdings schwach ab und schied in der ersten Runde nach Wiederholungsspiel gegen die Schweizer unter Trainer Karl Rappan aus.
Die Tschechoslowakei musste im Viertelfinale gegen Brasilien die Segel streichen. Immerhin aber zog Ungarn ins Finale ein und bestritt dort die letzte Machtprobe zwischen dem Donaufußball und Pozzo. Dabei erwies sich Italien als zu schnell und zu athletisch. Michele Andreolo, ebenfalls Oriundo und Nachfolger Montis als Centro mediano, hielt Ungarns Mittelstürmer György Sárosi in Schach, und Meisls fußballerisches Konzept sah dementsprechend schwerfällig und antiquiert aus. Das Ende dieser Art von Fußball war besiegelt – jedoch nicht ohne Wehmut. „Wie wollen wir Fußball spielen?“, fragte der französische Journalist Jean Eskenazi. „Als ob wir Liebe machten oder als ob wir den Bus kriegen wollten?“
Andere faschistische Länder beschritten einen ganz ähnlichen Weg. In Spanien hatte der Fußball den gleichen Anfang genommen wie überall anders auch: Die Briten führten ihn ein. Genau genommen waren es Arbeiter in einer Bergbausiedlung in Minas de Riotinto im Südwesten Spaniens, die ihn einführten. Dort hatte ein britischer Investor namens Hugh Matheson 1873 für 3,5 Millionen Pfund eine kurz vor der Stilllegung stehende Mine gekauft. Die erste Rate wurde mit Goldmünzen bezahlt, die erst mit der Bahn und dann per Ochsenkarren transportiert werden mussten.
Das erste schriftlich überlieferte Spiel wurde 1887 zwischen zwei komplett aus Nichtspaniern bestehenden Mannschaften ausgetragen, auf einem heute unter einer riesigen Abraumhalde liegenden Platz. Es fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum Namenstag des Heiligen Rochus von Montpellier statt. Traditionell hätte das Unterhaltungsprogramm aus Stierkampf bestanden, doch hatte die Bergbaugesellschaft drei Jahre zuvor die Stierkampfarena abgerissen. Ihrer Meinung nach war die Arena zum Sammelpunkt für Prostituierte und Säufer verkommen. Der Legende zufolge sollte das Match der Verbrüderung der Briten mit den Spaniern dienen, als ein Sportereignis unter Beteiligung beider Seiten. Laut Jimmy Burns entsprach das allerdings überhaupt nicht der Wirklichkeit. Vielmehr bestätigte das Fußballspiel die Unterschiede zwischen Briten und Spaniern. „Man kann sich gut vorstellen, dass die einheimischen Zuschauer zunächst wenig damit anzufangen wussten. … Dem Spiel … fehlten sowohl die Kreativität als auch der Nervenkitzel, die die beliebteste einheimische Unterhaltung auszeichneten.“ In Spanien sind die historischen Entwicklungen von Fußball und Stierkampf von jeher eng miteinander verflochten gewesen.
Durch das britische Engagement im Bergbausektor kam der Fußball auch nach Bilbao. Erst dort sollte er wirklich Wurzeln schlagen. Das erste speziell zu diesem Zweck gebaute Fußballstadion in Spanien war das San Mamés, errichtet 1913 in Bilbao. Es wurde zur eigentlichen Wiege des spanischen Fußballs, der sich bald durch Härte und Vitalität auszeichnen sollte und geprägt war durch die Werte der britischen Fabrikarbeit.
Bilbaos Athletic Club, die erste Supermacht im spanischen Fußball, wurde 1903 aus einem vorübergehenden Zusammenschluss zweier bereits bestehender Teams gegründet. Das eine bestand aus britischen Arbeitern in der Stadt, das andere war von Studenten des Gymnasiums Zamacois ins Leben gerufen worden, die das Spiel beim Studium in England kennengelernt hatten. Der erste Cheftrainer war ein Engländer, Mr. Shepherd – wenig überraschend angesichts der Hochachtung, die der britische Fußball genoss. Obwohl schon bald die berühmte Vorschrift eingeführt wurde, dass nur Menschen baskischer Abstammung bei Athletic spielen durften, blieb der Klub anglophil. Finanziell gestützt wurde er von dem Industrie- und Schifffahrtskonglomerat De la Sota, das im Ersten Weltkrieg auch die Alliierten unterstützte, indem es seine Handelsbeziehungen während der Feindseligkeiten aufrechterhielt. Die englandfreundliche Gesinnung des Klubs kam auch in der englischen Schreibweise des Vereinsnamens zu tragen, außerdem engagierte man mit Vorliebe englische Trainer.
Auf Shepherd folgte 1914 Billy Barnes, der 1902 im FA-Pokalfinale das Siegtor für Sheffield United erzielt hatte und später noch für West Ham United, Luton Town und Queens Park Rangers aufgelaufen war. Barnes konnte zweimal die Copa del Rey gewinnen. Er ging dann zurück nach Großbritannien und meldete sich freiwillig zum Dienst im Ersten Weltkrieg. Im August 1920 kehrte er schließlich zu Athletic zurück. „Der baskische Fußball hat sich enorm weiterentwickelt, seit ich zum letzten Mal hier war“, ließ Barnes verlauten. „Als ich das erste Mal hier war, war Fußball ein langsames Geduldsspiel mit kurzen Pässen – schick anzusehen, aber total unpraktisch, im schottischen Stil eben. Ich habe bei Athletic ein schnelles Spiel mit langen Pässen eingeführt, bei dem der Ball von Flügel zu Flügel wandert und schnelle Spieler mit Torschussqualität im Zentrum stehen. Heute finde ich, dass die meisten Klubs in etwa so spielen. Aber Athletic ist von diesem Weg abgekommen.“
Noch im selben Monat sollte der von Athletic eingeführte Powerfußball bei den Olympischen Spielen 1920 zur nationalen Spielweise werden. Die Spanier fuhren ohne hohe Erwartungen nach Antwerpen. Ihr Kader bestand hauptsächlich aus Spielern der nordspanischen Vereine. Die waren nämlich das Spiel auf Rasen gewohnt, während die Teams aus Zentralspanien und dem Süden eher auf trockener, nackter Erde kickten. Die Spanier schlugen im ersten Spiel Dänemark mit 1:0, verloren dann aber im Viertelfinale mit 1:3 gegen die späteren Goldmedaillengewinner aus Belgien. Damit war das Turnier allerdings noch nicht vorbei. Nun musste man durch ein kompliziertes Trostrundenkonstrukt, das zum Wettbewerb um die Silbermedaille wurde. Die Tschechoslowakei war nämlich disqualifiziert worden, nachdem ihre Spieler im Finale aus Protest gegen die Leitung des Spiels durch den britischen Schiedsrichter vom Feld gestürmt waren.
Die Spanier schlugen Schweden mit 2:1 und Italien mit 2:0. Im Spiel um Silber warteten die Niederlande. Spanien gewann das Entscheidungsmatch mit 3:1, und Félix Sesúmaga gelang ein Doppelpack. Als Held jedoch kam ein anderer Baske zurück. In der Partie gegen die Schweden hatte Spanien zur Pause mit 0:1 hintengelegen. In der 51. Minute glückte den Iberern der Ausgleichstreffer durch José María Belauste, eine vom Kampf gezeichnete Persönlichkeit. Seine Nase war durch regelmäßige Schläge plattgedrückt, und die geschwollenen Ohren wurden nach hinten gebogen vom zusammengeknoteten Taschentuch, unter dem Belauste seinen beginnenden Haarausfall verbarg. Zwei Minuten später gelang Domingo Acedo das Siegtor. Trotzdem blieb es Belaustes Tor – das Tor, mit dem der Aufschwung eingeleitet wurde –, das die baskische Spielweise gewissermaßen repräsentierte. „Als das Spiel nach der Halbzeitpause wieder begann“, schrieb Manolo de Castro unter dem Pseudonym Handicap, „schien Spanien geschlossen einem Schlachtruf zu folgen und stürmte so heftig drauflos, dass es innerhalb von zwei Minuten einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze zugesprochen bekam.“ Belauste warf sich einem Lupfer in die Mitte hinterher und riss diverse Schweden mit sich, als er den Ball über die Linie bugsierte. In den Worten Handicaps war es „ein wahrlich herkulisches Tor“. Tags darauf verglich eine niederländische Zeitung Spaniens Fußball mit der grausamen Strategie, mit der spanische Truppen 1576 Antwerpen in Schutt und Asche gelegt hatten. Sie prägte dabei den Begriff La Furia, den die Spanier nur zu gerne übernahmen.
Das Tor wurde zur Geburtsstunde von La Furia hochstilisiert und maßlos aufgebauscht. Torwartlegende Ricardo Zamora verstieg sich später zu der Behauptung, dass Belauste den Ball auf der Brust ins Tor geschleppt habe, während sich vier Schweden in sein Trikot gekrallt hätten. Bald waren die Spanier der festen Überzeugung, dass ihr Fußball, La Furia, die einzig wahre Art zu spielen sei. Burns charakterisiert La Furia als „eine besonders kraftvolle und aggressive Spielweise, die gleichzeitig noch erfolgreich war. Zwar beanspruchten auf Vereinsebene die Basken eigentlich bereits eine Art Markenschutz für diesen Stil, dennoch wurde nun auch die Nationalmannschaft damit in Verbindung gebracht.“
Kaum war La Furia allgemein akzeptiert, wurden allerdings auch schon die Grenzen dieser Spielweise offenbar. Im Juni 1921 brach eine baskische Mannschaft mit einer Reihe spanischer Nationalspieler, einschließlich Belauste, zu einer Südamerikareise auf. Zunächst ging es nach Argentinien, wo man eine 0:4-Schlappe gegen eine Stadtauswahl aus Buenos Aires hinnehmen musste. Trotz ihres läuferischen Einsatzes waren die Basken nicht in der Lage, ihrem Gegner, der einen präzisen, flüssigen und technisch guten Fußball zeigte, den Ball streitig zu machen. Weiter ging es nach Rosario, Montevideo und São Paulo, wo die Basken überall Schwierigkeiten mit technisch beschlagenen Gegnern bekamen. Die acht Spiele der Reise endeten mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen.
Auch in Bilbao gab es Veränderungen. Barnes blieb zwar nur eine Saison, gewann aber in dieser Zeit noch einmal die Copa del Rey. Athletic suchte nun in England per Anzeigen in der Daily Mail und Sporting Life einen Nachfolger und entschied sich unter mehreren Hundert Bewerbern für einen gewissen Mr. Burton. Allerdings versagte nach nur zwei Monaten Tätigkeit dessen Lunge, die im Krieg durch Giftgas geschwächt worden war. Zwischenzeitlich leitete ein Stab aus dem Kapitän und zwei weiteren Spielern die Mannschaft, dann wurde Athletic durch Fred Pentland gerettet. Er sollte der am meisten verehrte aller britischen Trainer werden, die in der Zwischenkriegszeit in Spanien arbeiteten.
Pentland war der Sohn des Lord Mayor von Birmingham und hatte als Rechtsaußen in Blackburn, bei Queens Park Rangers und in Middlesbrough gespielt. Hinzu kamen fünf Einsätze für England. 1913 beendete Pentland seine Karriere als Spieler und ging nach Berlin, wo er Trainer der deutschen Olympiamannschaft wurde – nachdem Jimmy Hogan die Stelle ausgeschlagen hatte, um bei den Österreichern zu arbeiten. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Pentland im Gefangenenlager für Zivilisten in Ruhleben interniert, einer Trabrennbahn etwa zehn Kilometer westlich des damaligen Berlin. Anfangs waren die Bedingungen grauenhaft. Die Gefangenen mussten in von Läusen befallenen Pferdeboxen auf Stroh schlafen, hatten lediglich ein einziges Wasserrohr zum Waschen und trugen Holzpantoffeln und Mäntel, die ihnen großzügigerweise von Einheimischen gespendet worden waren. Die Tagesration bestand aus einer Kelle wässerigem Haferbrei und einem Stück Blutwurst.
Bald jedoch gestanden die deutschen Dienststellen den Internierten eine gewisse Autonomie zu. Eine komplett neue Lebensgemeinschaft wuchs heran, einschließlich Postdienst, Polizeikräften, Warenlager und Bücherei. Auf einem Plan des Lagers sind Tennisplätze, ein YMCA, ein Kasino, ein Postamt, ein Teehaus, Bürobaracken, Waschbaracken und zwei große Fußballplätze zu sehen. Es war, wie Barney Ronay es in Ausgabe drei des Fußballmagazins The Blizzard ausdrückte, „eine Hommage an die beherzte britische Art, sich selbst zu organisieren. Gleichzeitig kam darin die kreative kulturelle Mischung zum Ausdruck, die eine Folge des Empire ist, die angesichts seines zweifelhaften Vermächtnisses häufig gar nicht wahrgenommen wird.“
Die Einwohnerschaft war ausschließlich männlich, ansonsten aber von erstaunlicher Vielfalt. „Vom Herrenhaus bis zum Armenviertel: Es gab kaum eine Spezies oder Profession, die nicht vertreten gewesen wäre“, schrieb ein Internierter in einem kurz nach Kriegsende gedruckten Pamphlet. „Alle Mann waren in einem kleinen Stallhof zusammengepfercht – Betriebsleiter und Seeleute, Konzertmusiker und Fabrikarbeiter, Universitätsprofessoren und Jockeys. … Wir waren wahrlich eine bunt gemischte Truppe. Ich bin gemeinsam mit dem Earl of Perth (Spitzname: ‚Pearl of the earth‘), einem Farbigen und einem Feuerwehrmann zur Küche marschiert.“
Das Lager war voller großer Persönlichkeiten und Exzentriker. Da waren F. Charles Adler, ein Dirigent von Weltruf und Schüler Gustav Mahlers, ferner Sir James Chadwick, Physiker und Nobelpreisträger, der als Erster die Idee einer Atombombe entwickelte, und Prince Monolulu, Tipster für Pferderennen und der wohl bekannteste dunkelhäutige Promi im damaligen Großbritannien. Ebenfalls interniert waren „Bertie“ Smylie, der dem Alkohol verfallene und gewöhnlich Sombrero tragende Herausgeber der Irish Times, und schließlich Geoffrey Pyke, der den Flugzeugträger aus Eis erfunden und diesen einst in seinem Badezimmer Winston Churchill vorgeführt hatte.
Außerdem gab es neben Pentland eine bemerkenswerte Zahl weiterer Fußballspieler, aktive wie ehemalige. Dazu zählten Steve Bloomer, Pentlands ehemaliger Mitspieler bei Middlesbrough, der in seinen 23 Partien für England 28-mal getroffen hatte und im Juli 1914 zum Trainer von Britannia 92 Berlin ernannt worden war; Verteidiger Sam Wolstenholme, ehemaliger Mitspieler Pentlands bei den Blackburn Rovers und seit Frühjahr 1914 Cheftrainer der Auswahl des Norddeutschen Fußball-Verbands; Fred Spiksley, ehemaliger Linksaußen von Sheffield Wednesday, der als Trainer noch die Landesmeisterschaften in Schweden und Deutschland (1927 mit dem 1. FC Nürnberg) gewinnen sollte, nachdem ihm das 1911 bereits in Mexiko gelungen war; John Cameron, Trainer beim Dresdner SC und vormaliger schottischer Nationalspieler und Spielertrainer von Tottenham Hotspur; John Brearley, der unter Cameron bei den Spurs gespielt und den Trainerposten bei Viktoria 89 Berlin übernommen hatte; und schließlich der deutsche Nationalspieler Edwin Dutton, dessen Eltern von South Shields in Nordengland nach Deutschland ausgewandert waren.
Befreit von den normalen Zwängen des Lebens, begannen die Gefangenen, sich weiterzubilden, und ließen dabei den Spaß nicht zu kurz kommen. „Die Aktivitäten wurden so sehr ausgeweitet, verbessert, vielgliedrig gemacht und verfeinert, bis aus Ruhleben eine eigene Welt wurde“, schrieb der Journalist Israel Cohen, ebenfalls ein Insasse. „Das war unumgänglich, wenn wir fit bleiben und uns vor Langeweile und Trägheit schützen wollten.“ Es gab Kurse in Analysis, Elementarphysik, anorganischer und organischer Chemie, über Radioaktivität, in Vererbungslehre, Biologie, Musik, Literatur, darunter Kurse zu deutscher Literatur (auf Deutsch), italienischer Literatur (auf Italienisch), über Shakespeare und über Euripides. Man gründete ein Theater mit einem Berufsorchester und zog Music-Hall-Shows auf, wobei die Darsteller von Frauen besondere Popularität genossen.
Nur einen Tag nach Eröffnung des Lagers hatte man bereits erstmals zum Spaß gekickt, und innerhalb von zwei Wochen waren Mannschaften namens Tottenham Hotspurs, Manchester Rangers und Bolton Wanderers entstanden. „Es gab nur einen einzigen Fußball, und der war nicht besonders robust“, erinnerte sich Cohen. Die Tore wurden mittels „aufgetürmter Jacken“ markiert. Lagerkommandant General von Kessel missbilligte das Fußballspielen, und mit Anbruch des Winters wurde der boomende Ligabetrieb ausgesetzt. Bis zum Frühjahr indessen scheint von Kessel seine Meinung geändert zu haben. Er stellte eine freie Fläche neben dem Lager zur Verfügung, auf der zwei Spielfelder abgekreidet wurden. Pentland, Bloomer und Cameron gründeten die Ruhleben Football Association, ihren eigenen Fußballverband. Die erste Partie nach deren Regeln fand am 29. März 1915 zwischen Ruhleben mit Kapitän Bloomer und „dem Rest“ mit einem gewissen Mr. Richards als Mannschaftsführer statt.
„Die Form in diesem Spiel war so gut, dass jedermann sehen konnte, dass der Fußball mit etwas Training ein recht hohes Niveau erreichen kann“, berichtete die Lagerzeitung. Am 2. Mai trat eine Englandauswahl mit Pentland, Wolstenholme und Bloomer gegen eine Weltauswahl mit Cameron als Kapitän an. Jede der 14 Baracken stellte zwei Teams für eine Liga, die so heiß umkämpft war und so begeistert verfolgt wurde, dass Zuschauerzahlen von über 1.000 nicht ungewöhnlich waren.
Im September 1915 brachte die Ruhleben Football Association ihr Handbuch heraus. „Unter großen Kosten und Mühen“ in Berlin gedruckt, kam es auf 48 Seiten und enthielt Spielerbiografien, Interviews mit Kapitänen und etwas Taktikdiskussion. Ronay schrieb: „Es war auf seine eigene Art ein Novum, war es doch das erste Mal, dass etwas geschrieben wurde, das einem Trainingshandbuch oder einem taktischen Leitfaden nahekam. Es war das Destillat des kopflastigen Intellektualismus der multidisziplinären Schule von Ruhleben. Die Ruhleben FA war vom literarischen Bazillus infiziert worden. Das Handbuch lässt erahnen, was die Folge hätte sein können, wenn der englische Fußball auch nur einen Funken des wilden Fortschrittsgeists, der zu den Spitzenzeiten in Ruhleben herrschte, übernommen hätte.“
Pentland lernte das Kurzpassspiel zu schätzen, mit dem er vermutlich schon in Blackburn in Berührung gekommen war. Doch Ronay stellt fest, dass es dafür kaum einen Beleg gibt und dass es mindestens ebenso wahrscheinlich ist, dass er in Ruhleben zu seinen Schlussfolgerungen über die richtige Spielweise im Fußball gekommen war. Die dortige Kultur förderte das Infragestellen alter Gepflogenheiten. Zudem gab es nur geringen Ergebnisdruck und keine Zuschauermassen, die lautstark forderten, den Ball nach vorne zu bolzen.
Nach dem Krieg kehrte Pentland nach Großbritannien zurück. Während seines Erholungsaufenthalts im Südwesten Englands heiratete er seine Krankenschwester, eine Kriegswitwe, die im Voluntary Aid Detachment tätig war. Allerdings ging Pentland schon bald wieder zurück auf den Kontinent und betreute die französische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1920. Nach einem Sieg gegen Italien im Viertelfinale unterlagen die Franzosen den Tschechoslowaken im Halbfinale und waren schon längst wieder daheim, als die Tschechoslowakei disqualifiziert wurde. So konnten sie nicht mehr um die Silbermedaille mitspielen, die am Ende von Spanien errungen wurde.
Danach zog es Pentland nach Spanien, zunächst zu Racing Santander und dann, angelockt von einem Monatsgehalt von 10.000 Peseten, zu Athletic Bilbao. Bei seiner ersten Trainingseinheit brachte er den Spielern zunächst bei, wie sie ihre Schuhe richtig schnürten: „Macht die einfachen Dinge richtig, und der Rest kommt von allein“, sagte er. Pentland schaffte die langen Bälle ab, auf die Barnes so stolz gewesen war, und trainierte stattdessen Kurzpassspiel. Auch wenn die Spielweise immer noch von der Entschlossenheit von La Furia geprägt sein mochte, war es ein Fußball, der überlegter und weniger druckvoll gespielt wurde. Pentland rauchte beim Training Zigarren und weigerte sich, seine Kleidung dem Klima anzupassen. Eine Fotografie von 1928 in El Norte Deportivo zeigt ihn mit ernstem Gesicht in einem schweren Mantel mit tadellos gefaltetem Taschentuch, um den Hals eine gepunktete Krawatte. Hinter seinem Oberlippenbart und seinem eisernen Blick lässt sich der Anflug eines ironischen Lächelns erkennen. Auf dem Kopf befindet sich selbstverständlich sein Markenzeichen, die Melone, die ihm auch seinen Spitznamen El Bombín bescherte. Pentland war eigenwillig und anspruchsvoll – und er hatte grandiosen Erfolg.
Athletic spielte mit leicht zurückgezogenen Halbstürmern und wurde unter Pentland zweimal in Folge baskischer Meister. Hinzu kam 1923 die Copa del Rey. Die Spieler von Athletic feierten ihre großen Erfolge, indem sie Pentland den Hut vom Kopf rissen und dann dar auf herumsprangen, bis er kaputt war. „Du hast nur noch drei Minuten, Melone!“, soll Pentland angeblich kurz vor Ende des Finales in der Copa del Rey gerufen haben.
Der Mann mit der Melone: Fred Pentland. Er führte bei Athletic Bilbao das Kurzpassspiel ein.
1925 ging Pentland zu Athletic Madrid (die Schreibweise Atlético wurde erst 1941 eingeführt) und führte den Klub ein Jahr später ins Finale der Copa del Rey. Danach wechselte er für eine Saison zu Real Oviedo und hinterher wieder zurück zu Athletic Madrid, wo er 1927 den Campeonato del Centro gewann, die Meisterschaft Zentralspaniens. Als England 1929 zum Spiel im Estadio Metropolitano in Madrid anreiste, war Pentland als Berater von Nationaltrainer José María Mateos tätig und trug seinen Teil zur Strategie beim 4:3-Erfolg der Spanier bei – Englands erster Niederlage gegen einen Gegner vom Kontinent. Noch im Laufe des Jahres 1929 wechselte Pentland von Madrid wieder nach Bilbao. Als er 1933 nach Madrid zurückkehrte, hatte er zwischenzeitlich zwei spanische Meisterschaften gefeiert, außerdem vier weitere Mal die Copa del Rey gewonnen und drei weitere Baskenland-Meisterschaften geholt. Zudem war er beim 12:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Barcelona dabei gewesen, bis heute Barças höchste Niederlage überhaupt.
Kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs verließ Pentland 1936 Spanien, arbeitete kurz als Assistenztrainer beim FC Brentford und trat dann beim AFC Barrow seinen einzigen Posten als Cheftrainer in England an. Wie so viele Pioniere der frühen Jahre – vor allem Jimmy Hogan – erfuhr Pentland in der Heimat keine Anerkennung. Bei Athletic Bilbao dagegen genießt er bis heute große Achtung als der Mann, der den Verein groß gemacht hat. 1959 wurde er für ein Abschiedsspiel gegen Chelsea noch einmal nach Bilbao eingeladen, wo er eine Medaille als Ehrenmitglied überreicht bekam. Als Pentland drei Jahre später starb, hielt Athletic im San Mamés eine Trauerfeier für ihn ab.
William Garbutt setzte die englische Tradition in Bilbao fort. Zuvor hatte er in Italien beim FC Genua und beim SSC Neapel Erfolge gefeiert. 1935/36 gewann er mit Bilbao die spanische Meisterschaft, ging aber bei Ausbruch des Bürgerkrieges zurück nach Italien. Der Sieg Francos hatte gravierende Folgen für Athletic. Der Verein wurde gezwungen, seinen Namen in Atlético zu ändern und die Politik aufzugeben, nur Basken aufzunehmen. Dennoch hasste Franco den Klub nicht etwa, ganz im Gegenteil. Bevor Real Madrid in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die Vorherrschaft in Europa übernahm, war Atlético Bilbao sogar seine Lieblingsmannschaft.
Francos Haltung gegenüber den Basken war komplex. Zwar wollte er von einer baskischen Nation nichts wissen, dennoch waren er und andere der politischen Rechten überzeugt, dass die Wurzeln des „echten Spaniens“ im Baskenland lagen. Dieses „echte Spanien“ war untrennbar verbunden mit Katholizismus sowie Spaniens Geschichte als Weltreich und dem Überleben in feindlicher Umgebung. Man sah die Basken als Teil der spanischen Kriegerkaste, deren Grundwerte, in den Worten von Burns, „durch und durch männlich waren, nämlich Tapferkeit, Selbstaufopferung, Gehorsam gegenüber der Obrigkeit sowie Ehrgefühl“.
Diese Werte entsprachen auch den Erziehungsidealen des Jesuitenordens, den der baskische Ritter Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert gegründet hatte. Wie an den englischen Public Schools galt auch an den Jesuitenschulen Sport als Mittel zur Charakterbildung. An solch einer Schule entdeckte Rafael Moreno Aranzadi, besser bekannt unter dem Namen „Pichichi“, das „Entlein“, die Liebe zum Fußball. Wie Belauste spielte auch er mit einem zusammengebundenen Taschentuch auf dem Kopf. Pichichi war erfolgreicher Torjäger bei Athletic und ein Held der Olympiamannschaft von 1920. Trotzdem lag es weniger an seinen Torjägerqualitäten, dass die Sportzeitung Marca, die von Anfang an auf Francos Linie war, beschloss, die Auszeichnung für den Torschützenkönig in der spanischen Liga nach ihm zu benennen, als sie den Preis 1953 ins Leben rief. Grund war vielmehr, dass Pichichi die katholisch-baskische Seite des Spanischen verkörperte. Während Franco also das baskische Nationalbewusstsein auslöschen wollte, vergötterte er baskische Fußballer geradezu als den Inbegriff alles Spanischen. Die Furia Española wurde zu neuem Leben erweckt, nur dass sie dieses Mal mit dem Geist der Diktatur durchtränkt wurde.
Nirgends wurde das so deutlich wie am Beispiel von Athletic Madrid, das 1939 mit Aviación Nacional fusionierte, einer während des Bürgerkriegs von Angehörigen der Luftwaffe ins Leben gerufenen Mannschaft. Angesichts der Tatsache, dass Athletic mit einem riesigen Schuldenberg kämpfte und acht Spieler im Krieg umgekommen waren, besaß die Fusion eine gewisse Logik. Trotzdem war eine Vielzahl von Athletic-Fans entsetzt. Schließlich war der Verein von Basken gegründet worden, als Madrider Ableger von Athletic Bilbao. Außerdem war es der Klub der Außenseiter, nicht der Klub des Establishments. Die Spielphilosophie des Vereins wurde geändert, um seine neue Führung durch das Militär widerzuspiegeln. So kritisierte ein General 1939/40 in der ersten Saison nach dem Neustart der Liga Athletics Trainer Ricardo Zamora wie folgt: „Was dieser Mannschaft fehlt, sind Eier, richtige Eier. … Die Mannschaft muss mehr rennen und alles auf den Gegner werfen. … Ein Trainer braucht ein bisschen Mumm, muss Disziplin erzwingen, ab und zu die Peitsche rausholen.“ Ganz offensichtlich schaffte Zamora es, die nötigen „Eier“ einzupflanzen. Athletic Aviación de Madrid holte in jener Saison die Meisterschaft und konnte den Titel im Jahr darauf verteidigen.
In der Tat entsprach La Furia in gewissem Grad dem Geist der Diktatur und wurde als Teil der Propaganda von Francos Erneuerung Spaniens beworben; als Teil einer Tradition, in deren Rahmen die Moslems aus Granada vertrieben, die Konquistadoren über den Atlantik aufgebrochen waren und für die Don Quixote als Musterbeispiel spanischer Kompromisslosigkeit vereinnahmt worden war. „Die Furia Española findet sich in sämtlichen Facetten des Lebens in Spanien wieder, so deutlich wie noch nie“, hieß es 1939 in einem Kommentar in der falangistischen Zeitung Arriba. „Im Sport zeigt sich La Furia am klarsten beim Fußball, einer Sportart, in der sich die Männlichkeit der spanischen Rasse voll entfalten kann und in Länderwettkämpfen gewöhnlich ihren Stempel gegenüber technisch stärker versierten, jedoch weniger angriffslustigen Mannschaften fremder Länder aufdrückt.“ Genau wie im Italien Mussolinis wurde Fußball auch im Spanien Francos zu einer kriegerischen Betätigung.
Da Sindelars Karriereende näherrückte und auch Meisl nicht jünger wurde, hätte der Fußballstil der Donauländer wohl ohnehin bald der Vergangenheit angehört. Die politischen Ereignisse nahmen das Ende dann abrupt vorweg. Mit dem Anschluss Österreichs an Deutschland war nicht nur das Schicksal der mitteleuropäischen jüdischen Intellektuellen besiegelt, sondern auch das der Kaffeehaus-Kultur sowie von Matthias Sindelar. Bereits im Verlauf der 1930er Jahre hatte sich der große Mittelstürmer zunehmend von der Nationalmannschaft zurückgezogen, auch wenn er sich noch für das sogenannte „Verbrüderungsspiel“ zwischen einer Auswahl der Ostmark, also des ehemaligen Österreichs, und einer deutschen Mannschaft am 3. April 1938 berufen ließ.
Der Fußball in Deutschland war zwar noch nicht so weit wie in Österreich, doch er war auf einem guten Weg. Otto Nerz, der am 1. Juli 1926 zum ersten Reichstrainer ernannt worden war, gehörte zu den frühen Befürwortern des W-M-Systems. Jimmy Hogans Lehren lebten jedoch bei Schalke 04 weiter, das zwischen 1933 und 1942 zehn Endspiele um die Deutsche Meisterschaft erreichte und sechs davon gewann. Schalkes Trainer Gustav Wieser war Österreicher und ließ eine als „Schalker Kreisel“ bekannte Variante des Scheiberlns spielen. Dem Verteidiger Hans Bornemann zufolge wurde die Angriffsrichtung dabei nicht durch den ballführenden Mann bestimmt, sondern durch die nicht in Ballbesitz befindlichen Spieler, die in die freien Räume liefen. „Erst wenn absolut keiner mehr übrig war, zu dem man den Ball hätte abspielen können, schossen wir ihn rein“, sagte er. Vielleicht hätte Hogan ihren Stil bewundert, ihr Ethos aber hätte er für fragwürdig befunden.
In jedem Falle war der ausschweifende Stil der Schalker Otto Nerz ein Dorn im Auge. Er weigerte sich, Schalkes gefeierten Halbstürmer Ernst Kuzorra in die Nationalmannschaft zu berufen. Fritz Szepan wiederum nominierte er zwar für die WM 1934, stellte ihn aber zur Verwirrung aller auf der Mittelläuferposition und nicht wie üblich als Halbstürmer auf. Kuzorra erzählte es so: „Nerz sagte zu mir: ‚Ich sag Ihnen mal was. Ihr Klein-Klein-Fußball bei Schalke, das ganze Ballgeschiebe, das interessiert mich kein Stück. Wenn Sie und Szepan zusammenspielen, wird das nur Rumgefummel und Rumgedribbel.‘“
Der Schalker Fritz Szepan mit Sepp Herberger. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Nerz orientierte Herberger sich mehr am Donaufußball.
Dass man das Halbfinale bei der WM in Italien 1934 erreicht hatte, nährte die Hoffnung, 1936 bei den Olympischen Spielen im eigenen Land die Goldmedaille zu gewinnen. Stattdessen kassierten die Deutschen eine peinliche 0:2-Schlappe gegen Norwegen. Unglücklicherweise für Nerz war dies das einzige Fußballspiel, das Hitler jemals besuchte.
Nerz’ Assistent Sepp Herberger, der die Bundesrepublik Deutschland 1954 zum Gewinn der Weltmeisterschaft führen sollte, wohnte dem Spiel nicht bei. Er sah sich vielmehr das Viertelfinale zwischen Italien und Japan an. Als Herberger im Mannschaftsquartier gerade sein Abendessen – Eisbein mit Sauerkraut – verdrückte, überbrachte ihm ein anderer Trainer die Nachricht von der Niederlage Deutschlands. Herberger schob seinen Teller beiseite und rührte nie wieder ein Eisbein an.
Einige Zeit nach dem Turnier wurde er zu Nerz’ Nachfolger ernannt und ging sofort zu einem stärker am Donaufußball orientierten Spiel über. Dazu holte er Adolf Urban und Rudi Gellesch von Schalke 04 in die Mannschaft und beorderte den eleganten und recht trinkfesten Halbstürmer Otto Siffling von Waldhof Mannheim auf die Mittelstürmerposition. Dadurch erlangte die Mannschaft eine deutlich größere Flexibilität, die am 16. Mai 1937 beim 8:0-Sieg gegen Dänemark in Breslau ihren Höhepunkt erreichte. „Der Roboterstil, den die Leute Deutschland so gerne anhängen, wurde ins Reich der Legenden verbannt“, schrieb der Journalist Gerd Krämer. „Die Fußballkunst triumphierte.“
Allerdings waren die Deutschen bei Weitem noch nicht so begabt oder kunstfertig wie die Österreicher, und die Ostmark dominierte auch das Verbrüderungsspiel. Die spätere Mythenbildung mag die Tatsachen etwas verschleiert haben. Gewiss ist jedoch, dass Sindelar in der ersten Halbzeit eine Reihe von Chancen ungenutzt ließ. Angesichts der Regelmäßigkeit seiner knapp neben dem Pfosten vorbeirollenden Schüsse wurde selbst in zeitgenössischen Berichten die Frage aufgeworfen, ob er sich über die Deutschen – und einen möglichen Befehl, keine Tore zu erzielen – lustig machen wollte, indem er absichtlich daneben zielte. Mitte der zweiten Halbzeit verwertete Sindelar schließlich einen Abpraller, und als sein Freund Schasti Sesta einen Freistoß mittels Bogenlampe zum zweiten Treffer nutzte, feierte er diesen mit einer kleinen Tanzeinlage vor der mit Nazigrößen besetzten Ehrentribüne.
In den folgenden Monaten lehnte es Sindelar, der nie einen Hehl aus seinen Sympathien für die Sozialdemokraten machte, wiederholt ab, für Sepp Herbergers vereinte „großdeutsche“ Mannschaft zu spielen. Im August 1938 kaufte er das Café von Leopold Drill, einem Juden, der den Betrieb unter massivem Druck der Nazis hatte aufgeben müssen. Je nachdem, welcher Darstellung man Glauben schenken will, waren die von Sindelar gezahlten 20.000 Mark entweder ein fairer Preis oder auf schändlichste Weise opportunistisch. Für seinen Widerwillen, nationalsozialistische Plakate aufzuhängen, zog er sich zwar die Missbilligung der Behörden zu. Sindelar dem Widerstand zuzurechnen, wie dies manche getan haben, würde jedoch zu weit gehen.
Am Morgen des 23. Januar 1939 brach sein Freund Gustav Hartmann auf der Suche nach Sindelar die Tür seiner Wohnung in der Annagasse auf. Er fand ihn tot und unbekleidet neben der bewusstlosen Camilla Castagnola, die seit gerade einmal zehn Tagen seine Lebensgefährtin gewesen war. Sie starb später im Krankenhaus. Beide fielen einer durch einen defekten Ofen hervorgerufenen Kohlenmonoxidvergiftung zum Opfer. Zumindest war dies die Darstellung der Polizei, als sie zwei Tage darauf ihre Untersuchungen einstellte. Der Staatsanwalt allerdings war auch sechs Monate später noch zu keinem Ergebnis gekommen. Nichtsdestotrotz befahlen die nationalsozialistischen Behörden, den Fall zu schließen.
In einer 2003 produzierten Dokumentation der BBC behauptete Egon Ulbrich, ein Freund Sindelars, dass ein Kommunalbeamter bestochen worden sei, um den Tod als Unfall zu den Akten zu legen. Dadurch wäre sichergestellt gewesen, dass Sindelar ein Staatsbegräbnis erhielt. Das war nicht der einzige Erklärungsversuch. Am 25. Januar 1939 behauptete ein Artikel in der österreichischen Kronen Zeitung, dass alles darauf hindeute, dass Sindelar Opfer eines Mordes durch Vergiften geworden sei. In seinem Gedicht „Auf den Tod eines Fußballspielers“ äußerte Friedrich Torberg den Verdacht, dass es sich auch um den Selbstmord eines von der „neuen Ordnung“ abgelehnten Mannes gehandelt haben könnte. Später wurde kolportiert, dass Sindelar oder Castagnola oder sogar beide Juden gewesen seien.
Nun stimmt es zwar, dass Sindelar für Austria Wien, den Verein des jüdischen Bürgertums, gespielt hatte. Auch stammte er aus Mähren, von wo aus zahlreiche Juden nach Wien umgesiedelt waren. Seine Familie jedoch war katholisch. Es ist auch gut vorstellbar, dass die Italienerin Castagnola jüdische Wurzeln gehabt haben könnte. Dann allerdings müsste sie diese so gut versteckt haben, dass sie in der Woche vor ihrem Tod trotzdem die Genehmigung erhielt, Miteigentümerin einer Kneipe zu werden. Vielsagend aber ist, dass sich Nachbarn einige Tage zuvor über einen schadhaften Schornstein in dem Mietshaus beschwert hatten.
Die verfügbaren Indizien sprechen dafür, dass es sich bei Sindelars Tod um einen Unfall handelte, und doch überwiegt das Gefühl, dass Helden nicht einfach einen ganz alltäglichen Tod sterben können. Es passt einfach zu gut ins Bild eines jeden romantischen Freidenkers, dass dieser Sportkünstler, dieser Liebling der Wiener Gesellschaft, Seite an Seite mit seiner jüdischen Freundin im Österreich der Nazizeit vergast worden ist. „Der brave Sindelar folgte der Stadt, deren Kind und Stolz er war, in den Tod“, schrieb Polgar in seinem Nachruf. „Er war so verwachsen mit ihr, dass er sterben musste, als sie starb. Aus Treue zur Heimat – alles spricht dafür – hat er sich umgebracht: Denn in der zertretenen, zerbrochenen, zerquälten Stadt leben und Fußball spielen, das hieß, Wien mit einem abscheulichen Gespenst von Wien betrügen. … Aber kann man so Fußball spielen? Und so leben, wenn ein Leben ohne Fußball keines ist?“
Auch an seinem Ende blieb der Kaffeehaus-Fußball heldenhaft romantisch.