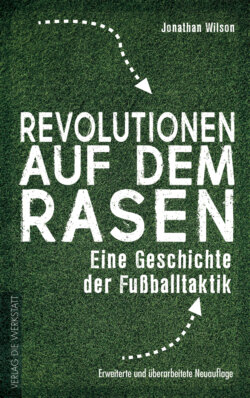Читать книгу Revolutionen auf dem Rasen - Jonathan Wilson - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеProlog
Eine Tapas-Bar im Bairro Alto in Lissabon an jenem Abend, an dem England bei der EM 2004 die Schweiz mit 3:0 geschlagen hatte. Der Rioja floss in Strömen. Eine internationale Gruppe von Journalisten diskutierte, ob Sven-Göran Erikssons Entscheidung, bei einem klassischen 4-4-2 zu bleiben, richtig gewesen sei oder ob er besser mit der eigentlich erwarteten Mittelfeldraute hätte spielen sollen. „Ach, das ist doch egal!“, wandte ein englischer Kollege ein. „Das sind doch die gleichen Spieler. Das System ist doch unwichtig. Es lohnt sich überhaupt nicht, darüber zu schreiben.“
Seinen Worten folgte ein Aufschrei der Entrüstung. Ich hob einen Finger, um ihm unmissverständlich deutlich zu machen, dass Leuten wie ihm das Fußballgucken verboten werden sollte, vom Sprechen darüber ganz zu schweigen. Doch ein Argentinier zog meinen Arm in wahrscheinlich kluger Voraussicht wieder herunter. „Das System ist das Einzige, was zählt“, sagte er. „Es lohnt sich überhaupt nicht, über irgendetwas anderes zu schreiben.“
Ganz plötzlich war für einen kurzen Moment die größte Schwäche des englischen Fußballs offengelegt. Beim Fußball geht es nicht um Spieler, oder jedenfalls nicht ausschließlich um Spieler. Es geht vielmehr um Gestaltung und Räume, um das Spielsystem und wie sich die Spieler darin bewegen. (Ich sollte an dieser Stelle vielleicht verdeutlichen, dass ich mit „Taktik“ eine Kombination aus Formation und Spielweise meine. Ein 4-4-2 kann genauso unterschiedlich sein wie die beiden Mittelfeldspieler Steve Stone aus England und Ronaldinho aus Brasilien.) Ich hoffte, dass der Argentinier nur Eindruck machen wollte und deshalb übertrieb. Schließlich tragen Einsatz, Wille, Kondition, Kraft, Tempo, Leidenschaft und Können ebenfalls ihren Teil bei. Doch trotz alledem gibt es auch einen theoretischen Aspekt, mit dem sich die Engländer – auch in anderen Sportarten – nur ungern befassen.
Das ist eine Schwäche, die mich frustriert. Doch dies soll keine Polemik über den englischen Fußball werden. Ich glaube nicht unbedingt, dass der englische Fußball dem Untergang geweiht ist. Obwohl am Ende Hohn und Spott auf Sven-Göran Eriksson einprasselten, muss man doch bedenken, dass es bisher lediglich Alf Ramsey geschafft hat, England bei drei aufeinanderfolgenden internationalen Turnieren bis ins Viertelfinale zu führen. Erst die Geschichte wird zeigen, ob die verpasste Qualifikation für die EM 2008 nur eine Momentaufnahme oder der Anfang eines längeren Niederganges war. Unter Fabio Capello jedenfalls qualifizierte England sich problemlos für die WM 2010, legte in Südafrika allerdings eine Bauchlandung hin. Seither hat sich das Muster aus ungefährdeter Qualifikation für ein großes Turnier und anschließendem Misserfolg fest etabliert, sieht man von der WM 2018 in Russland ab.
Schaut man sich dagegen Uruguay oder Österreich an, weiß man, wie ein Niedergang aussieht (selbst wenn man die von Oscar Washington Tabárez inspirierten positiven Leistungsausschläge in den Jahren 2010 und 2011 berücksichtigt). Oder Schottland: Da glauben die Leute immer noch, eine Fußballgroßmacht zu sein. Ganz zu schweigen von Ungarn, jener Mannschaft, die 1953 den englischen Traum von der eigenen Überlegenheit zerstörte. Als im November 2006 mit Ferenc Puskás der seinerzeit beste Spieler dieser ruhmreichen Truppe verstarb, war Ungarn schon fast aus der Top 100 der FIFA-Weltrangliste gerutscht. Das ist Niedergang.
Englands damalige 3:6-Niederlage gegen Ungarn in Wembley markierte einen Wendepunkt. Erstmals verlor England zu Hause gegen einen Gegner vom europäischen Festland. Vor allem die Art und Weise der damals kassierten Klatsche hatte mit der Vorstellung aufgeräumt, dass England nach wie vor die Welt regieren würde. „Die Geschichte des britischen Fußballs und der Herausforderung durch das Ausland“, so schrieb der bekannte Fußballjournalist und -schriftsteller Brian Glanville in seinem als Reaktion auf die Niederlage entstandenen Buch Soccer Nemesis, „ist die Geschichte einer riesigen Überlegenheit, die durch Dummheit, Kurzsichtigkeit und mutwillig aufgesetzte Scheuklappen vernichtet wurde. Es ist eine Geschichte von auf schändliche Weise vergeudetem Talent, von unglaublicher Selbstgefälligkeit und unendlicher Selbsttäuschung.“ Und genau so war es.
Nichtsdestotrotz wurde England 13 Jahre später Weltmeister. Seine riesige Überlegenheit mochte zwar verspielt worden sein, aber England gehörte immer noch zu den großen Fußballnationen. Ich glaube kaum, dass sich während des letzten halben Jahrhunderts viel daran geändert hat. Es mag schon sein, dass wir vor großen Turnieren gern zu euphorisch sind, und umso mehr sind wir dann von einem Ausscheiden im Viertelfinale enttäuscht. Dennoch gehört England nach wie vor zu den acht bis zehn Mannschaften, die eine realistische Chance auf den Sieg bei einer Welt- oder Europameisterschaft besitzen – trotz gelegentlicher Überraschungssieger wie Dänemark oder Griechenland.
Es bleibt jedoch die Frage, weshalb England seit 1966 keinen dieser Titel gewinnen konnte. Möglicherweise könnte eine besser koordinierte Jugendförderung helfen oder eine stärkere Berücksichtigung von Technik und taktischer Disziplin. Vielleicht würde auch eine Begrenzung der Zahl ausländischer Spieler in der Premier League Englands Chancen verbessern. Vorschläge dieser Art gibt es viele. Dennoch gleicht der Weg zum Erfolg dem sprichwörtlichen Fischen im Trüben. Das Glück bleibt ein entscheidender Faktor im Fußball. Eine Sieggarantie gibt es nie. Das gilt insbesondere für die sechs oder sieben Spiele bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft.
Einige meinen, dass der Sieg bei der WM 1966 das Schlimmste war, was dem englischen Fußball passieren konnte. So vertritt Autor Rob Steen in The Mavericks die Auffassung – ähnlich wie David Downing in seinen Büchern über Englands Rivalität mit Argentinien und Deutschland –, dass dieser Erfolg England zurückwarf. Er habe tief im fußballerischen Bewusstsein der Engländer die Ansicht zementiert, dass die Spielweise der Mannschaft Alf Ramseys der einzige Weg zum Erfolg sei. Da ist sicherlich etwas dran.
Mir scheint jedoch, dass weniger die englische Spielweise unter Ramsey an sich das Problem ist, sondern vielmehr, dass sie für Generationen von Fans und Trainern in England die einzig „richtige“ Spielweise darstellte. Nur weil etwas unter bestimmten Umständen, mit bestimmten Spielern und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung des Fußballs richtig war, heißt das keineswegs, dass es dies für alle Zeiten ist. Hätten die Engländer 1966 versucht, wie Brasilien zu spielen, hätten sie das Turnier auch so beendet wie Brasilien, das von körperlich aggressiveren Gegnern in der Gruppenphase nach Hause geschickt worden war. Ja, es wäre ihnen noch schlimmer ergangen, weil sie technisch viel limitierter waren als die Brasilianer.
Alle langfristig erfolgreichen Trainer teilen die Fähigkeit, sich immer weiterzuentwickeln – so wie Sir Alex Ferguson, Walerij Lobanowskyj, Bob Paisley oder Boris Arkadiew. Auch wenn ihre Mannschaften ganz unterschiedlich spielten, wussten doch alle diese Trainer genau, wann es an der Zeit war, eine Erfolgsstrategie aufzugeben und eine neue einzuführen. Damit möchte ich deutlich machen, dass ich nicht an eine „richtige“ Spielweise glaube. Natürlich kann ich mich unter emotionalen und ästhetischen Gesichtspunkten mehr für das Kurzpassspiel von Arsène Wengers FC Arsenal erwärmen als für den Pragmatismus von José Mourinhos FC Chelsea. Das ist jedoch meine persönliche Vorliebe und soll nicht heißen, dass das eine richtig und das andere falsch ist.
Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass zwischen Theorie und Praxis Kompromisse gefunden werden müssen. Auf der theoretischen Ebene werde ich eher von Lobanowskyjs Dynamo Kiew oder Fabio Capellos AC Mailand inspiriert. Auf dem Platz jedoch, als ich an der Universität zwei Jahre lang für die Unimannschaft – oder zumindest für deren zweite und dritte Mannschaft – gegen den Ball trat, spielten wir hochgradigen Zweckfußball. Wir waren nicht besonders gut und holten aus dem verfügbaren Spielermaterial wahrscheinlich das Beste heraus. Ich vermute zwar, dass wir einen ästhetisch ansprechenderen Fußball hätten spielen können. Allerdings glaube ich nicht wirklich, dass dies während der bierseligen Titelfeierlichkeiten, die jedes Jahr stattfanden, irgendjemanden besonders störte.
Man kann das Ganze aber auch nicht darauf reduzieren, dass die „richtige“ Spielweise diejenige ist, die die meisten Spiele gewinnt. Schließlich würde nur der Langweiligste aller Utilitaristen behaupten wollen, dass Erfolg lediglich in Punkten und Pokalen gemessen werden kann. Für Romantik muss ebenfalls Platz sein. Dieses Spannungsfeld zwischen dem, was die Brasilianer futebol d’arte und futebol de resultados, Fußballkunst und Ergebnisfußball, nennen, gehört zu den fußballerischen Konstanten überhaupt. Das liegt vielleicht daran, dass es eine nicht nur im Sport, sondern im Leben an sich grundsätzliche Frage berührt: Will man lieber gewinnen oder lieber schön spielen?
Ruhm lässt sich nicht in Zahlen messen, und seine Voraussetzungen ändern sich mit den Umständen und dem Zeitgeist. In Großbritannien sind die Zuschauer von bedächtigem Spielaufbau schnell gelangweilt, während beispielsweise das Publikum zur Zeit von Fabio Capellos erstem Engagement bei Real Madrid buhte, wenn Fernando Hierro lange Pässe in den Lauf von Roberto Carlos schlug. Kaum mehr vorstellbar ist heute, dass Passspiel unter den frühen Amateurfußballern als unmännlich galt. Wer weiß, vielleicht erscheint den Briten eines Tages ihre heutige Abneigung gegen Schwalben als naiv – so wie dies in bestimmten Kulturen ja schon heute der Fall ist?
Doch selbst wenn man einräumt, dass es beim Fußball um mehr als um das reine Gewinnen geht, wäre es albern, die Bedeutung des Sieges in Abrede zu stellen. Arsène Wenger kann manchmal unglaublich weltfremd sein. Wie seine zermürbende Taktik beim englischen FA-Pokalfinale 2005 jedoch zeigte, unterliegt auch er mitunter dem Zwang zum Ergebnisfußball. Und Alf Ramsey zu unterstellen, dass er den englischen Fußball ruiniert hätte, statt seinen taktischen Scharfsinn zu würdigen, wäre einfach Blödsinn, hat er England doch den einzigen internationalen Titel beschert.
Dennoch sollte man nicht zu viel in die Leistungen, die bei großen internationalen Turnieren gezeigt werden, hineininterpretieren. Nur selten gibt es eine weltweit wirklich herausragende Mannschaft, und noch seltener wird diese dann auch noch Weltmeister – Spanien bildet da die große Ausnahme. Die Brasilianer räumten bei der WM 2002 ihre Gegner zwar geradezu beiläufig aus dem Weg. Angesichts ihres lethargischen Auftritts in der Qualifikation erscheint es aber fast, als wäre Brasiliens damalige Überlegenheit vor allem der Schwäche der anderen Mannschaften geschuldet, die unter Verletzungspech, Erschöpfung und mangelnder Disziplin litten und vor der Hitze kapitulierten. Frankreich stellte zwar bei der WM 1998 die vermutlich beste Mannschaft, doch lieferte es dafür eigentlich nur im Finale den Beweis. Zwei Jahre später schickte es dann bei der EM 2000 die mit Abstand beste Mannschaft ins Rennen, und dennoch hätte Frankreich im Finale fast gegen Italien verloren.
Im Gegensatz dazu verloren zwei der besten Mannschaften aller Zeiten, die Ungarn von 1954 und die Niederländer von 1974, ihre Endspiele tatsächlich – beide gegen die Bundesrepublik Deutschland, was Zufall sein mag oder auch nicht. Ein drittes Team, die Brasilianer von 1982, kam noch nicht einmal bis dorthin. Abgesehen von 1966, lieferte England seine beste Leistung bei der WM 1990 ab. Es war ein Turnier, das man wegen Gazzas Tränen und Englands Aus im Elfmeterschießen in guter Erinnerung hat – Bilder, die einem bald auf die Nerven gehen sollten, damals jedoch den Eindruck tragischen Scheiterns hinterließen und den Boom der 1990er Jahre mit auslösten.
Darüber war dann auch schnell vergessen, dass Englands Vorbereitung auf das Turnier einem Alptraum geglichen hatte: Man war mit Ach und Krach durch die Qualifikation gestolpert, Trainer Bobby Robson wurde von der Presse beinahe täglich an den Pranger gestellt, und nachdem Kontakte zwischen einigen Spielern und einem einheimischen PR-Agenten bekannt geworden waren, verbannte man überdies die Medien aus dem Trainingslager. All das wurde noch von den Problemen mit Hooligans überschattet. Gegen Irland und Ägypten spielten die Engländer grausam, gegen Belgien und Kamerun hatten sie Glück. Nur gegen die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland spielten sie gut, konnten aber beide Spiele nicht gewinnen. Tatsächlich wurde nur das Spiel gegen Ägypten in der regulären Spielzeit gewonnen.
Im Verlauf einer Saison gleichen sich Glück, Verletzungen und Fehler von Spielern und Schiedsrichtern stets aus – zwar nicht absolut, aber doch eher als bei sieben Spielen während eines Sommers. Es mag ärgerlich sein, dass England seit über 50 Jahren keinen Titel mehr gewonnen hat. Die Verantwortung dafür mag auch zu einem gewissen Grad den Trainern, Spielern, Unparteiischen und Gegnern zugeschoben werden. Dennoch kommt dies keinem tiefgreifenden Niedergang gleich. Es ist möglich, dass es grundlegende Schwächen in der englischen Spielweise gibt, und eine gewisse Fortschrittsfeindlichkeit hat da bestimmt nicht weitergeholfen. Dennoch wäre es höchst zweifelhaft, lediglich auf Basis des Abschneidens bei den großen Turnieren ernsthaft eine Totalsanierung des englischen Fußballs zu fordern.
Wenngleich die Globalisierung nationale Stile immer mehr verwischt, sind sie doch aufgrund der jeweiligen Tradition eines Landes, wie sie von Trainern, Spielern, Experten und Fans aufrechterhalten wird, noch immer unterscheidbar. Beim Schreiben dieses Buches fiel auf, dass jede Nation sich zwar durchaus ihrer eigenen Stärken bewusst ist, aber auch, dass keine dieser Nationen ihnen wirklich zu trauen scheint. Im brasilianischen Fußball geht es vor allem um Gespür und Improvisation, dennoch schaut man dort sehnsüchtig auf die Defensivorganisation der Italiener. Italienischer Fußball wiederum ist Anti-Fußball und lebt von taktischer Intelligenz, gleichzeitig bewundert und fürchtet man aber den körperlichen Einsatz der Engländer. Beim englischen Fußball spielen Zähigkeit und Kampfkraft eine große Rolle, trotzdem glaubt man, die technischen Fähigkeiten der Brasilianer imitieren zu müssen.
Die Geschichte der Fußballtaktik scheint die Geschichte zweier miteinander verbundener Spannungsfelder zu sein, nämlich Ästhetik vs. Ergebnisse auf der einen und Technik vs. Physis auf der anderen Seite. Verwirrend ist dabei, dass diejenigen, die in einer von Technik geprägten Kultur aufgewachsen sind, tendenziell eher einen körperbetonten Ansatz als zielführend ansehen, während die Mitglieder einer körperbetonten Kultur die Technik für erfolgversprechender halten.
Schönheit liegt dabei vor allem im Auge des Betrachters. Es mag sein, dass die britischen Fans ein ausgeklügeltes Duell wie im Champions-League-Finale 2003 zwischen dem AC Mailand und Juventus Turin bewundern – obwohl es den meisten offenbar nicht so ging. Eigentlich aber wollen sie lieber den Hau-drauf-Fußball der Premier League sehen. Natürlich stimmt das so nicht ganz, da der Fußball in der Premier League mittlerweile viel raffinierter ist als noch vor zehn Jahren. Er ist jedoch nach wie vor schneller und weniger von Ballbesitz geprägt als in jeder anderen großen Liga. Den Summen für die Fernsehübertragungsrechte im Ausland nach zu urteilen, glaubt auch der Rest der Welt, dass man in der Premier League die perfekte Mischung gefunden hat.
Mitte der 1950er Jahre erschienen zahlreiche Bücher, die sich mit Englands sinkendem Stern befassten. Das Buch von Glanville war wahrscheinlich das wütendste, genauso tief blicken lässt indessen auch Soccer Revolution von Willy Meisl, dem jüngeren Bruder des großen österreichischen Trainers Hugo Meisl. Geschrieben aus einer Liebe zu England, wie sie wohl nur Einwanderer entwickeln können, ähnelt sein Buch eher einem Klagelied. Für beide war es nur folgerichtig, den ungerührten Konservatismus der englischen Spielweise dafür verantwortlich zu machen. Im Nachhinein kann man dieses Urteil im Kontext einer allgemeinen Kritik an den gesellschaftlichen Eliten sehen, die zwar den Untergang des Empire abgewickelt, ihre neue Rolle jedoch noch nicht gefunden hatten. Selbstverständlich war Englands Engstirnigkeit ursächlich für den Verlust der Überlegenheit im Fußball. Allerdings wäre man auch sonst wohl irgendwann vom Rest der Welt eingeholt worden. Wie Glanville resigniert bemerkte, haben Schüler nun einmal die Angewohnheit, irgendwann besser zu sein als ihre Meister. In diesem Fall jedoch war der Meister aufgrund seiner Arroganz und Borniertheit an seinem eigenen Untergang nicht unschuldig.
All das ist Schnee von gestern und Englands Fall von seinem hohen Ross nichts Neues mehr. Indem dieses Buch die Entwicklung der Fußballtaktik nachzeichnet, unternimmt es den Versuch, zu erklären, wie wir dorthin kamen, wo wir heute stehen. So gesehen steht es in einer Reihe mit Soccer Nemesis und Soccer Revolution. Es geht jedoch von einer vollkommen anderen Gegenwart aus, in der England zwar nicht ganz oben mitspielt, keinesfalls aber im Niedergang begriffen ist. Daher ist dieses Buch ein Geschichtsbuch und keine Polemik.