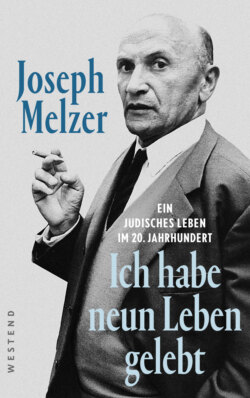Читать книгу "Ich habe neun Leben gelebt" - Joseph Melzer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schabbat
ОглавлениеWenn ich mich auch an das Haus meines Großvaters und den täglichen Gang zum Cheder nur noch schwach erinnern kann, so ist in mir die Erinnerung an den Schabbat und die ganze damit verbundene Zeremonie in allen Einzelheiten sehr lebendig geblieben. Der Schabbat war immer ein besonderer Feiertag, ähnlich wie Pessach, obwohl er sich alle sieben Tage wiederholte. Als Kind war es für mich ein Tag voller angenehmer Überraschungen und Freude, besonders was die Mahlzeiten betrifft. Ich habe seither nie mehr derartige Tage erlebt und nie wieder so gut gegessen. In meinem Elternhaus in Berlin wurden Schabbat und selbst Pessach nicht gefeiert. Mein Vater hielt von dem ganzen »Religionszirkus« überhaupt nichts, und obwohl er in der jüdischen Kultur sehr gebildet war, waren ihm Religion und die sich daraus ergebenden Gebote und Verbote zuwider. Er hielt sich an den von ihm verehrten Heine, der lange vor Marx den Satz geprägt hat: »Religion ist Opium für das Volk.« Dafür wurde es umso mehr bei meinem Großvater gefeiert, wo wir bis zu meinem siebten Lebensjahr wohnten.
Der Schabbat begann in unserem Schtetl eigentlich schon am Freitagabend, sobald sich die ersten Sterne am Himmel zeigten. Im Winter begann er schon am Nachmittag, weil es früher dunkel wurde und die Geschäfte leer wurden. Kein Jude verließ mehr die Stadt. Es kamen aber einige nach Kuty, um hier den Schabbat zu feiern. Während ich noch im Cheder das hebräische Alphabet lernte, waren zu Hause die Vorbereitungen für den Schabbat in vollem Gange. Mutter nahm den Wassertopf vom Herd, goss Wasser in eine Blechschüssel und begann die Säuglinge, einen nach dem anderen, abzuseifen: »Man muss sauber sein am Schabbat«, sagte sie. Die anderen Kinder saßen auf einer Decke um sie herum. Danach begann Mutter, unter der Aufsicht von Großmutter, mit der Vorbereitung der Speisen. Der Duft der frischen Seife und der Kerzen mischte sich mit dem Geruch des Eintopfs. Die Gerichte wurden in der langen, niedrigen Küche zubereitet, wo es heiß und dumpfig zuging. In der abgestandenen Luft mischten sich die Düfte der fertigen Speisen, alles beherrschend der bitter-süße Geruch des Tscholent, des jüdischen Eintopfs. Der große Dichter Heinrich Heine nannte ihn »des wahren Gottes koschere Ambrosia«. Tscholent ist ein Eintopfgericht für die Mahlzeit am Schabbat. Es wird schon am Freitag vor Schabbatbeginn zum Kochen gebracht und bei geringer Hitze bis zum Samstagmittag fertig gegart. Arme, die nicht über einen angemessenen Backofen verfügten, brachten ihren Tscholent daher zum Bäcker. Wir hatten aber einen großen Backofen, und Karl, der Behelfer, der mich jeden Tag zum Cheder trug, sorgte dafür, dass der Ofen immer befeuert wurde.
Als ich nach Hause kam, waren die Kleinsten schon gewaschen und fertig angezogen. Vater und Großvater bereiteten sich für den Gang in die Synagoge vor. Sie warteten nur noch darauf, bis ich meine Schabbat-Kleider angezogen hatte. Vater in seiner »Sonntagskleidung«, Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, und dazu eine Tasche aus Samt, in die er sein Gebetbuch und irgendeinen deutschen Klassiker hineinsteckte, den er in der Synagoge las, während alle anderen sich mit Inbrunst in ihre Gebetbücher vertieften. Großvater sah in seinem Kaftan und dem breiten Hut wie ein Gutsbesitzer aus. Im Winter trug er einen langen, schweren Mantel mit Schaffell gefüttert. Ich zog meinen blauen Samtanzug an und ein weißes Hemd mit einer dunkelblauen Krawatte. Noch auf der Treppe kämmte meine Mutter mein schwarzes Haar und verpasste mir einen Scheitel.
Auf ein Zeichen meines Großvaters verließen wir, bis auf die Kleinsten, die noch nicht allein gehen konnten, das Haus. Von überall her kamen bärtige Juden in langen Mänteln und gingen mit eiligen Schritten durch die schmalen Gassen zum Bethaus. Selten sah man einen allein unterwegs. Kaum war jemand aus dem Haus getreten, schloss sich ihm ein anderer und diesen sodann weitere an. Kinder begleiteten sie, manche wurden noch an den Händen geführt. So ging man mit eiligen und dennoch würdevollen Schritten dem Schabbat entgegen, wünschte einander »Gut Schabbes«, und das Echo dieser Worte hallte durch die kalte Luft wie ein Gruß aus einer anderen Welt.
Manchmal verirrte sich ein großer, magerer Goi in die Gasse. Sobald er aber die vielen Juden erblickte, stolperte er eilig davon und versuchte, das jüdische Viertel möglichst unauffällig zu verlassen. Die Kinder liefen ihm hinterher und riefen laut »Scheigez, Scheigez«.
Die Gasse führte um den Hügel herum zur Synagoge und zur Mikwa. Aus drei verschiedenen Gassen strömten die Juden vor dem Bethaus zusammen und drängten sich durch die offene Tür, bevor sie den Betraum betraten. In der Mitte der Ostwand befand sich die heilige Lade, wo die Thorarollen aufbewahrt wurden. Davor stand ein Holzpult für den Vorbeter und die, die später einzeln zum Vorbeten aufgerufen werden sollten. Rundherum Tische und Bänke, die im Lauf der Zeit tiefschwarz geworden waren. Die Versammlung wurde kontinuierlich größer. Am Ofen stand in der Regel eine Gruppe von Männern mit langen, weißen Bärten. Alle riefen sich gegenseitig »Gut Schabbes, gut Schabbes.« zu. Der Raum war erfüllt von lautem Gemurmel und unterdrückter Heiterkeit. Die Kinder liefen zwischen den Bänken hin und her und kreischten manchmal laut. Erst als der Rabbiner hereinkam und sich hinter dem Holzpult würdevoll aufbaute, wurde es auf einen Schlag still, und selbst die Kinder verstummten neben ihren Vätern. Alle holten ihre Gebetbücher heraus und fingen an, in einem merkwürdigen Singsang, in einer uns Kindern noch unverständlichen Sprache zu beten. Der Vorbeter sang mit einer klaren, lauten und tiefen Stimme, und sein Oberkörper wiegte sich unentwegt vor und zurück, was die Konzentration beim Beten fördern soll. Währenddessen holte mein Vater seinen Heine oder Schiller aus der Tasche und las ungestört in seinen geliebten deutschen Klassikern.
Die Gebete dauerten nicht lange, denn auf alle wartete zu Hause eine leckere, warme Mahlzeit. Als schließlich das abschließende Amen gesprochen wurde, waren alle erleichtert und froh. Man beeilte sich nach Hause zu kommen, wo bereits das warme Essen wartete.
Der Rest der Familie einschließlich der Ehefrauen ging am Vorabend des Schabbats nicht in die Synagoge. Das taten sie dann mit umso größerer Begeisterung am Schabbat selbst, um auf der Frauenempore Nachbarinnen, Freundinnen und Familienangehörige zu treffen und sich über die wichtigen und unwichtigen Ereignisse der Woche auszutauschen.
Wir Kinder traten als Erste ins Haus, nach uns mein Vater und als Letzter Großvater.
»Gut Schabbes« rief er und verbeugte sich feierlich.
»Gut Schabbes, Herr des Hauses«, antworteten Großmutter und Mutter gleichzeitig. Großvater legte das Gebetbuch auf den Tisch und ging ins Badezimmer, um sich die Hände zu waschen. Großmutter trat an den Tisch und zündete gemäß der jüdischen Tradition die Schabbat-Kerzen an. Sie legte das abgebrannte Streichholz auf das Tablett, hob die Hände und drehte sich dreimal hin und her. Dann legte sie die Hände vor das Gesicht und sagte, wie vorgeschrieben, den Segensspruch: »… und Du hast uns befohlen, Lichter anzuzünden zu Ehren des Schabbats.« Langsam nahm sie die Hände vom Gesicht.
Großvater, aus dem Bad zurückgekehrt, legte seinen Tallit, das Gebettuch, um die Schulter und begann mit der Segnung des Brotes. Unmittelbar danach fuhr er mit dem Lob der tüchtigen Hausfrau fort, so wie es das Ritual verlangt. Dann beugte er sich über den Becher, um zu prüfen, ob genug Wein für den Kiddusch vorhanden war. Er begann zu beten: »Es wurde Abend, und es wurde Morgen: Der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Gefüge. Am sechsten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig: denn an ihm ruhte Gott.« Er nahm das Deckchen von den Broten und breitete die Hände über sie: »Gelobt sei der Name des Herrn der Welt, der hervorbringt Brot aus der Erde.«
Er hob den Becher an die Lippen und trank ihn halb leer, bevor er ihn Großmutter reichte. Diese senkte den Kopf und trank einen Schluck. Dann reichte sie den Becher weiter.
»Lechajim, auf das Leben«, rief Großvater.
»Lechajim«, antworteten wir alle im Chor.
Großmutter stellte einen großen Teller mit Hühnersuppe auf den Tisch und verteilte die Suppe in alle Teller. Zuerst natürlich an Großvater. Als sie fertig war, sagte Großvater mit lauter Stimme »Guten Appetit«, und Großmutter sagte: »Lasst es euch schmecken.«
Alle schlürften ihre Suppe, und der aufsteigende Dampf zog wie eine Nebelschwade durch den Raum. Nachdem wir fertig waren, brachte Großmutter einen Teller Fleisch mit gekochten Kartoffeln herein. Nur am Vorabend des Schabbats wurde bei uns Fleisch gegessen. Bei Armen, Nebbichen, gab es dagegen Heringe.
Nach dem Fleischverzehr war die Mahlzeit zu Ende. Die Kinder wurden ins Bett geschickt, und Großvater nahm vom Regal ein Buch und begann still für sich zu lesen. Nach einiger Zeit stand auch er auf und ging schlafen.
Am Schabbatmorgen standen alle früh auf, um gemeinsam ins Bethaus zu gehen. Zunächst wurden die Kinder gewaschen, aber diesmal, weil am Schabbat nicht erlaubt, ohne Seife. Zum Frühstück gab es Rosinenkuchen, den Großmutter tags zuvor gebacken hatte. Großvater wünschte allen einen guten Schabbat und las das Morgengebet vor. Man hörte ihn kaum, so leise und schnell flüsterte er es. Im Winter zogen wir uns warm an und verließen das Haus. Die Kinder machten Schneebälle, die sie auf einen Schwarm aufflatternder Tauben warfen.
»Kinder, es ist Schabbat«, schimpfte mein Großvater.
Es ging wieder die schmale Gasse hinunter, die wir einfach die »Dorfstraße« nannten. Wieder kamen von allen Seiten feierlich gekleidete Juden, die sich mit »Gut Schabbes« begrüßten. In der Mitte der Straße ging der örtliche Polizeikommissar, ohne irgendjemanden eines Blickes zu würdigen oder gar zu grüßen. Über dem gelackten Schirm seiner marineblauen Mütze prangte der österreichische Adler. Mit steifem Rücken stolzierte er eilig vor uns her. Offensichtlich wollte er die Straße so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Am Schabbat kamen auch die Frauen in das Bethaus. Sie gingen aber mit den Kindern getrennt von den Männern und hatten auch ihren eigenen Eingang, von wo es direkt auf die Empore ging, den Platz für die Frauen.
Im Betraum der Männer ging es laut her, wie in der sprichwörtlichen Judenschule, und das Gemurmel schwoll an und erfüllte den ganzen Raum. Hinzu kam noch das Flüstern der Frauen und das Kreischen der Kinder. Es war fast wie auf einem Jahrmarkt. Der Rabbiner kam herein und nahm seinen Platz ein. Es wurde still. Der Vorbeter begann mit seinen Gesängen. Die Betenden wiegten sich so heftig hin und her, dass es manchmal schien, als wollten sie sich gegenseitig wegrempeln. Menschen kamen und gingen, und es wurde wieder laut sowie zuvor. Es war gänzlich anders als in einer katholischen Kirche, was ich damals allerdings noch nicht wusste. Erst viel später, als Erwachsener, hatte ich Gelegenheit, einen Gottesdienst in einer katholischen Kirche zu erleben – eine völlig andere Welt. Mein Vater las heimlich in seinem Heine und sang vielleicht im Geiste seine Lieder mit.
Es ist Brauch bei den Juden, dass am Schabbat unterschiedliche Personen zum Thoravorlesen aufgerufen werden. Es ist dies eine Ehre, und meinem Großvater, als angesehenem Bürger der Gemeinde, wurde diese Ehre nahezu jedes Mal zuteil. Vielleicht, weil er ein Kohen war. Wir alle warteten stets gespannt darauf. Schließlich hörten wir den Synagogendiener rufen:
»Es möge vortreten Reb Avraham Ben Jakob haKohen!«
Großvater war ein Kohen, das heißt, unsere Familie stammt aus dem israelitischen Stamm der Kohanim, der Priester, denen es damals bestimmt war, im Tempel in Jerusalem zu dienen.
Er wurde als Letzter aufgerufen und sang seinen Text mit lauter und klarer Stimme. Als er fertig war, sagten alle Anwesenden »Amen«. Später gratulierten sie ihm.
Der Vorbeter beendete den Gottesdienst mit den Worten: »Der den Frieden geschaffen hat zu seinen Höhen, gib Frieden uns und dem ganzen Volk Israel. Amen.«
»Amen«, antworteten die Gläubigen und dankten dem Vorbeter, dass er für sie gebetet hatte.
Fast an jedem Schabbat fand auch eine Bar Mizwa statt und der Knabe, der dran war, durfte die Haftara vorsingen, den Abschnitt aus der Bibel, der zu seinem Geburtstag passte. Das war immer ein großer Tag für seine Familie und ein Festtag für uns Kinder. Kaum war der Knabe mit seinem Vortrag zu Ende, da regnete es aus der Empore, wo die Frauen und auch seine Mutter, Großmutter und alle Tanten und Nachbarn saßen, kübelweise Süßigkeiten aller Art herab, die wir Kinder fleißig umgehend einsammelten.
Für die Erwachsenen gab es nach der Zeremonie einen Umtrunk, man gratulierte dem Vater und wünschte dem 13-jährigen Bar-Mizwa-Knaben viel Erfolg in seinem Leben und vor allem, dass er ein guter Jude werde.
Dann drängten sich alle zum Tisch, auf dem die Mäntel lagen und gingen zum Ausgang.
»Gut Schabbes, gut Schabbes«, riefen alle durcheinander.
Wir gingen nach Hause. Die Frauen, die am Umtrunk nicht teilnahmen, waren schon vorher gegangen, um den Mittagstisch vorzubereiten. Zu Hause angekommen empfing uns der süßliche Geruch geschmorter Kartoffeln. Großmutter freute sich jedes Mal, dass ihr der Tscholent so gut gelungen war. Es war alles bereitet, der riesengroße Topf stand schon auf dem Tisch und daneben die Challa, das geflochtene Schabbat-Brot. Großvater beeilte sich mit dem Beten und zerschnitt danach die Challa, tauchte eine Scheibe in Salz und biss hinein. Danach gab er jedem der Anwesenden ein Stück der Challa, und wir alle machten es ihm nach.
Großmutter nahm den Deckel vom Kochtopf, beugte sich über ihn und sagte zufrieden: »Ein guter, fetter Tscholent!« Sie verteilte die Portionen, und Großvater bekam natürlich am meisten, aber auch alle anderen wurden satt.
Danach gab es noch Nachtisch, eine Portion süßen, dampfenden Gugl.
»Ein königlicher Guglhupf«, sagte Großmutter stolz.
»Und du bist die Königin«, hörte ich meine Mutter murmeln.
Der Guglhupf war mit Rosinen und Walnüssen gespickt. Zu Pessach wurde er mit Äpfeln und Matze serviert. Meine Großmutter goss noch Honig über die Masse. Es schmeckte einfach köstlich.
Als wir fertig waren, nahm Großvater wieder sein Gebetbuch und begann, Psalmen zu lesen und zu singen. Die Kinder aber baten Großmutter, ihnen eine Schabbat-Geschichte zu erzählen. An eine kann ich mich lebhaft erinnern:
Es war einmal ein Jude namens Nachum, der an einem Freitagnachmittag über den Markt ging. Neugierig schaute er nach allen Seiten, nichts entging seinen Blicken. Er kannte jeden, und alle kannten ihn. Man erkundigte sich nach seiner Gesundheit, und Nachum antwortete, dass es ihm – »Gott sei Dank« – gut gehe. Dabei wandte er den Kopf ab, denn er wollte nicht, dass man sein Gesicht sah. Alle wussten, dass er eine schwere Krankheit hinter sich hatte. So schlenderte er über den Platz und beobachtete das lebhafte Treiben. Als er am Fischladen vorbeikam, rief der Händler: »Nachum, warte einen Augenblick!«, und schon war er im Laden verschwunden. Nachum blieb stehen und wartete. Bald kam der Fischhändler zurück und drückte ihm ein Päckchen in die Hand.
»Gut Schabbes«, wünschte er Nachum und ging in seinen Laden zurück.
»Gut Schabbes. Gott vergelte es dir«, sagte Nachum. Er schämte sich. Jetzt hatte er es eilig, nach Hause zu kommen. Als er beim Bäcker vorbeikam, kaufte er sich mit den letzten Groschen zwei Schabbat-Brote. Dann rannte er nach Hause. Als er in die Stube trat, saß seine Frau mit gefalteten Händen wartend auf der Bank.
»Ich bring dir Fisch und Challa. Bereite den Schabbat vor«, rief er glücklich.
»Gott ist barmherzig«, sagte seine Frau und rang die Hände.
»Beeil dich, Frau! Der Schabbat steht vor der Tür«, sagte Nachum.
Beile, so ihr Name, machte sich sofort an die Arbeit. Der Fisch war ein Hecht. Beile entschuppte ihn, schnitt ihn auf und nahm die Eingeweide heraus. Da fiel ein Stein auf den Tisch. Sie nahm ihn und betrachtete ihn. »Nachum, ein Brillant!«, rief sie.
»Ein Brillant?«, rief er ungläubig. Er mochte seinen Augen nicht trauen. Sprachlos starrten sich die beiden an.
»Beile, mach weiter. Wenn der Schabbat vorbei ist, bringe ich den Schatz zum Fischhändler«, sagte Nachum zu seiner Frau. Sie war einverstanden, und sie feierten einen glücklichen Schabbat.
Die größeren Kinder verstanden die Moral der Geschichte und klatschten, die kleineren machten es ihnen nach.
Inzwischen war es Zeit für die Hawdala, die Trennungszeremonie, die den Schabbat abschließt. Ich wusste, dass jetzt eine ganze Woche, sieben lange Tage, bevorstanden, bis ich meinem Großvater wieder so nah kommen würde.