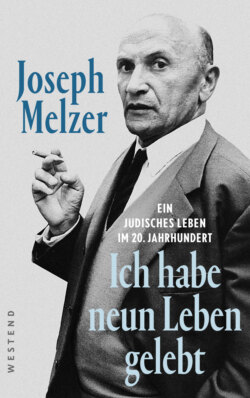Читать книгу "Ich habe neun Leben gelebt" - Joseph Melzer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pessach
ОглавлениеUnvergessen sind mir Pessach und die Sederabende geblieben, die bis spät in die Nacht dauerten. Die Inbrunst, mit welcher Großvater die Gebete sprach, den Wein segnete und den erwarteten Propheten Elijahu begrüßte, prägten mein kindliches Gemüt. Es nahm das alles auf, als wäre es etwas, das mit dem täglichen Leben unmittelbar zusammenhängt und keineswegs ins Metaphysische entrückt war. Ich liebte Pessach nicht nur wegen des köstlichen Essens, sondern besonders wegen der unterhaltsamen Zeremonie voller Geheimnisse und Märchen, wegen des erhofften Besuchs des Propheten Elijahu (der natürlich nie kam), und nicht zuletzt wegen der Freude über den Sieg über die Ägypter. Auf dem Tisch stand immer ein volles Glas Rotwein für den Propheten, das bis zum Schluss der Zeremonie voll blieb und am Ende von Großvater ausgetrunken wurde. Pessach war auch ein Fest, an dem wir Kinder teilnehmen konnten und sollten, insbesondere um die versteckte Matze zu suchen. Und vor allem war es ein Fest, das zu Hause gefeiert wurde und nicht in der Synagoge.
Es gibt für Juden kein schöneres, emotionaleres und gemütlicheres Fest als Pessach. Man begann mit den Vorbereitungen schon einige Tage vor dem ersten Festtag, dem Sederabend, mit der Aussonderung aller für Pessach nicht geeigneten Lebensmittel. Wir Kinder durften dabei helfen. Die verpackten Lebensmittel, auf denen »Kosher für Pessach« stand, verblieben in der Küchenkammer, alle anderen wurden »verkauft«. Nicht alles, was sonst als koscher gilt, ist auch zu Pessach koscher. Da gelten andere Vorschriften, die so kompliziert sind, dass sie ein nicht religiöser Jude meist nicht versteht.
Das mit dem »Verkaufen« war natürlich ein Trick, ein Schwindel. Jede Familie hatte ihren Goi, der für einen Groschen alles, was Pessach nicht erlaubt war, aufkaufte. Somit gehörte es nicht mehr uns und konnte bleiben, wo es lag. Nach dem Fest wiederholte man diesen Handel in umgekehrter Folge. Man gab dem Goi den Groschen zurück und war wieder im Besitz seiner Lebensmittel.
Nachdem diese merkwürdige Zeremonie vorüber war, mussten wir sämtliche Küchenutensilien, Teller, Tassen, Messer, Gabel, Löffel, Kochtöpfe, Pfannen und sonstigen Gefäße, die wir im täglichen Leben benutzten, in den Keller schaffen, wo auch das gesamte Schabbat-Geschirr untergebracht war. Ein strenggläubiger Haushalt hatte von allem jeweils drei Exemplare, für die Wochentage, für den Schabbat und für Pessach. Das für Pessach vorgesehene Geschirr wurde gereinigt und in die gute Stube geschafft, was von Großmutter alles genauestens überwacht wurde. Das Pessach-Geschirr durfte – Gott behüte! – unter gar keinen Umständen mit dem gewöhnlichen Geschirr und auch nicht mit dem Schabbat-Geschirr in Berührung kommen.
Als das erledigt war, was in der Regel zwei Tage beanspruchte, wurde das ganze Haus gereinigt, um auch das allerkleinste Körnchen Chamez zu entfernen. Danach begann man mit dem Backen der Matzen, die man bei der Sederabend-Zeremonie und auch während der sieben Tage des Festes verzehrte, bis sie einem zum Halse raushingen und man sich nach einem echten Roggenbrot sehnte. Heute kauft man, wenn man in Israel oder in einer jüdischen Umgebung lebt, die Matzen im Supermarkt. In Deutschland, wo nach dem Krieg nicht mehr so viele Juden lebten, haben die jüdischen Gemeinden das Verteilen von Matzen in Paketen organisiert. Als ich noch Kind war und im Haus meines Großvaters lebte, oblag es jeder Familie, die benötigten Matzen selbst zu backen. Bei einer so großen Familie wie der unsrigen hat es zwei, manchmal drei Tage gedauert. Die fertigen Matzen wurden dann vorsichtig herausgeholt, damit sie ja nicht brechen, in einer trockenen Ecke der Wohnung gestapelt und dort mit einem Leinentuch zugedeckt. Alle diese Arbeiten wurden in einer feierlichen Atmosphäre verrichtet, wie sie in allen jüdischen Häusern der Stadt herrschte.
Endlich kam der ersehnte Tag, und nach dem Abendgebet begann der Seder, das Abendmahl. Auf Hebräisch bedeutet Seder übrigens Ordnung, und genauso verläuft auch der Abend, nach einer seit Jahrhunderten festgelegten Ordnung, in vorgeschriebenen Schritten. Bevor es losgeht, muss der Sederteller gedeckt und die anderen Zutaten vorbereitet werden: Matzen und sechs weitere Bestandteile in einer im Hinblick auf ihre mystische Bedeutung und ihre Beziehung untereinander vorgegebenen Anordnung. Dann legt man drei ganze Matzen übereinander und bedeckt sie mit einem Tuch. Darauf wird ein gebratener Hähnchenknochen gelegt, von dem das Fleisch entfernt war. Er soll das Pessachopfer symbolisieren und wird natürlich nicht gegessen. Drum herum legt man ein hart gekochtes Ei, geriebenen Meerrettich, Charosset – eine aus Äpfeln, Birnen und Wein hergestellte Paste –, ein Stück Gemüse und weitere bittere Kräuter, die an das bittere Leben der Israeliten in Ägypten erinnern sollen. Jeder der Anwesenden benötigt einen Weinbecher und eine Schale mit Salzwasser. Wenn ich sage »jeder«, dann meine ich nur die Erwachsenen. Die Kinder waren mit anderen Aufgaben beschäftigt. Zu den Erwachsenen gehörte aber auch jedes Jahr ein Gast, den Großvater von der Synagoge mitgebracht hatte.
Fremde Juden, die in der Stadt hängen geblieben waren, warteten vor dem Bethaus, um von einheimischen Hausbesitzern eingeladen zu werden, und es war eine religiöse Pflicht, sozusagen eine gute Tat, einen Gast zum Seder mitzubringen. Auch in Deutschland pflegte ich, die Sederabende für meine Familie zu zelebrieren und nahm auch die Tradition auf, Gäste einzuladen. In der Regel waren es nichtjüdische Kontakte aus meiner verlegerischen Arbeit oder auch Freunde meines Sohnes Abraham. Diese Fremden waren immer dankbar für die Einladung, die ihnen die Tür zu einer fremden Welt öffnete.
Jetzt konnte die Zeremonie beginnen. Mein Großvater füllte den Weinbecher bis zum Rand mit süßem Rotwein und sprach den Segen, den Kiddusch. Danach ging er die Hände waschen. Sie müssen gesäubert sein von den Unreinheiten eines Lebens in der materiellen Welt. Danach nimmt er ein kleines Stück Gemüse aus der Schale, tunkt es ins Salzwasser und spricht dabei den Segen für Gemüse. Alle erwachsenen Teilnehmer machen es ihm gleich. Er nimmt die mittlere der drei Matzen vom Sederteller, bricht sie entzwei und lässt das kleinere Teil liegen. Das größere Stück bricht er in fünf Teile und wickelt sie in ein Tuch. Laut der Kabbala wurde die Welt durch fünf Aspekte des Lichts erschaffen, und darauf bezieht sich dieser Brauch. Das Päckchen mit den fünf Stücken wird bis zum Ende des Seders versteckt. Das machen die Kinder, und sie freuen sich und rennen mit Geschrei in alle Richtungen. Die Erwachsenen mussten später das Paket suchen. Jedenfalls hielt uns die Spannung, wer die Matzen finden würde, bis zum Ende des Mahls wach, denn die Zeremonie dauerte noch lange.
Der zweite Becher wurde gefüllt, und wir Kinder wurden aufgefordert, die Frage zu stellen und die vier Antworten zu geben. Das war für uns Kinder der Höhepunkt des Seders. Es konnten nur fünf Enkel mitmachen. Einer, der die Frage stellte, und vier, die die Antworten gaben. Es gab aber mehr als doppelt so viele Enkel. Großvater bestimmte, wer die Frage stellen und wer die Antworten vortragen durfte. Ich, als Lieblingsenkel, war immer dabei.
Meistens stellte ich die Fragen: »Warum ist dieser Abend anders als andere Abende?«, lautete die erste Frage.
Und die Enkel antworteten einer nach dem anderen.
»An allen Abenden essen wir entweder Brot oder Matze, heute nur Matze«, sagte der erste. »An allen Abenden essen wir alle möglichen Kräuter, aber an diesem Abend nur bittere«, sagte der zweite. Und der dritte folgte: »An allen anderen Abenden stippen wir gar nicht, an diesem Abend gleich zweimal.« Dann kam der vierte dran: »An allen anderen Abenden essen wir entweder sitzend oder angelehnt, aber an diesem Abend nur angelehnt. Früher durften nur die Freien so essen. Indem wir heute Abend auch angelehnt essen, zeigen wir, dass wir freie Menschen sind.«
Nach dieser Unterhaltung begann die eigentliche Haggada, die Erzählung des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, der aber in Wirklichkeit eine Flucht war. Und da mein Großvater sich nie wörtlich an den Text der Haggada hielt, sondern immer auch Anekdoten aus dem Leben der Juden in der Gegenwart erzählte, erinnere ich mich an Pessach 1948, kurz bevor wir das Lager in Admont in Richtung Palästina verließen, als ich – Mitglied des Vorstands und Herausgeber der Lagerzeitung – die Ehre hatte, am gemeinsamen Sederabend aller Lagerinsassen, im Beisein von Gesandten aus Palästina, eine Rede zu halten, sozusagen im Rahmen der Liturgie der Haggada, was jedem erlaubt und sogar erwünscht war. Ich sagte: »Meine Brüder und Schwestern, wir lesen die Haggada und erinnern uns an das Wunder des Auszugs aus Ägypten vor 3 000 Jahren. Aber, liebe Anwesende, uns geschah dieses Wunder erst jetzt, vor wenigen Jahren. Auch wir waren Sklaven, einige wie ich bei den Russen und die meisten von euch bei den Nazis. Noch vor kurzem habt ihr nicht daran geglaubt, dass ihr befreit sein würdet. Und dennoch, das Wunder geschah, und heute sitzen wir hier frei und unabhängig, und, so Gott will, werden wir in wenigen Tagen in unser Land aufbrechen, in das gelobte Land Israel. Wir kommen aus der Unfreiheit und marschieren in die Freiheit. So geschehen auch in unseren Tagen noch Wunder.«
Die Anwesenden weinten. Es war eine traurige Freude. Still und würdevoll saß man im großen Saal und verzehrte die Köstlichkeiten, die uns Juden in Amerika gespendet hatten. Man dachte an die Jahre des Hungers, als jeder von uns für einen Laib Brot bereit gewesen wäre, seinen Nachbarn zu verraten. Und man dachte an die vielen Verwandten und Freunde, die es nicht geschafft haben, diesen Augenblick zu erleben. Danach tranken die Erwachsenen schließlich den zweiten Becher Wein.
Es wurde eine Schüssel mit Wasser gebracht, und Großvater wusch sich wieder die Hände. Er trocknete sie sorgfältig und nahm dann die übrigen Matzen vom Teller, hob sie hoch und sprach den Segen: »Gesegnet seist Du, Gott, unser Herr König des Universums, der Du Brot aus der Erde hervorbringst.« Matze ist die wichtigste Speise beim Seder, und sie zu essen ist das Hauptgebot bei der Pessach-Zeremonie. Großvater bricht für sich und alle anderen Tischnachbarn ein Stück von der Matze ab und reicht sie herum.
Es geht weiter: man lobt die Hühnersuppe mit den Matzeknödeln, eine Köstlichkeit. Ich habe den Geschmack noch heute auf der Zunge. Manche Kinder sind schon längst eingeschlafen, und auch die Erwachsenen haben Mühe, ihre Augen offen zu halten. Großvater hält aber tapfer durch. Er liest die Liturgie bis zur letzten Zeile. Am Schluss heißt es »Nächstes Jahr in Jerusalem.« Mancher Erwachsener ist inzwischen auch eingeschlafen, und so geht der Abend ruhig und friedlich zu Ende.
Vor allem hat diese Pessach-Zeremonie mein Dasein als Jude geprägt. Von den religiösen Pflichten habe ich nicht viel gehalten, aber die Feiertage habe ich als Kind geliebt und als Erwachsener respektiert. Das war die eine Seite. Die andere Seite war mein Vater. Im Gegensatz zum Großvater, dessen Bücherregale rabbinische und talmudische Schriften füllten, waren sie bei meinem Vater mit Büchern einer ganz anderen Welt gefüllt, an der ich als Kind keinen Anteil hatte. Ich wurde in diese beiden gegensätzlichen Welten hineingeboren, von der meines Großvaters angezogen, von der meines Vaters verwirrt. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges fand ich mich in einer völlig neuen Welt ohne jeden Bezug zur Religiosität meines geliebten Großvaters wieder.
Als Kind nahm ich das Judentum in erster Linie visuell wahr. Ich sah fast täglich meinen über einen großen Folianten gebeugten Großvater an seinem Tisch, wie er melodisch skandierend den Talmud las, immer wieder, jahrein, jahraus. Ich beobachtete, wie er mit peinlicher Genauigkeit die rituellen Gesetzesvorschriften an sich vollzog, wie er sich am Vorabend des Jom Kippur durch den Synagogendiener 40 Stockschläge als Sühne für etwaige Sünden verabreichen ließ, die er vielleicht unwissentlich begangen haben konnte. Ich erlebte betroffen, wie er das Kol-Nidre-Gebet vortrug und dabei bitterlich weinte und die ganze Gemeinde mit ihm. Er tat dies jedes Jahr. Ich sah, wie er sich den weißen Totenkittel anlegte und in Pantoffeln in die Synagoge ging, denn ein besohlter Schuh hätte seine Demut verringert.