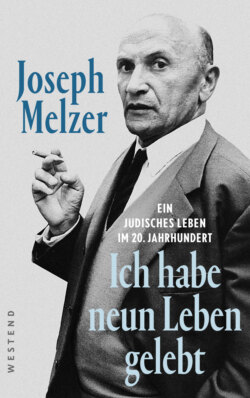Читать книгу "Ich habe neun Leben gelebt" - Joseph Melzer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Galizien
ОглавлениеGalizien, die östlichste Provinz der österreichischen K.-u.-k.-Monarchie, war unterteilt in einen östlichen und einen westlichen Teil. Nach dem Ersten Weltkrieg war diese Bezeichnung verschwunden und mit ihr ein Großteil der dort seit Jahrhunderten ansässigen Bevölkerung. Der eine unter der polnischen Herrschaft befindliche Teil wurde Małopolska (Kleinpolen) genannt, der andere Wielkopolska (Großpolen). Nach 1945 fiel der östliche Teil an Russland und hieß fortan Zapadnie. Heute gehört er zur Ukraine. Uns interessiert aber nicht die Gegenwart, sondern die »gute, alte Zeit«.
Ost- und Westgalizien – so die Bezeichnung im Habsburger Reich – waren in der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung und ihrer Mentalität durchaus verschieden voneinander. Während der östliche Teil von fünf unterschiedlichen Minderheiten bevölkert war – Ruthenen, Ukrainern, Huzulen, Polen und Juden –, bewohnten den westlichen Teil zwei homogene: Polen und Juden. Im Osten bildeten die griechisch-orthodoxen Ruthenen und die Huzulen die Mehrheit der Bewohner, ihnen gegenüber standen die römisch-katholischen Polen.
Polen und Juden wohnten vorwiegend in Städten. Die Juden waren mehrheitlich kleine Handwerker (mehr als man je hätte brauchen können) und Händler (von denen es mehr gab als Kunden). Weil Geld immer rar war, konnten sich die meisten kaum mehr leisten als gesalzene Heringe, einen Kamm für die Braut und einmal im Jahr ein Paar billige Schuhe. Aber auch fromme oder frömmelnde Thoraschüler und Schnorrer sowie Taugenichtse – »Luftmenschen« oder »Luftexistenzen«, wie sie sich selbst ironisch nannten – gab es zahlreich. Auf solche Selbstironie konnten die Juden kaum verzichten, schon eher auf ihre kärgliche Mahlzeit. Mein Freund Manès Sperber schrieb dazu: »Die Flickschneider und -schuster waren die meistbeschäftigten Handwerker, denn ohne sie hätten viele Kinder unzureichend bekleidet und auch im Winter barfuß gehen müssen. Manche Männer fasteten nicht nur an den zahlreichen Fastentagen, sondern überdies jeden Montag und Donnerstag, damit auch die Kinder oder die Enkel etwas mehr zu essen hatten. Den Frauen ging es nicht viel besser.
Es gab bei den Juden Bettler aller Art: So zum Beispiel die »Verschämten«, die immer nur eine Anleihe machen wollten, die sie aber nie zurückzahlen konnten. Dann gab es die professionellen Bettler, die eingesessenen und die wandernden, die zumeist in Gruppen auftraten. Es gab die Armen, die still hungerten und froren und auf Wunder warteten, die tatsächlich hin und wieder eintraten, wenn auch meist zu spät. Eine kleine Geldsendung eines Verwandten aus Amerika, eine Erbschaft, die einige Kronen einbrachte. Das größte Wunder war, wenn die Kinder in die Fremde fuhren und den darbenden Eltern gelegentlich einige Dollar schickten.
Auch wenn so viele an Hunger litten, musste doch niemand verhungern. Man erzählte: Mitglieder der Gemeinde weckten den Rabbi am frühen Morgen: »Es ist etwas Furchtbares geschehen«, klagten sie. »In unserer Mitte ist einer hungers gestorben, man hat ihn soeben tot in seiner Stube aufgefunden«. Darauf der Rabbi: »Das kann nicht sein. Ja, es ist unmöglich. Hättet ihr ihm ein Stück Brot verweigert, wenn er es von euch verlangt hätte?« – »Nein«, antworteten sie, »aber Elieser war zu stolz, um etwas zu bitten.« – »Also sagt nicht, dass mitten unter uns einer hungers gestorben ist, denn er ist an seinem Stolz zugrunde gegangen.«
Und so arm die Juden auch waren, so glücklich waren sie auch. Und am glücklichsten waren sie, wenn der Schabbat kam und sie am Tisch saßen und vom geflochtenen Weißbrot aßen, von der süßlichen Challa. Ja, es war eine bis zur Absurdität maßlose, groteske Armut, jedoch keine Armseligkeit, weil die Menschen nicht nur innigst glaubten, sondern auch zu wissen glaubten, dass dieser Zustand nur vorübergehend sei und sich bald ändern würde, auch wenn die Not schon seit Jahrhunderten dauerte, denn jeden Augenblick konnte man mit der Ankunft des Messias – der endgültigen Erlösung – rechnen. Es gab zwar vereinzelt Kleinmütige und Zweifler, die befürchteten, dass sie die Erlösung nicht mehr erleben würden, doch kaum einen, der nicht an den Messias und sein nahes Kommen glaubte.
Die Ostjuden sahen kaum die Schönheit des Landes, in dem sie lebten. Ihr Leben war von Verboten und Einschränkungen bestimmt. Sie gingen zumeist als Bettler und Hausierer über Land und hatten kein Auge und keinen Sinn für die Natur. Die große Mehrheit kannte den Boden nicht, der sie ernährte. Sie fürchteten sich, in fremde Dörfer einzukehren und mit Peitschen vertrieben zu werden. Der Ostjude hatte nur Pflichten, keine Rechte. Einem solchen Schicksal entgeht man schwer, und anstatt davor zu fliehen, fanden sich viele mit ihm ab.
Deshalb war auch der jüdisch-nationale Gedanke im Osten so lebendig. Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, wurde dort wie ein neuer Messias oder zumindest wie ein zeitgenössischer Moses, der das Volk Israel ins Gelobte Land führen wird, verehrt. Die Idee einer »jüdischen Nation« verbreitete sich im Osten sehr schnell, auch wenn viele orthodoxe Rabbiner den »Zionismus« verfluchten, weil sie darin eine Gefahr für die Juden und das Judentum sahen. Und als der Zionismus sich immer mehr verbreitete und die orthodoxen Rabbiner immer mehr fluchten, da tauchten national-religiöse Rabbiner auf, die im Zionismus ein Zeichen dafür sahen, dass der Messias schon unterwegs sei und jeden Augenblick erscheinen könne. Der Zionismus wurde zum Vorboten des Messias. Damit machten sie den Juden Mut, die Widrigkeiten des täglichen Lebens zu ertragen und den existierenden Judenhass, der damals noch nicht Antisemitismus, sondern eben schlicht und einfach »Judenhass« hieß, zu erdulden, in der festen Überzeugung, dass der Messias bald kommen würde.
Dennoch schrieb ein Chefredakteur einer ostjüdischen Tageszeitung über die Ostjuden: »In meinem Heimatstädtchen war jeder Jude ein heimlicher Prinz, und auch der Ärmste hatte etwas von einem Aristokraten in sich.« Und auch der Historiker und Philosoph Franz Rosenzweig, der bedeutende Exeget Hegels, schrieb seiner Mutter als Besatzungssoldat aus Polen im Ersten Weltkrieg: »Wir deutschen Juden sind geistig gesehen Proletarier, während die polnischen Juden, die in proletarischen Verhältnissen leben, Aristokraten des Geistes sind.«
Diese Worte sind umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, welch tiefe Verachtung viele deutsche Juden für ihre Religionsbrüder im Osten empfanden. Für sie, die sich schon weitgehend dem westlichen Leben angepasst hatten, verkörperten diese bärtigen Juden mit Schläfenlocken und Kaftan eine seit langem veraltete Kultur.
Die wesentliche Kraft, die den Zionismus in Russland in Bewegung und am Leben hielt, war die der Gebildeten, die Anhänger der Aufklärung. Oft waren sie ehemalige Talmud-Schüler, die eine gewisse Ahnung von systematisch-europäischer Bildung hatten. Sie waren es, die sich ein neues säkularisiertes Bewusstsein aneigneten. Die einfachen, gläubigen Juden blieben hingegen ihren Rabbinern treu.
Ein Teil der Gebildeten lernte Hebräisch und fing an, die jiddische Muttersprache zu verachten. Im Gegensatz zu den westlichen Juden engagierten sie sich insbesondere für gesellschaftliche Veränderungen und übten scharfe Kritik an den jüdischen Gemeinde-Institutionen. In den ersten Jahrzehnten war der Zionismus durchdrungen von radikalem Idealismus und sozialistischen Ideen von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Die Pogrome gegen Ende des 19. Jahrhunderts trugen ebenfalls dazu bei, dass junge Juden sich politischen Ideologien zuwandten, insbesondere dem Kommunismus und auch dem Zionismus.
»Denke ich an diese Juden zurück, die ich täglich in den Gassen und Straßen und in den Bethäusern sah, so bringt die Erinnerung viel Seufzen und Ächzen, aber auch Gelächter in mir hervor«, schrieb der österreichisch-französische Schriftsteller Manès Sperber, den ich erst viel später kennenlernte, und er meinte, dass das jüdische Schtetl in all seiner Misere eine kleine »Civitas Dei«, eine Stadt Gottes, gewesen sei, geistig und geistlich zugleich. Im Gegensatz zu den Juden in den Ghettos von Venedig und in den Judengassen von Worms oder Frankfurt, die immer eine diskriminierte Minderheit in der eigenen Vaterstadt blieben, waren die Einwohner der Schtetls in Osteuropa selbstbewusste und freie Juden. Sie fühlten sich dort bei sich zu Hause, auch wenn sie Fremde im eigenen Land waren. »Die polnischen Adeligen mochten mächtig und reich sein und auf sie herabsehen: Die Juden waren jedoch von ihrer eigenen Überlegenheit überzeugt, und in dem Schtetl fand sich nicht die Spur eines jüdischen Minderwertigkeitsgefühls. Im Gegenteil: man fühlte sich den polnischen Bauern und selbst den polnischen Adeligen überlegen.«
Folgende Anekdote gibt davon Zeugnis: Ein polnischer Gutsbesitzer, natürlich ein Judenhasser, will seinen jüdischen Gutsverwalter entlassen. Dieser bietet ihm an, seinem Hund innerhalb eines Jahres das Sprechen beizubringen, falls er auf die Entlassung verzichte. Der einfältige Gutsbesitzer ist neugierig, ob der Jude dazu in der Lage sein würde, und willigt ein. Die Frau des Juden schlägt die Hände über den Kopf und schreit ihren Mann an: »Wie konntest du in ein solches Geschäft einwilligen? Du weißt doch, dass der Hund nie sprechen lernen wird.« Darauf der Jude: »Mach dir keine Sorgen, ein Jahr ist lang, es hat 365 Tage. Da kann der Gutsherr sterben, da kann der Hund sterben, und da kann auch ich sterben. Hauptsache, wir sind geblieben, und wenn Gott will, werden wir noch lange bleiben.«
Die Juden waren schon immer praktisch veranlagt und pragmatisch in ihrer Gesinnung. Sie lernten, sich mit allem abzufinden, mit den guten Sachen, die freilich selten vorkamen. Vor allem aber fanden sie sich mit den schlechten, nahezu alltäglichen Umständen ab. Vor allem in Galizien waren sie eine Minderheit unter vielen Minderheiten. Genau das machte alles vergleichsweise erträglich, zumindest erträglicher als das Leben in Westeuropa, wo sie eine Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft waren. Alles in allem war es eine multikulturelle und multiethnische Gesellschaft, in der viele Völker friedlich nebeneinander und miteinander auskamen. Der Schriftsteller Joseph Roth, der in Brody, ganz in der Nähe meines Geburtsortes, aufgewachsen war, zeugte in seinen Romanen von seiner und fast aller Juden Liebe zu diesem Landstrich. Zwar konnte niemand den anderen leiden, aber dennoch achtete man einander. Katholiken hassten Protestanten, und Protestanten hassten die Katholiken, und beide hassten Juden, aber man hatte Respekt voreinander, trieb Handel, und manchmal heiratete man sogar grenzüberschreitend. Es war eine mehr oder minder friedliche Welt. Kaiser Franz Joseph war unser aller Vater und die Donaumonarchie unsere Heimat. Der Kaiser schützte seine Juden, und die Juden liebten ihren Kaiser.
Es gab auch einzelne Juden, wie meinen Onkel Schemarja Melzer in Skala oder meinen Onkel Israel Stein, der Bruder meiner Mutter, in Butschatsch, die Großgrundbesitzer waren. Indessen lebte die große Masse der Juden in erbärmlicher Armut. Die Polen stellten die hohen und niederen Beamten, vereinzelt gab es auch Großgrundbesitzer unter ihnen, besonders unter dem polnischen Adel. Die Ruthenen und Ukrainer waren das Landvolk, selbständige Bauern oder Landarbeiter. Die folkloristisch interessanteste Gruppe waren die Huzulen. Sie lebten bettelarm im Gebirge und verdingten sich als Knechte oder Holzfäller.
Für ihren Lebensunterhalt übten Juden die verschiedensten Berufe aus: Sie arbeiteten als Gerber und Weber, Schneider, Hutmacher und Schuster, Tischler, Stellmacher, Schindelschneider, Schmiede, Seifensieder, Kerzenzieher, Fuhrunternehmer und Wasserträger. Manche zogen Tag für Tag durch die umliegenden Dörfer, kauften den Bauern ein Kalb, ein Maß Korn, ein paar Eier oder Geflügel ab und verkauften diese Dinge an andere Juden weiter oder jeden Donnerstag auf dem großen Marktplatz. Und schließlich gab es die Händler, die in den großen umliegenden Städten ihre Ware einkauften und zur Verbreitung des Jiddischen beitrugen. Man fand praktisch kein Gewerbe, das nicht auch von Juden betrieben wurde, von den oft reichen Kaufleuten ganz zu schweigen.
Und auch dazu schrieb Sperber: »Es gab kein Gas, keine Elektrizität, keine Kanalisation und kein Telefon im Schtetl und natürlich auch keine Wasserleitungen, sondern nur einige wenige Brunnen. Wasserträger brachten es jenen, die es bezahlen konnten, ins Haus. Die Armen mussten sich ihr Wasser selbst holen.«
Die fleißigen Menschen, die jeden Donnerstag auf dem Marktplatz ihre Waren anboten, verließen in der Regel nie die engen Gassen ihrer kleinen Stadt, in der sie geboren waren und wo sie auch in der Regel starben. Sie sorgten dafür, dass das kulturelle Erbe ihrer Väter lebendig blieb, und gaben sich mit einem sehr bescheidenen Einkommen zufrieden. Sie glaubten an Gott und setzten ihre ganze Hoffnung in ihn.
Juden sprachen untereinander Jiddisch, die Polen natürlich Polnisch, die Ruthenen, Ukrainer und Huzulen einen russischen Dialekt. Donnerstags kamen sie alle in die Stadt, ins Schtetl, und man konnte auf dem Markt ein babylonisches Sprachgewirr vernehmen. Jeder redete in seiner Sprache, aber sie verstanden einander prächtig. Es gab selten Streit und wenn, dann nicht aus ethnischen Gründen, sondern weil jemand beispielsweise zu viel getrunken hatte und im Rausch gewalttätig wurde. Um zu schlichten, bedurfte es aber meist keiner Polizei. Die anwesenden Händler und Kunden sorgten im eigenen Interesse dafür, dass man die Streithähne voneinander trennte und dass der betrunkene Pole oder Huzule ausgenüchtert wurde. Betrunkene Juden aber gab es so gut wie nie.
In diesem Ostteil Galiziens wurde ich geboren, und bis zu meinem siebten Lebensjahr, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wuchs ich dort auf. Wir warteten auf den Messias und wussten, dass er nie kommen wird. Das Wort Antisemitismus kannten wir freilich nicht und Judenhass nahmen wir wahr, wie wir den Sommer oder den Winter wahrgenommen haben. Die Christen hassten uns, und wir hassten sie, und trotzdem haben wir mit ihnen Handel betrieben, Feste gefeiert und manchmal auch Hochzeiten, wenn ein jüdischer Junge oder ein jüdisches Mädchen einen Goi, einen Nichtjuden, heiratete. Es war kein persönlicher Hass, es war ein seit Jahrhunderten übertragener Hass, der mehr ein dumpfes Gefühl von Abneigung war, weil man es uns so beigebacht hatte. Ja, wir wussten, dass es früher, vor mehr als 100 Jahren, die Pogrome eines durchgedrehten Kosaken gab und wir hörten auch von den Unruhen in Kischinau und von der Dreyfus-Affäre oder vom Ritualmordprozess gegen Beilis und auch, dass er am Ende freigesprochen wurde, aber während der Lebenszeit meiner Eltern und Großeltern hat es nie Probleme gegeben. Der gegenseitige Hass war nie persönlich gemeint. Von diesem Teil der Welt will ich erzählen. Er existiert nicht mehr, er wurde während des Ersten Weltkriegs schon erheblich zerstört, und in den Jahren 1939 bis 1945 in Blut und Feuer, in Massenmord und Genozid schließlich gänzlich ausgelöscht.
Ich wurde als Sohn einer seit Jahrhunderten in Kuty und Umgebung ansässigen wohlhabenden Patrizierfamilie geboren. Unter den ersten zehn jüdischen Familien, die sich im Jahr 1562 in Kuty niederließen, befand sich, wie die Urkunden des Stadtarchives bezeugen, ein gewisser Wolf Stein. Das war mein Vorfahr mütterlicherseits. Weil die Gründungsfamilien streng darauf achteten, dass die jüdische Tradition lebendig blieb und neue Wurzeln trieb, konnte sich in Kuty im Lauf der Jahrhunderte eine genuin jüdische Lebensart entwickeln.
Die Eltern meines Vaters waren dagegen einfache Leute. Sie lebten in einer bescheidenen Mietwohnung am Rande der Stadt. Geboren wurde ich im Haus meines Großvaters mütterlicherseits, Abraham Stein, wo meine Eltern nach ihrer Hochzeit wohnten. Es war ein sehr großes Haus, und der ältere Bruder meiner Mutter, Jakov, lebte gleichfalls dort mit seiner Familie. Seine Frau hieß Sara, und sie hatten fünf Kinder, zwei Mädchen und drei Jungs. Onkel Jakov half Großvater in seiner Holzhandlung, wo noch weitere Juden beschäftigt waren. Mein Großvater war der größte Waldbesitzer in Kuty und lieferte sein Holz bis nach Czernowitz aus. Für seine Waldarbeiter, die alle Polen waren, hatte er einen polnischen Gutsverwalter, der auch für deren Entlohnung zuständig war. Ich sah diesen herben und grimmigen Mann immer dann, wenn er kam, um den Lohn für die Waldarbeiter abzuholen. Mein Großvater hatte nichts mit ihm zu tun. Die Geschäfte führte meine Großmutter, und von ihr bekam er auch das Geld. Überhaupt kümmerte sich mein Großvater mehr um Thora und Talmud und weniger um die banalen, alltäglichen Angelegenheiten. Für seine Arbeiter hatte er freilich immer Zeit und ein offenes Ohr.
Während meiner ganzen Kindheit lebte ich in ständigem Kontakt mit den einfachen Arbeitern unseres Volkes. Wie gerne betrat ich die vom feuchtwarmen Dampf der Bügeleisen erfüllte Werkstatt des Schneiders, in der die Gesellen zum Klappern der Nähmaschinen alte jiddische Volkslieder sangen: »Unter Jankeles Wiege, da liegt eine goldene Ziege …« oder das besonders beliebte und inzwischen weltbekannte Lied Tumbalalaika:
Steiít a bocher un er trachtet,
trachtet und trachtet a ganze nacht,
wemen zu nemmen un nicht farschemen.
Tumbala, tumbala, tum-balalaika …
Mei’dl, mei’dl, ich will bai dir freigen,
wos ken waksen, waksen ohn regn?
Wos ken brennen un nischt oifheren?
Wos ken benken, weínen ohn trenen?
Tumbala, tumbala, tum-balalaika …
Narrischer bocher, wos darfst du freigen?
A stein ken waksen, waksen ohn regen;
Liebe ken brennen und nicht verbrennen,
a harz ken benken, weinen ohn tränen.
Es steht ein Jüngling und überlegt
überlegt und überlegt, eine ganze Nacht
Wen zu nehmen und sich nicht zu schämen
Tumbala, tumbala, tum-balalaika
Mädchen, Mädchen ich will dich fragen
Was kann wachsen, wachsen ohne Regen?
Was kann brennen und nicht verlöschen?
Was sorgt sich mit Weinen ohne Tränen?
Dummer Junge, wozu fragst du?
Ein Stein kann wachsen ohne Regen
Liebe kann brennen und nicht verlöschen
Ein Herz kann sich Sorgen machen und weinen ohne Tränen.
»Wann singt ein Jude?«, fragt man, und manche antworten: »Er singt, wenn er hungrig ist.« Andere sagen: »Er singt, wenn er traurig ist.« Aber am meisten singt er, wenn er verliebt ist oder Hochzeiten feiert.
Noch lieber war ich in der großen Holzhandlung meines Großvaters Abraham Stein, besonders um den Schindelschneidern zuzuschauen, wie sie riesige Holzklötze spalteten, um daraus Schindeln für die Dächer zu schnitzen. Während sie sich den Schweiß von der Stirn wischten, hörte ich sie murmeln: »Schema jisroeil adaunoi elauheinu adaunoi echod!« – Höre, Israel, unser Gott ist einzig, und du sollst lieben den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele.« Ich war voller Bewunderung für ihr männliches Handwerk und ihren festen Glauben.
Etwa 20 jüdische Arbeiter waren in der Schindelwerkstatt beschäftigt. Großvater kümmerte sich sehr um sie, und wenn einer von ihnen Sorgen hatte oder Geldprobleme, dann hat er immer geholfen. Sie hatten es gut bei ihm. Sie arbeiteten fünf Tage in der Woche. Freitag und Schabbat hatten sie frei. Am Donnerstagabend nach Beendigung der Arbeit saß meine Großmutter vor dem Ausgang und reichte jedem seine Lohntüte, damit er Geld für den Schabbat hatte, um das Notwendige einzukaufen. Freitags sollten sie Zeit haben, um den Schabbat vorzubereiten.
Denke ich an diese Juden zurück, wie ich sie täglich in den Gassen, auf dem Marktplatz, in Bethäusern und Studierstuben sah, so bringt mir die Erinnerung zweierlei Geräusche zurück: Seufzen, viel Seufzen und Ächzen, aber auch Gelächter, gutmütiges oder spöttisches, doch stets lautes Lachen. Chassidim brachten diese Lebensart vom Hofe ihres Zaddiks, des Wunderrabbis, zu dem sie immer wieder fuhren.
Meine Geburtsstadt hieß und heißt heute immer noch Kuty. Juden nannten sie liebevoll Kitew. Es war ein quirliges Schtetl mit etwa 10 000 Einwohnern, wovon die meisten Juden waren. Es gab auch einige Deutsche in der Stadt; Hermann Jäckel war der reichste unter ihnen, Mühlenbesitzer und Villenbewohner mit einem eigenen Generator für die Elektrizität und einem Telefonanschluss. Beides war den übrigen Bewohnern noch unbekannt. Es arbeiteten bei ihm nur Juden, und er war anständig und höflich zu ihnen, wie zu allen anderen Bewohnern der Stadt.
Mein Vater arbeitete als Buchhalter in der Mühle von Hermann Jäckel. Die Melzers waren, wie schon erwähnt, der ärmere Teil meiner Familie. Wohlhabend, wenn nicht sogar reich, war der Vater meiner Mutter, mein Großvater Abraham Stein. Er führte das Leben eines Großgrundbesitzers, während es bei uns zu Hause sehr bescheiden zuging. Aber weil mein Großvater seine Tochter, meine Mutter, liebte, sorgte er dafür, dass es uns an nichts fehlte, denn das Gehalt meines Vaters reichte nicht aus, um alles Lebensnotwendige zu bezahlen. Dennoch respektierte Großvater meinen Vater sehr, weil er als begabter Schüler und als Kenner des Talmuds galt. Das bedeutete damals für reiche jüdische Familien mehr als Geld. Während in der christlichen Welt Adel und reiche Familien unter sich heirateten, war es in der jüdischen Welt für die Reichen eine Ehre, einen begabten Talmudschüler zum Schwiegersohn zu nehmen, selbst – oder sogar ganz besonders dann – wenn er arm war. Der Vater der Braut verpflichtete sich, das junge Paar einige Jahre lang zu ernähren und dafür zu sorgen, dass der Schwiegersohn später auf eigenen Füßen stehen konnte. So besorgte Großvater Stein meinem Vater die Stelle beim deutschen Mühlenbesitzer, mit dem er geschäftlich zu tun hatte.
Es waren beinahe paradiesische Zustände, unberührt von der Hektik der damaligen Zeit. Das Schtetl lag eingebettet in einem Tal, umgeben von einem mächtigen Gebirgszug, den von Buchen, Eschen und Birken bewaldeten Karpaten. Soweit ich mich erinnern kann, war Kuty im Vergleich zu den benachbarten Orten sehr sauber. Die Straßen waren gepflastert, systematisch angelegt, und es gab sogar Bürgersteige; im Zentrum lag der große Marktplatz. Am oberen Ende des Marktes erhob sich ein zweistöckiges Gebäude in Hufeisenform. Dieses Haus gehörte meinem Großvater Abraham, und dort wohnten wir die letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg.
Großvater war ein entfernter Nachkomme des Hohen Rabbi Löw von Prag und des nicht minder berühmten Chacham Zwi aus Amsterdam. Was Ersteren betrifft, so erzählt die bekannteste der zahlreichen Versionen der Prager Golem-Saga, wie er sich große Sorgen wegen der zahlreichen Anschuldigungen machte, die seine Zeitgenossen gegen die jüdische Gemeinschaft erhoben. Und so lautet der Text, den ich hier zitieren möchte, da ich es selbst nicht besser schreiben könnte: »Im Jahr 1580 soll sich ein christlicher Geistlicher mit dem Namen Thaddäus erneut gegen die Juden gewandt und ihnen vorgeworfen haben, rituelle Morde zu begehen. Daraufhin hatte der Rabbi einen Traum, in dem der Himmel ihm auftrug, ein Menschenbild aus Lehm zu erschaffen: »Erschaffe ein Menschenbild aus Lehm, und du wirst der Böswilligen Absicht zerstören.« Um den Golem zu erschaffen, ging er mit einem seiner Schüler und einem Diener zu einer Lehmgrube an der Moldau. Dort kneteten sie aus der formlosen Masse eine menschliche Figur, um die sie dann siebenmal liefen und daraufhin mehrere Formeln sprachen. Der Golem erwachte zum Leben. Er war ausdruckslos, nur seine Augen leuchteten rot. Es ist nicht genau überliefert, wie er aussah, es steht aber fest, dass er sehr groß war und ungeheure Kräfte hatte. Die meiste Zeit saß er reglos zurückgezogen in einem Winkel der Stube des Rabbis. Mit einem Amulett aus Hirschhaut konnte dieser ihn unsichtbar machen. Und wenn er einen Auftrag für den Golem hatte, legte er ihm ein mit Zaubersprüchen beschriebenes Pergament in den Mund. Die meisten Aufträge, die der Rabbi ihm gab, bezogen sich auf die Bekämpfung der diversen widerlichen Blutbeschuldigungen. Der Golem patrouillierte dabei nachts im jüdischen Viertel. Er hielt jeden an, der eine Last trug. War die Last eine Kinderleiche, die zum Zwecke der Beschuldigung der Prager Juden in ihrem Viertel abgelegt und aufgefunden werden sollte, wurde der Überführte den hohen Leuten im Stadthaus übergeben.
Als 1593 wieder Ruhe eingekehrt war, nicht zuletzt dank eines Gesetzes, das die Blutbeschuldigung unter Anklage stellte, beschloss der Rabbi, den Golem wieder den Elementen zurückzugeben. Wieder ging er mit seinen Vertrauten zur Lehmgrube und vollzog das Ritual in umgekehrter Reihenfolge. Dann verstauten sie die Überreste in Rabbi Löws Dachstube. Bis heute sollen sie dort noch liegen.«
Eine andere Version berichtet, dass Rabbi Löw ein Pergament mit einer Zauberformel im Mund des Golems vergessen hatte, der Golem Amok lief und deswegen beseitigt werden musste.
In diesen Zeiten verbreitete sich der Chassidismus in Osteuropa. Auch meine Familie war davon berührt. Den Schritt zum Chassidismus tat mein Urgroßvater Schalom Stein. Er war, wie man so sagt, ein »seidener« Mensch, ganz ungewöhnlich gelehrt, von vollendeter Frömmigkeit und mit allen Tugenden reich gesegnet. Rabbiner wollte er aber aus Bescheidenheit nicht werden. Sein Wunsch war, ein gewöhnlicher Geschäftsmann zu sein, ein Holzhändler zu werden wie sein Vater. Doch meistens saß er über seinen heiligen Büchern gebeugt und studierte den Talmud. Die Holzgeschäfte führte seine Frau, die dazu auch noch den Haushalt beaufsichtigte. Das war aber keineswegs ungewöhnlich. Überall führten bei wohlhabenden chassidischen Geschäftsleuten die Frauen die Geschäfte, und die Männer konnten sich dem Studium der Thora und des Talmuds widmen.
Mein Großvater wurde also, so wie sein Vater, von dem er das Geschäft geerbt hatte, Holzhändler. Holz gab es in den Wäldern der Umgebung genug. Mein Großvater trug einen dichten weißen Bart und sah mit 40 schon wie ein alter Mann aus. Er spendete viel Geld für wohltätige Zwecke. In seiner jüdischen Gemeinde war er sehr aktiv und half dem, der Hilfe bedurfte. Seine Gemeinde war die der Chassidim, die sich in der Kleidung nicht nur von den Konservativen, sondern noch deutlicher von den Liberalen unterschieden.
Die Juden vermieden es in der Regel, zu den staatlichen Gerichten zu gehen, und regelten ihre Streitigkeiten unter sich. Natürlich musste alles später vom Rabbiner gesegnet werden. Unser Rabbi war ein fröhlicher Chassid, stets zu einem jiddischen Witz aufgelegt, und damit ein scharfer Kontrast zu den konservativen Rabbis, die immer streng, humorlos und ernst auftraten. Bei uns hielt man sich an die Lehre von Rabbi Hillel, der predigte: »Was Du nicht willst, dass man es Dir tut, das füg auch keinem anderen zu.«
Großvater Abraham Stein
Besonders deutlich wurde der Unterschied am Pessachfest. Bei den Konservativen reichte ein Becher Wein für die ganze Zeremonie beim Abendmahl, bei dem man zur Heiligung des Namens, zum Segnen des Mahls und zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten koscheren Wein trinkt. Auf dem Tisch stand auch ein voller Becher für den Propheten Elijahu (oder Elijas), der als Gast erwartet wurde, von dem man aber wusste, dass er nie kommen würde. Bei den Konservativen nippte der Rebbe beim »Kiddusch« nur am Becher, und am Ende der ganzen, langen Zeremonie lautete der Segensspruch: »Nächstes Jahr in Jerusalem«.
Bei den Chassidim hingegen trank der Rebbe bei jedem Segensspruch den vollen Becher aus, und einer der Schüler war immer dafür verantwortlich, ihn mit koscherem Wein aufzufüllen. Nach dem fünften oder sechsten Spruch war der Rebbe beschwipst und am Ende leicht betrunken, so dass er nach der Zeremonie auf den geräumten Tisch stieg und anfing zu tanzen. Er blieb allein da oben, die anderen tanzten auf dem Boden, denn man hatte Angst, dass der Tisch die Last nicht tragen könne. Und so tanzte man bis in den frühen Morgen, bis alle vor Erschöpfung umfielen.
In der chassidischen Synagoge, oder wie wir sie nannten, in der »Schul«, herrschte immer ein fröhliches Durcheinander, besonders weil man die Kinder machen ließ, was sie wollten. Die Erwachsenen sprachen mehr über ihre Geschäfte, anstatt sich dem Gebetbuch zu widmen, und manch erfolgreiches Geschäft wurde zwischen zwei Gebeten beschlossen. Die Frauen saßen auf der Galerie und blickten auf die Männer herunter. Auch sie redeten ununterbrochen miteinander, und nur Gott weiß, was sie sich zu sagen hatten. Möglicherweise tauschten sie Backrezepte aus oder verkuppelten ihre Töchter und Söhne, möglichst gut und teuer. Wenn der Sohn eines reichen Honoratioren Bar-Mizwa feierte, wurden Süßigkeiten verteilt und von den Frauen auf der Galerie heruntergeworfen; für die Erwachsenen gab es nach dem Gebet einen Umtrunk.
Besonders beliebt waren bei mir die Mahlzeiten am Schabbat. Da gab es immer meine Lieblingsspeise, die »Kreplach«, Knödel oder dreieckige Taschen aus unvergorenem Teig, gefüllt mit feingehacktem Fleisch. Kreplach wurden nur an Samstagen und Feiertagen gemacht. An letzteren, zum Beispiel Pfingsten, werden sie jedoch nicht wie üblich mit Fleisch gefüllt und auch nicht in Suppe gekocht, sondern in Töpfe gefüllt und gesondert gekocht. Wer die Kreplach meiner Großmutter nicht gegessen hat, hat noch nie in seinem Leben richtige Kreplach gegessen.
Hinter dem Haus meines Großvaters standen die Kirchen der drei verschiedenen christlichen Konfessionen, jeweils mehrere hundert Meter voneinander entfernt. Die größte war die römisch-katholische der Polen. Die Ruthenen hatten ihre etwas kleinere griechisch-orthodoxe, und die kleinste war die protestantische Kirche, in welche die meisten Deutschen gingen.
Es gab eine Hauptsynagoge und mindestens 20 Bethäuser für die Anhänger der untereinander zerstrittenen chassidischen Rabbis. Mein Großvater war auch ein Chassid, jedoch einer von sanfter, milder Natur. Ihm war jede Art von Zelotentum fremd, ohne dass er dabei auch nur ein Jota der 613 Gebote und Verbote missachtete. Ihm galten meine große kindliche Liebe und Verehrung.
Unter seinen Fittichen bin ich bis zu meinem siebten Lebensjahr herangewachsen, nur der unselige Krieg 1914 konnte mich von ihm trennen, ihn aber nicht vergessen lassen. Sein Bild hängt über meinem Schreibtisch. Über seinem Antlitz mit dem schlohweißen Bart schwebt eine Aureole von Güte und Weisheit, die mich immer noch tief beeindruckt. Es verging kein Tag, an dem er nicht »lernte« oder einen Traktat des Babylonischen Talmuds mit melodischem Gesang vortrug. Seine Gottesfurcht und -liebe war nicht nur Lippenbekenntnis, sondern voll warmer Herzensgüte für Menschen und Tiere. Ich entsinne mich noch sehr deutlich, wie er mich bei einem Spaziergang am Schabbat davor warnte, einen Wurm zu zertreten. »Dieses ist ein Geschöpf Gottes, mein Kind, wir dürfen es nicht töten.«
Ich erlebte, wie er jeden Morgen inbrünstig sein Morgengebet sprach – nein –, sogar sang: »Mit großer Innbrunst hast Du uns geliebt, Ewiger, unser Gott! Mit großer und überschwänglicher Barmherzigkeit Dich unser erbarmt, unser Vater und König! Um unserer Väter willen, die auf Dich vertraut und denen Du die Lehren des Lebens erteiltest, sei auch uns gnädig und belehre uns, unser Vater, Barmherziger, Gnadenreicher! Erbarme Dich unser und gib uns in das Herz, all die Worte der Belehrung aus Deiner Lehre zu verstehen und zu erkennen, zu hören, zu lernen und zu lehren, zu bewahren und auszuüben.«
Und so ging es noch lange weiter, und wenn er fertig war, wusch er sich die Hände und nahm sein Frühstück ein. Am Schabbat sprach er noch den Kiddusch, bevor er das Brot an alle Anwesenden verteilte.
Mein Großvater war eine Zeitlang der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Kuty. Er war nicht nur für Streitigkeiten als Schlichter oder, wenn er nicht zu schlichten vermochte, als Richter zuständig. Manchmal hielt er auch Grabreden für besonders beliebte und vornehme Verstorbene. Im Kuty von heute gibt es keine Gräber, die an die verstorbenen Vorfahren erinnern. Das Jüdische ist aus der Stadt vollständig verschwunden, wahrscheinlich verbrannt, so auch die Geburten- und Todesbücher, die seit Urzeiten geführt wurden. Mein Großvater starb 1926 nach einer langen, unheilbaren Krankheit. Ich dachte an den Spruch aus der Thora: »Warum wird der Gerechte mit Leiden bestraft, der Bösewicht dagegen lebt in Wohlstand?«
Alles in allem hatte ich dennoch eine glückliche Kindheit. Ich musste seit meinem dritten Lebensjahr im »Cheder« hebräisch lesen und beten und schließlich die Bibel übersetzen lernen. Cheder nannte man den Raum, der gewöhnlich von einem bettelarmen Lehrer bewohnt wurde und in dem der Unterricht abgehalten wurde, in dem aber auch seine Frau und seine zahlreichen Kinder lebten, aßen und schliefen. Aber es gab auch reichlich Gelegenheiten, mit Gleichaltrigen zu spielen, im Sommer im Tscheremosch zu baden und im Winter Schneeballschlachten zu veranstalten. Es war eine heile Welt – und für uns Kinder ein Paradies. Wir kannten keine unmittelbare Feindseligkeit gegenüber uns Juden, denn alle Religionen im Schtetl pflegten gute Beziehungen zueinander.
Mein bester Freund hieß Schalom, und sein Vater war Fuhrmann. Ein Fuhrmann ist aber den ganzen Tag unterwegs und verdient dabei wenig Geld. Pinchas aber, Schaloms Vater, wollte bei seinem kleinen Sohn bleiben. Er ließ also den Wagen Wagen sein und siedelte nach Kuty über. Über Nacht wurde aus ihm ein Schneider. Nun war aber in Kuty bereits jeder achte Jude Schneider. Und sich schön herauszustaffieren war nicht die Sache der Juden. Beim Feiertagskaftan handelte es sich meist um ein Erbstück, das vom Vater auf den Sohn bis ins dritte und vierte Geschlecht weitergegeben wurde. Wenn der Wochenkaftan etwas zerfranst war, so machte das auch dem Reichsten nichts aus. Arbeit gab es wenig und Geld noch weniger. Die Eltern meines Freundes Schalom waren arm. Sie hatten nicht einmal das Geld für einen Lehrer, der das Söhnchen Gottes Wort hätte lehren können. Zum Glück erlaubte aber mein Großvater, dass Schalom zusammen mit mir in den Cheder ging, und zahlte dafür das Schulgeld. So lernten wir beide gemeinsam die Thora und übten das Hebräische. Alphabet: Aleph, Beth, Gimel, Daleth und so weiter.
Kuty war wie Hunderte anderer Städtchen, in denen bis 1942 die jüdische Bevölkerung Galiziens, Russisch-Polens, Litauens, Weißrusslands und der Ukraine auf engstem Raum zusammengepfercht lebte. Am Rande der Stadt floss langsam und ruhig der Tscheremosch. Dieser Fluss kennzeichnete die Landesgrenze zwischen Galizien und der Bukowina. Es war keine Reichsgrenze, sondern nur eine offene Landesgrenze. Die nächstgelegene Stadt in der Bukowina, auf der gegenüberliegenden Seite des Tscheremosch, hieß, wie gesagt, Wischnitz. Sie war der Sitz des berühmten Wischnitzer Rebben Chaim Meir Hager und bis zu ihrem Wegzug nach Wien der Wohnort meiner Tante, der Schwester meiner Mutter.
Die Bukowina mit ihrer Hauptstadt Czernowitz war die östlichste deutsche Provinz mit einer deutschsprachigen Universität, mehreren deutschen Tageszeitungen sowie einem deutschen Theater. Mit der Vernichtung der Juden ist auch diese deutsche Kulturstätte untergegangen. Besonders die deutschen Verleger spürten das, denen ein großer Buchmarkt verloren ging, denn es gab kein jüdisches Haus östlich von Wien, in dem nicht die deutschen Klassiker fein geordnet im Bücherregal standen. Von Kuty in nördlicher Richtung lag die Stadt Zablotow, was »hinter den Pfützen« bedeutet. Dort wurde der deutsch-jüdische Schriftsteller Manès Sperber geboren, dort wohnte auch eine andere Schwester meiner Mutter, die einen reichen Juden geheiratet hatte, der Gutherz hieß.
Wie ich bereits erwähnt hatte, war mein Vater als Buchhalter bei dem deutschen Mühlenbesitzer Hermann Jäckel beschäftigt. Eigentlich wollte Großvater, dass er Kaufmann wird. Er beschloss, ihn in die kaufmännische Lehre zu Onkel Schmuel nach Czernowitz zu schicken, der dort eine große Tuchhandlung besaß. So fuhr er mit ihm eines Tages mit dem Pferdefuhrwerk bis zur Eisenbahnstation und von dort mit der Eisenbahn in die »Großstadt« Czernowitz. Beim Onkel angekommen, nahm dieser sofort meinen Vater zur Seite und fragte ihn:
»Was machst du, wenn eine Bäuerin kommt und rotes Tuch haben will und du hast aber nur blaues?«
Mein Vater soll äußerst verlegen geguckt und gestottert haben:
»Ich bestelle für sie rotes Tuch.«
»Taugt nicht, taugt nicht«, schrie der Onkel verzweifelt. »Was heißt schon, sie will rotes Tuch? Sie ist Bäuerin, sie hat nichts zu wollen, und du musst ihr verkaufen, was du hast, und nicht, was sie will.«
Damit endete die Karriere meines Vaters als Kaufmann, noch bevor sie begonnen hatte. Enttäuscht, aber erleichtert kam er nach Kuty zurück. Er wollte kein Kaufmann, sondern Schriftsteller werden. Schon früh hatte er sich von der jüdischen Tradition gelöst, lebte schon im Schtetl als »Freigeist« und nahm, wenn er zum Gebet in die Synagoge ging, immer irgendeinen deutschen Klassiker mit, den er unter seinem Gebetbuch versteckt hatte. Während alle anderen inbrünstig beteten, las er Goethes Faust und Schillers Räuber oder Kleist und Heine. Oh, Heine, den mochte er ganz besonders. Er pflegte, seine Gedichte auswendig zu lernen, verschlang seine Reisebeschreibungen und träumte davon, diese Reisen eines Tages selbst zu machen. Er war aber auch ein profunder Kenner der rabbinischen Literatur, des Talmuds und der Kabbala, und auch das Buch Zohar stand später in seinem Bücherregal neben den deutschen Klassikern. Nicht zuletzt deswegen respektierte und mochte ihn der Vater meiner Mutter, Großvater Abraham Stein, und das war auch der Grund, warum er ihm seine Tochter zur Frau gab.
Mein Vater war ein sehr strenger und jähzorniger Mann. Bis zu seiner Heirat lernte er in der »Jeschiwa«, wie man die Hochschulen für Talmudschüler nannte, und war von seinen Eltern als Rabbiner auserkoren. Nach dem Tod seines Vaters rasierte er sich seinen Bart ab, entledigte sich seiner Schläfenlocken, stutzte seinen Kaftan zu einem kurzen Jackett und wurde ein »Abtrünniger«. Er besuchte keine staatliche Schule und eignete sich autodidaktisch ein respektables Wissen an. So eignete er sich zum Beispiel die Buchführung aus einem gewöhnlichen Rechenbuch an.
Später in Berlin war er bei privaten Unternehmen beschäftigt, und seine Bilanzen waren beim Finanzamt als einwandfrei anerkannt. Seine Korrektheit war sprichwörtlich in jeder Beziehung. Er kam pünktlich um 13 Uhr zu Mittag und wehe, wenn das Mittagessen nicht zur Stelle war. Dann verließ er wortlos das Haus, was für meine Mutter die schlimmste Strafe bedeutete. Auch die Kinder mussten parieren und Knetmasse in seinen Händen sein. Als Ältester hatte ich am meisten darunter zu leiden. Es hagelte Schläge für jede Unartigkeit, beziehungsweise das, was Erwachsene darunter verstanden. Mein Vater führte ein Notizbuch über meine »Verfehlungen«, und wenn das Maß voll war, wurde die Weidengerte hervorgeholt, meine Hosen heruntergelassen, und auf den nackten Popo bekam ich die Schläge zugezählt, die mir nach seinen Berechnungen zustanden. Es ging nicht ohne dramatische Höhenpunkte ab: Ich schrie, weil es weh tat, wie ein zum Abstechen gezerrtes Schwein. Meine liebe Mutter konnte dieser Schlägerei nicht zusehen und entfloh zu ihren alten Eltern, bei denen sie wohnen blieb, bis sie und mein Vater sich wieder versöhnten.
In seinem Bücherschrank standen nicht nur die deutschen Klassiker in der bekannten populären und preiswerten Ausgabe des Verlages Bong & Co. Mein Vater war auch in der modernen hebräischen Literatur bewandert. Er gehörte zu jenen unglücklichen ostjüdischen Menschen, die zwischen zwei Welten hin- und hergerissen waren, von der einen ausgestoßen, von der anderen nicht aufgenommen. Sein Deutsch war so perfekt und schön, dass mein Lehrer in der Volksschule in Berlin, als er einen Entschuldigungsbrief meines Vaters gelesen hatte, mich fragte, wo mein Vater studiert habe. Er starb im Jahre 1929 in Berlin, wo er im Jüdischen Friedhof in Weißensee seine letzte Ruhestätte fand. Zu seinem Glück hat er den Untergang der deutschen Kultur und die Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht mehr erleben müssen. Auch mit dem Sterben muss man Glück haben.
Ich war als Kind der Obhut meiner Großeltern anvertraut und fand bis zu meinem sechsten Lebensjahr bei ihnen ein Zuhause. Mit drei Jahren wurde ich von einem »Behelfer«, unserem Hausknecht, zum Cheder gebracht, wo den Kindern vom Rebben Mejer, der Rojter die Thora und Hebräisch beigebracht werden sollte. Der »Behelfer« trug mich auf seinen Schultern, und da er ein großer Goi war, thronte ich hoch über allen und genoss es, in den Cheder gebracht zu werden. Mein Freund Schalom lief uns hinterher.
Der »Behelfer« hieß Karl und war Pole. Er verstand aber auch Jiddisch. Eigentlich war er mein bester Freund. Er machte jeden Unsinn mit, um mich zu erheitern und bei Laune zu halten. Donnerstags, wenn Markttag war und wir vom Cheder nach Hause gingen, machte er einen Umweg über den Marktplatz und kaufte uns, Schalom und mir, von dem wenigen Geld, das er hatte, ein Zitroneneis. Und manchmal, wenn es im Sommer erbarmungslos heiß war, ging er mit uns runter zum Tscheremosch, und ich durfte meine Schuhe ausziehen und ins Wasser treten, allerdings nur so weit, dass er mich jederzeit packen konnte, sollte ich den Versuch unternehmen, mich vom Ufer zu entfernen.
Karl gehörte zur Familie. Er wohnte bei uns, aß mit uns, und einmal im Jahr ging meine Großmutter mit ihm auf den Marktplatz und kaufte ihm neue Kleider und neue Schuhe, wenn seine vom vielen Laufen abgetragen waren. Die Tatsache, dass er kein Jude war, störte uns überhaupt nicht, und eigentlich war es für uns von Vorteil, weil er auch unser Schabbes-Goiwar und am Schabbat alle Arbeiten für uns verrichtete, die den gläubigen Juden verboten sind, wie zum Beispiel Licht an- und ausmachen, kochen und den Tisch decken und abräumen. Im Winter holte er Holz für den Ofen und sorgte so immer für wohltuende Wärme.
Der Unterricht im Cheder fand in der Wohnung des Lehrers statt. Die Lehrerwohnung bestand aus zwei Räumen, dem Klassenraum und der Küche. Im Klassenraum stand gegenüber der Tür ein langer Tisch, über dem an einem Draht eine Petroleumlampe hing. Auf zwei Bänken saßen zu beiden Seiten des Tisches die Schüler.
Das Unterrichtszimmer war klein, dunkel und feucht, da die Küchenwärme nicht ausreichte, um es richtig zu beheizen. Wir saßen im Winter in unsere Mäntel gehüllt, froren und versuchten, uns beim Singen der Thoraverse aufzuwärmen. Die Frau des Lehrers, eine verhärmte, älter aussehende jiddische Mamme, die immer ihre kleinen Kinder um sich hatte, schaute zwischendurch immer mal rein und fragte ihren Mann:
»Mejer, möchtest du einen Tee?«
Und Reb Mejer antwortete zumeist: »Ja, Channe, ein Tee wäre jetzt genau das Richtige.«
Augenblicklich kam einer der Kleinen mit einer noch dampfenden Tasse, und Mejer begann genüsslich zu schlürfen.
Diese Form des Unterrichts war in der Regel nur für Jungen. Er fand in kleinen Gruppen verschiedener Altersstufen statt. Reb Mejer, der Rojter, zeichnete das hebräische Alphabet auf die Wandtafel, zeigte mit seinem Stab auf den ersten Buchstaben und sagte laut »Aleph«, und die Kinder riefen laut »Aleph!« Und dann zeigte er auf den zweiten Buchstaben und sagte wieder laut »Beth«, und alle Kinder wiederholten im Chor »Beth!« und so weiter bis zu »Taw!«, dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets.
Mit demselben Stab schlug Mejer, der Rojter hin und wieder auch Schüler, die gestört oder einen Fehler gemacht hatten. Mich freilich nie, denn ich war der Enkel vom vornehmen und reichen Reb Abraham Stein, und Kinder von reichen und vornehmen Familien wurden nicht geschlagen. Dies war nur den armen Kindern vorbehalten. Und so lernte ich schon im zarten Alter, wie ungerecht die Welt ist und wie angenehm es ist, Enkel eines wohlhabenden Mannes zu sein. Die armen Kinder bekamen es wahrlich doppelt und dreifach und gingen manchmal mit blutigen Händen nach Hause.
Viel später, als ich Manès Sperber kennenlernte und mit ihm Kindheitserinnerungen austauschte, stellte ich fest, dass es bei ihm im Cheder genauso gewesen war. Mejer, der Roiter, war nicht der einzige Lehrer, der seine Schüler prügelte. Prügel gehörte zum Unterricht nach der talmudischen Weisheit: »Wer sein Kind liebt, züchtigt es.«
Auf dieser Grundlage studierte ich dann die Thora, beginnend mit dem dritten Buch Mose, und anschließend den Talmud, also die Mischna und Gemara und zusätzliche Kommentare.
Gegenseitiges Vorlesen und Auswendiglernen waren die vorherrschenden Lernformen. Im Alter von 13 Jahren wurde die Ausbildung im Cheder in der Regel mit der Bar Mizwa abgeschlossen. Neben dem Unterricht im Cheder, wo nur Jungen unterrichtet wurden, musste man ab dem siebten Lebensjahr in die staatliche Schule gehen, die auch Mädchen besuchten. Die Klassen waren allerdings pflichtgemäß nach Geschlechtern getrennt, wie es der Staat verlangte. Danach wurde man, wenn man begabt genug war, auf die Jeschiwa, die Talmudschule, geschickt. Meine Ausbildung wurde aber schon viel früher durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs abgebrochen.
Es waren etwa zehn Buben in meinem Alter, denen von einem bärtigen Juden das hebräische Alphabet beigebracht wurde. Den Spitznamen Rojter bekam er, weil er einen roten Bart hatte. Wir saßen von morgens bis abends im Unterricht, mit einer kleinen Mittagspause, und mussten dem Rebben die einzelnen Buchstaben des hebräischen Alphabets nachsprechen. Mittags kam der Behelfer und trug mich nach Hause, wo ein deftiges Mittagessen auf mich wartete, zubereitet von einer polnischen Hausfrau, einer »Schickse«, deren Kochkünste gottbegnadet waren. Nach dem Essen trug mich der Behelfer wieder zurück in den Cheder, und wir setzten den Unterricht fort. Mein Freund Schalom durfte zum Essen natürlich mitkommen und wurde von der Köchin besonders verwöhnt. Für ihn war es die einzige warme Mahlzeit am Tag. Zuhause bekam er kein Frühstück, und abends gab es bei ihm nur eine Scheibe Brot.
Nach etwa einem Jahr entschied mein Großvater, dass ich bei diesem Rebben bereits ausgelernt hätte und dass es Zeit sei, mich zu einem »höheren« Rebben zu schicken. Dieser lehrte die fünf Bücher Mose mit dem Kommentar von Raschi. Man nannte ihn Reb Lejbele Horb, das bedeutet »Buckel«, weil er verwachsen war und einen Buckel hatte. Sein richtiger Name lautete Leib Pasternack. Mit dem berühmten Maler Leonid Pasternak und seinem noch berühmteren Sohn, Boris Pasternak, war er allerdings nicht verwandt. Die beiden Rebben waren arme Teufel, die sich von ihrer pädagogischen Arbeit nur kümmerlich ernähren konnten.
Mit sechs Jahren wurde ich neuerlich in eine höhere Stufe versetzt, zu einem Rebben, der Talmud und Midrasch lehrte. Er hieß Mechel Horner und hatte keinen Spitznamen, obwohl er wegen seiner Kleinwüchsigkeit einen solchen verdient hätte. Er war zwar nur gut anderthalb Meter groß, aber von herausragender Intelligenz. Wie die meisten Ostjuden war er Autodidakt mit gründlichen Kenntnissen der unterschiedlichen europäischen sowie der lateinischen und griechischen Sprache. Im Gegensatz zu meinen vorherigen Rebben war er kein armer Mann. Er bewohnte ein geräumiges Haus in der »besseren« Gegend der Stadt, nahm nur Schüler von »besseren« Familien und ließ sich gut bezahlen. Zu diesem Lehrer begleitete mich Schalom nicht mehr, da mein Großvater die Kosten nicht mehr übernehmen konnte oder wollte und Schaloms Eltern das Geld nicht hatten. Bei ihm lernte ich die ersten Traktate des Talmuds. Er war mein letzter Rebbe. In Österreich bestand Schulzwang, und da Galizien damals noch zu Österreich gehörte, wurde ich im März 1914 mit sieben Jahren eingeschult. Im Juli des gleichen Jahres brach der Erste Weltkrieg aus, und damit war die Schule auch schon wieder zu Ende.
Ich habe dort für mein künftiges Leben kaum etwas mitbekommen. Mensch zu sein habe ich nämlich vor allem bei meinem Großvater gelernt. Als ich ihn einmal fragte, warum die Gojim uns Juden so sehr hassen und, warum wir Juden die Gojim hassen, schwieg er lange, bevor er mir antwortete: »Mein lieber kleiner Joseph, ich hoffe, du wirst verstehen, was ich dir jetzt sage. Es steht schon in der Bibel geschrieben, dass der Trieb des Menschen von Natur aus schlecht sei. Es steht da: ›des Menschen‹ und nicht ›des Juden‹ oder ›des Polen‹. Alle Menschen sind gleich, und es gibt gute Menschen und schlechte Menschen, überall und unter allen Nationen.«
Das habe ich verstanden und für immer behalten. Für mich waren Menschen immer Menschen, ganz gleich, ob sie Juden waren oder Gojim.
In Kuty gab es außer den Rebben, die den Kindern Unterricht erteilten, zwei »geistliche« Rabbiner, die in der jüdischen Gemeinde als Autoritäten in der Auslegung der talmudischen Gesetze fungierten. Der eine war Jakob Schorr, ein »offizieller«, das heißt ein von der Regierung anerkannter und bezahlter Rabbiner. Der zweite war Chaim Gelernter, ein »inoffizieller« chassidischer Rebbe, der von seinen Anhängern entlohnt wurde. »Jankele« Schorr, wie man ihn liebevoll nannte, war ein gelehrter Mann, nicht nur in der rabbinischen Wissenschaft. Er hatte in der Jeschiwa in Frankfurt am Main bei Samson Raphael Hirsch studiert und war Mitarbeiter der Gesellschaft »Mekiz Nirdamim« (»Erwecker der Dämmernden«), wo er regelmäßig in der Vierteljahresschrift der Gesellschaft seine wissenschaftlichen Abhandlungen veröffentlichte. Einer seiner Söhne arbeitete als Professor für romanische Sprachen an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Von dem Rebben Chaim Gelernter ist mir nur bekannt, dass er eine große Bibliothek seltener rabbinischer Schriften besaß.
Das Leben im Schtetl war mühselig für die Armen, aber angenehm für die Wohlhabenden und Reichen. Vor allem spürten wir nichts vom Judenhass oder dem, was man landläufig Antisemitismus nannte. Wir waren frei und konnten machen, was wir wollten. Wir kannten auch nichtjüdische Kinder, Scheigez genannt, mit denen wir zwar nicht befreundet waren, aber mit denen wir spielen durften. Und wenn sie uns von Zeit zu Zeit verprügelten, so nahmen wir ihnen das nicht sonderlich übel und verprügelten unsererseits, wenn sich die Gelegenheit bot, auch einige von ihnen. Wir fühlten uns nicht minderwertig, und auch die Beziehungen unter den Erwachsenen waren vollkommen entspannt und frei von Hass und Vorurteilen. Das nichtjüdische Personal im Haus meines Großvaters gehörte fast zur Familie, wurde geachtet und bei Geburtstagen und christlichen Feiertagen immer beschenkt.
Judenhass habe ich erst viel später im Deutschland der zwanziger und frühen dreißiger Jahre kennengelernt. Ich wundere mich heute über all die klugen, aber unwissenden Leute, die leichtsinnig und voller Überzeugung behaupten, im Osten seien »alle« Antisemiten gewesen. Es war allenfalls ein Antisemitismus, der aus Vorurteilen und Unwissenheit bestand, und keineswegs aus Hass. Man hatte Vorurteile gegenüber Juden und war dennoch mit ihnen befreundet.
Meine Mutter hat mit 21 Jahren meinen Vater geheiratet und ihm sechs Kinder geboren, wovon nur vier am Leben blieben. Sie war eine gute Frau und eine liebevolle Mutter, die sich seit dem Ersten Weltkrieg abmühte, ihre Kinder großzuziehen. Man nannte sie Mechla, was wohl eine Verballhornung von Michaela war. Sie hatte die Schule in Kuty besucht, konnte Deutsch und Polnisch lesen und schreiben sowie Gedichte in beiden Sprachen aufsagen. Sie starb mit 85 Jahren in Israel, während mein Vater nur 49 Jahre alt wurde.
Die ersten Keime des Chassidismus hatten ihren Anfang in der Stadt Kuty genommen. Der Begründer des Chassidismus, Israel Baal Schem Tov, lebte in den Wäldern in der Umgebung der Stadt und heiratete eine Schwester des ansässigen Rabbiners Gerschom Kutower. So hat diese kleine Gemeinde in der Geschichte des Chassidismus ihren ruhmvollen Platz errungen. Aber auch in der neuzeitlichen zionistischen Bewegung hat ein Sohn dieser Stadt einen herausragenden Platz eingenommen: Die Rede ist von Berl Locker – einem Vetter meines Vaters –, der über mehrere Jahre Präsident der Zionistischen Weltorganisation war. Sein Vater hieß Jakob Schattner und arbeitete als Hebräischlehrer. Sein erstgeborener Sohn Berl nannte sich nach dem Familiennamen seiner Mutter, da die elterliche Ehe nicht standesamtlich registriert worden war. Orthodoxe Juden scheuten das »christliche« Standesamt, und die Regierung wiederum erkannte rabbinische Eheschließungen nicht als gesetzesgültig an.
Berl Locker war alles andere als ein frommer Jude. Er verachtete die Religion und gab sich durch und durch säkular und sogar antireligiös. Eines Tages traf man ihn angeblich in einem koscheren Restaurant, und seine Freunde wunderten sich: »Du hier? Seit wann isst du koscher?« Darauf antwortete Berl gewitzt: »Ich esse nur ein Ei!« Nun muss man wissen, dass ein Ei weder koscher noch nicht koscher ist und man es deshalb überall essen durfte. Berl Locker war es, der mir später geholfen hat, meine Familie aus Nazideutschland nach Palästina zu retten, indem er mir sogenannte »Affidavits«, Bürgschaften, beschaffte, mit denen meine Mutter und meine Geschwister 1938 nach Palästina ausreisen konnten.