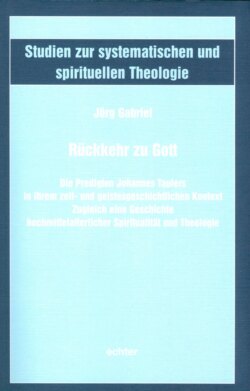Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 10
II. Taulers Nachwirken
ОглавлениеTaulers Predigten begründeten sein späteres Nachwirken bis ins 19. Jahrhundert hinein. Doch es fanden sich nicht nur Freunde, sondern auch Gegner. So ordnete beispielsweise der Ordensgeneral der Jesuiten, Mercurian, 1578/79 an, die Werke von Tauler dürften nicht ohne Erlaubnis gelesen werden, da sie dem Geist des Ordens nicht entsprächen.72 Der Grund hierfür liegt gewiss auch darin, dass Tauler in die Auseinandersetzung zwischen Protestantismus und Katholizismus geraten war. Da Tauler von Martin Luther (1483 – 1546) hoch geschätzt wurde, gewann er auch im Protestantismus an Bedeutung.73 Über seinen Ordensbruder Johannes Lang lernte Luther Taulers Predigten vermutlich 1515 kennen.
„Besonders in den entscheidenden Jahren der Neuorientierung seiner Theologie beschäftigte sich Luther mit den Predigten Taulers. Luther erwähnt Tauler seit 1515/16 bis in die dreißiger Jahre, besonders häufig und stets ohne Kritik zwischen 1516 und 152274
Der Ingolstädter Theologe Johannes Eck (1486 – 1543), der zunächst mit Luther brieflich befreundet war, dann zu seinem Gegner wurde75, ging 1518 in seiner Kritik an Luther auch auf Tauler ein. So wundert er sich, dass Luther einen in der Kirche unbekannten Prediger Gelehrten wie Thomas, Bonaventura und Alexander Halensis vorziehe.76 Tauler sei, wie Eck noch in einer Schrift von 1523 bemerkt, ein Träumer, der die von Luther aufgegriffenen Häresien verteidige.77 Martin Luther antwortete Eck in einem Brief vom 7. Januar 1519. Darin fordert er von Eck:
„Ich bitte Dich aber, bevor du ihn als [Träumer] bezeichnest, ihn selbst zu lesen. …Siehst du denn nicht, wie Du Dir Dinge, über die Du nicht nachgedacht hast, anzumaßen und sie zu verurteilen pflegst? … Bedenke, wie mir nicht unbekannt war, dass jener in Deiner Kirche unbekannt ist, als ich sagte, er werde in den öffentlichen Schulen nicht behandelt und sei nicht in lateinischer Sprache abgefasst; aus welchem Grund ich ihn dann den Scholastikern vorgezogen habe, weil ich nämlich bei ihm mehr gelernt habe als bei allen anderen. … Lies zuerst, damit man in Dir nicht einen inkonsequenten Richter sieht, der verdammt, was er nicht kennt. Und um nichts zu fordern, was über Deine Kräfte hinausgeht, mache ich mir keine Hoffnung, dass Du beim Zusammenkehren aller Deiner Scholastiker im Einzelnen auch nur einen Sermon zustandebringst, der diesem einen ähnlich ist. Ich fordere es nicht, weil ich dessen gewiss bin, dass Dir das unmöglich ist. Mit dem einen aber möchte ich Dich herausfordern: Strenge alle Deine Geisteskräfte an zusammen mit Deinem Vorrat an scholastischer Gelehrsamkeit, und zwar ganz, ob Du auch nur einen oder einen anderen Sermon dieses Mannes angemessen verstehen kannst. Danach werden wir überzeugt sein, dass jener für Dich zwar kein [Träumer] ist, Du aber ein Nachtwächter bist oder besser einer, der mit offenen Augen schläft.“78
Gegen Eck nahm auch der Benediktinerabt Ludovicus Blosius (+1566)79 Johannes Tauler in Schutz und verteidigte ihn 1551 in seiner „Apologia pro Ioanne Thaulero“, die der Neuauflage der lateinischen Surius-Taulerausgabe (Erstdruck 1548) sodann vorangestellt worden war.80 Die Apologie konzentriert sich auf drei Punkte:
„Auf die geistliche Ekstase und den dadurch gefährdeten kirchlichen Gehorsam, … die verbotene Lehre der Begarden [gemeint sind die „Brüder und Schwestern vom freien Geist“] und … die klösterliche Observanz.“81
Luthers Wertschätzung für Tauler ist nicht bloß für Luthers Theologie von Bedeutung geworden, sondern auch für die Spiritualität innerhalb der Reformation, insbesondere für den linken Flügel:
„Spiritualisten wie Karlstadt, Hans Denck und Thomas Müntzer haben Taulers Botschaft von der Einigung der Seele mit Gott und der Nachfolge ins bittere Leiden Christi begierig aufgenommen; und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gehörten Taulers Predigten zur beliebtesten Andachtslektüre sowohl im Luthertum wie im Katholizismus. … Dieses außerordentliche Faktum der Spiritualitätsgeschichte hat seinen Ursprung in der Beschäftigung Luthers mit Tauler.“82
1565 erschien schließlich die erste Taulerausgabe, die nur für protestantische Leser bestimmt war.83 Diese und die folgenden Ausgaben (1588 und 1593 in den Niederlanden) wurden jedoch erheblich verändert, wie Hoenen nachweisen kann:
„So zeigt sich klar, dass genau die Punkte, die der katholischen Kirche zum Vorwurf gemacht wurden, wie die Lehre der Sakramente, vor allem der Messe und der Beichte, das Klosterleben und die Rolle der Theologie, aus den Predigten getilgt worden sind.“84
Im Gegenzug brachte der Karmeliter Carolus a St. Anastasio 1660 eine Edition für katholische Gläubige heraus, in welcher er Tauler einen „katholischen Lehrer“ nennt.85 Die Bedeutung, die Tauler für Luther und für weite Kreise des Protestantismus einnahm, war vermutlich auch einer der Gründe, warum Taulers Predigten und die ihm zugesprochenen Schriften schließlich ab 1590 durch einen Entscheid Papst Sixtus´ V. auf dem Römischen Index standen.86 Das alles tat der Popularität Taulers jedoch keinen Abbruch, wie die Geschichte der Forschung, der Überlieferung und Drucktradierung der Predigten zeigt.87
1 Zu Leben und Lebenswelt Johannes Taulers Siehe vor allem McGinn 2008, 41 – 502; Gnädinger 1993, 9 – 103; Ruh 1996, 476 – 485; Scheeben 1961, 19 – 74.
2 Vgl. Gnädinger 1993, 9 – 12.
3 Vgl. Gnädinger 1993, 22; Filthaut 1961, 97ff.
4 Vgl. Gnädinger 1993, 18 – 22.
5 Vgl. Eisermann 1992 (BBKL Bd. III), Sp. 574f.
6 Zahlreiche exegetische Werke sind verloren. Erhalten ist ein Commentarius in IV libros sententiarum sowie Quaestiones quodlibetales. Herausgegeben ist nur ein Abschnitt aus dem Sentenzenkommentar: Die Lehre des Johannes Theutonikus O.Pr. über den Unterschied von Wesenheit und Dasein (Cod Vatic. Lat. 1092), hg. von Martin Grabmann, in: Jb. f. Philosophie und spekulative Theologie 17, 1903,43 – 51; Quaestio ‚Utrum anima intellectiva sit forma corporis’, hg, von Artur Landgraf, in: DTh 4, 1926, 473 – 480; eine weitere Quaestio wurde von Martin Grabmann herausgegeben: MGLI, 395f. Vgl. Eisermann 1992 (BBKLBd. III), Sp. 575.
7 Siehe hierzu zweiter Teil.
8 Vgl. Gnädinger 1993, 20; RUH 1996, 478; Filthaut 1961, 94ff., 111 – 116.
9 Vgl. Hillenbrand 1997, 151 – 173; Langer 1997, 180f.
10 V 15, 69,36 (H 15a).
11 Vgl. Gnädinger 1993, 21; Ruh 1996, 479.
12 Vgl. Gnädinger 1993, 21f.
13 Vgl. Gnädinger 1993, 27, 65.
14 Vgl. Zekorn 1993, 28.
15 Vgl. Gnädinger 1993, 29f.
16 Siehe hierzu erster Teil, sechstes Kapitel.
17 Vgl. Gnädinger 1993, 67.
18 Siehe hierzu u.a. erster Teil, viertes Kapitel; zweiter Teil, viertes Kapitel.
19 Vgl. Gnädinger 1993, 65. Sehr deutlich wird das in der Verurteilung des freigeistigen Gedankenguts in der Konsititution „Ad nostrom qui“ des Konzils von Vienne 1312, in der Beginen und Freigeistige gleichgesetzt werden: DH Nr. 891 – 899, 388f.
20 Vgl. Gnädinger 1993, 66.
21 Vgl. V 44, 193, 16 – 19 (H 49).
22 V 60b, 287, 25 – 29 (H 18); vgl. V 36, 138, 1 – 10.
23 Vgl. Ruh 1996, 479; Prieur 1983, 421f.
24 Vgl. Strauch 1966, Brief LI, 263, 83.
25 Strauch 1966, 1 – 166.
26 Vgl. Gnädinger 1993, 96 – 103; RAPP 1994, 55 – 62. Zu Tauler und den Gottesfreunden Siehe u.a. dritter Teil, achtes Kapitel.
27 Als Schriften Merswins gelten: Sieben bisher unveröffentlichte Traktate und Lektionen, hrsg. Strauch 1927; Rulman Merswins Buch von den vier Jahren seines anfangenden Lebens, Des Gottesfreundes Fünfmannenbuch, hrsg. Strauch 1927, 1 – 27, 28 – 82; Merswins Neun-Felsen-Buch. Das sogenannte Autograph, hrsg. Strauch 1929.
28 Vgl. Gnädinger 1993, 87f.
29 Benedikt XII. (1334 – 1342), Clemens VI. (1342 – 1352).
30 Vgl. Hillenbrand 1997, 163 – 166; Gnädinger 1993, 30 – 33.
31 Dabei handelt es sich um die Hs. 277 der Stiftsbibliothek Einsiedeln, Bl. 221, a - b (vgl. Stammler 1961, 75f.).
32 Stammler 1961, 75.
33 Zu Tauler und Ruusbroec vgl. u.a. Ruh 1999, 20ff.; Ders. 1996, 481; Hoenen 1994, 398ff.
34 Vgl. Gnädinger 1993, 71 – 77.
35 Vgl. Gnädinger 2000, 81 – 84; Dies. 1993, 79 – 86.
36 Vgl. auch Hillenbrand 1997, 151 – 173; Gnädinger 1993, 22 – 27; Scheeben 1961, 37 – 74.
37 St. Markus, St. Agnes, St. Elisabeth, St. Johann, St. Katharina, St. Margareta und St. Nikolaus.
38 Vgl. Scheeben 1961, 37ff.
39 Vgl. Gnädinger 1993, 23.
40 Vgl. Scheeben 1961, 56f.
41 Vgl. Scheeben 1961, 42 – 50. 60 – 69.
42 Vgl. Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica IV, 1899, 130 I. 23-28: „Wir verordnen, dass die Provinzialprioren in den Fällen, wo sie bei Visitationen Konvente feststellen, die Mangel an Lebensmitteln leiden, sich bemühen, aus dem Überfluss reicher Brüder im Wege des Darlehens oder Geschenkes Geld flüssig machen, um diesem Mangel abzuhelfen.“ Vgl. Gnädinger 1993, 23; Scheeben 1961, 66.
43 Vgl. Gnädinger 1993, 23f.; Scheeben 1961, 66f.
44 Meyer, Johannes: Chronica brevis Ordinis Preadicatorum (Zit. n. Scheeben 1961, 72); Vgl. Scheeben 1961, 72ff; Gnädinger 1993, 24.
45 In den Straßburger Urkunden findet sich der Familienname Taulers in verschiedener Schreibweise: Tauller, Taweler, Tauweler, Thauler, Thaler (vgl. Gnädinger 1993, 10).
46 Vgl. Gnädinger 1993, 25. 55136.
47 V 56, 261,27ff. (H 70). Vgl. V 56, 261,18 – 26 (H 70).
48 Vgl. Gnädinger 1993, 26; Trusen 1988, 62ff.; Scheeben 1961, 69.
49 Vgl. Gnädinger 1993, 26.
50 Siehe hierzu: Borst 2007, 528 – 563.
51 Fritsche Closener, Straßburgische Chronik, Hrsg. von A.W. Strobel, Stuttgart 1842, 113 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, I). Vgl. Gnädinger 1993, 44.
52 Fritsche Closener, Straßburgische Chronik, Hrsg. von Strobel, Stuttgart 1842, 113.
53 Vgl. Fritsche Closener, Straßburgische Chronik, Hrsg. von Strobel, Stuttgart 1842, 113.
54 Vgl. Fritsche Closener, Straßburgische Chronik, Hrsg. von Strobel, Stuttgart 1842, 76ff.; Gnädinger 1993, 49.
55 Die eigentlichen Pestjahre waren Gnädinger 1993, 49 zufolge 1348, 1358, 1363 und 1381.
56 Vgl. Gnädinger 1993, 45.
57 Vgl. Gnädinger 1993, 49.
58 Offenbarung 16, 1.
59 Vgl. Gnädinger 1993, 47.
60 V 68, 374,20 – 24 (H 67).
61 Vgl. Fritsche Closener, Straßburgische Chronik, Hrsg. von Strobel, Stuttgart 1842, 83ff.; Gnädinger 1993, 47.
62 Vgl. Gnädinger 1993, 48.
63 Vgl. Gnädinger 1993, 52127.
64 Vgl. Gnädinger 1993, 52128.
65 Vgl. Gnädinger 1993, 55132.
66 Vgl. Gnädinger 1993, 55133ff..
67 Vgl. Seite 8f.
68 Vgl. Gnädinger 1993, 56 – 60.
69 V 9, 41,6 – 11.
70 Vgl. Gnädinger 1993, 60
71 Vgl. Ruh 1996, 479.
72 Vgl. Hoenen 1994, 408; Weilner 1961, 30f.
73 Vgl. Luthers Randbemerkungen zu Taulers Predigten in: Martin Luther, Werke, Bd. 9, Weimar 1893, 95 – 104; Bd. 45, Weimar 1911, 384: „Thaulerus hat ein sere gut wort von wenigen verstandn“. Vgl. Hoenen 1994, 409. Zu Luther und Tauler: Siehe Haas 1989(a), 264 – 294; Ficker 1936.
74 Gnädinger 1993, 413f.
75 Vgl. Bautz 1990 (BBKL Bd. I), Sp. 1452 – 1454.
76 Eck bezieht sich auf Luther, Resolutiones (WA 1, 557,25-32): „Ich weiß zwar, dass dieser Lehrer in den Schulen der Theologen unbekannt und deshalb vielleicht verächtlich ist; aber ich habe darin, obgleich das Buch in deutscher Sprache geschrieben ist, mehr von gründlicher und lauterer Theologie gefunden, als man bei allen scholastischen Gelehrten aller Universitäten gefunden hat oder in ihren Sentenzen finden könnte.“
77 Johannes Eck, De purgatorio contra Lutherum, Parisiis 1548, foll. 107 und 125 – 128. Vgl. Gnädinger 1993, 420; Haas 1971, 85.
78 Luther, WA Br. 1, 295/297, Nr. 132: „Verum rogo, antequam eum somniatorem definias, digneris perlegere. … Vides neque soleas inconsiderate praesumere et iudicare … Cogita, quam non ignorarim eum esse ignotum ecclesiae tuae, quando dixi eum in scolis publicis non haberi nec in lingua latina scriptum, dein qua ratione eum praetulerum scolasticis, quod plura in hoc uno didici quam in caeteris omnibus. … Sed age, ut non nescias quem, legas prius, ne insulsus iudex inveniaris, damnans, quod ignoras. Et ne exigam, quae ultra tuas vires sint, non opto, ut tu conflatis omnibus et singulis tuis scolasticis unum componas sermonem similem uni illius; non hoc exigo, certus, quod impossibilia tibi sunt. Sed hoc solum insulto: adhibe omnes nervos ingenii tui cum omni copia eruditionis tuae scolasticae, et totam. … si unum aut alterum sermonem eius intelligere digne possis. Postea credemus tibi illum esse somniatorem, te vero unum vigilatorem aut certe apertis oculis dormitantem.“
79 Zu Blosius: Siehe Hoenen 1994, 409ff.
80 Ludovici Blosii, Opera, Antwerpen 1632, 348: „Haec et his similia scribens Thaulerus, non demolitur, sed plurimum adiuuat stabilitque regularem Religionis obseruantiam.“ Vgl. Thery 1927, 44f.; Gnädinger 1993, 420.
81 Hoenen 1994, 412. Zu Blosius Argumenten im Einzelnen: Siehe Hoenen 1994, 409 – 414.
82 Haas 1989 (a), 270f.
83 Vgl. Gnädinger 1993, 420.
84 Hoenen 1994, 424; insgesamt Vgl. 414 – 424. Hoenen bietet darüber hinaus im Anhang eine Synopse des mittelhochdeutschen Textes, der protestantischen Ausgabe von 1565 und der niederländischen protestantischen Ausgabe von 1588 (427 – 444). Vgl. Mösch 2004, 4; Otto 2003, 183 – 214.
85 Vgl. Gnädinger 1993, 420.
86 Vgl. Gnädinger 1993, 418; Weilner 1961, 30; Reusch 1880, 24. Der erste Römische Index entstand 1559; seit 1571 gab es eine ständige Indexkongregation; 1966 wurde der Index außer Kraft gesetzt.
87 Zur Überlieferung und Drucktradierung Siehe Einleitung, viertes Kapitel.