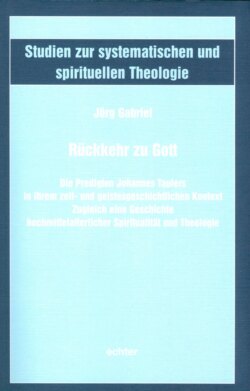Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 16
Erstes Kapitel Auslöser – Die Reformen Clunys und Papst Gregors VII.
ОглавлениеDie Ursprünge für die im 12. Jahrhundert sich entfaltenden religiösen Bewegungen1 sind sehr viel früher anzusetzen, nämlich in der monastischen Reform von Cluny (ab 908/910) und in der gregorianischen Reform unter Papst Gregor VII. (1073 – 1085).2
„Die kirchliche Reformbewegung unter Gregor VII. hat das Gefüge, den Ordo der hierarchischen Kirche vollendet, die sich auf die Idee der apostolischen Sukzession gründet und den Vollzug des christlichen Heilswerkes denen vorbehält, die mittelbar oder unmittelbar vom Nachfolger Petri und der Apostel dazu ordiniert sind. Gleichzeitig hat die monastische Reformbewegung, die von Cluny ausging, das Mönchtum aus einer Vielzahl vereinzelter, auf sich selbst gestellter Klöster in einen einheitlichen, zentralisierten Verband zu verwandeln begonnen und ihn der kirchlichen Hierarchie eingegliedert, indem sich die führenden Klöster unmittelbar der Kurie unterstellen.“3
Das Kraftzentrum, von dem eine geistliche Wende ausging, war in Frankreich die Gründung des Klosters von Cluny4 und dessen Reformbewegung sowie im deutschen Sprachraum das Reformkloster von Gorze5. Zum geschichtsmächtigeren Zentrum aber wurde Cluny6: In Frankreich (Burgund), nicht weit vom heutigen Taizé, wurde 909 durch Herzog Wilhelm (den Frommen) von Aquitanien das Kloster Cluny gegründet. Die neugegründete Abtei war kein Eigenkloster; sie wurde dem Einfluss jeglicher weltlicher aber auch geistlicher Gewalt entzogen. Auf die Abtswahl sollte niemand von außen Einfluss nehmen. Um die Freiheit des neuen Klosters zu gewährleisten, wurde es dem heiligen Stuhl unterstellt Von Cluny aus begann sodann die Reform der umliegenden Klöster. Immer mehr Klöster Frankreichs schlossen sich Cluny an, so dass eine cluniazensische Reformbewegung daraus wurde, die sich schließlich in Italien (seit Mitte des 10. Jahrhunderts) und Ende des 11. Jahrhunderts auch in Deutschland ausbreitete. Die cluniazensischen Klöster bildeten eine lockere Kongregation. Dem Abt von Cluny legten die Äbte der cluniazensischen Klöster den Treueid ab; dieser wurde somit zum „Abbas abbatum“, zum Abtprimas, der cluniazensischen Äbte. In Cluny wurde sozusagen, gleichsam Vorbild für die gregorianische Reform, ein geistliches, von Laienherrschaft freies Lehnsreich gegründet, das zentralistisch geleitet wurde. Auf eine strenge Observanz wurde größter Wert gelegt, auf verschärftes Stillschweigen, auf Verlängerung des Chorgebets.7 Die geistlichen Motive Clunys wirkten auch über die Klöster hinaus: die Idee von der Rückkehr zur Urkirche nach Apg 4, 32-34 durch brüderliches Zusammensein und Gütergemeinschaft. Das Kloster von Cluny wollte durch innere Freiheit und durch Loslösung von allem Weltlichen zu einem vorweggenommen himmlischen Jerusalem werden.
Vom zweiten Abt Clunys, Odo (Abt von 927 – 942) ging die Idee von einer Erneuerung der Christenheit durch ein erneuertes Mönchtum aus: „Nachdem 927 Odo Abt in Cluny geworden war, erlebte dieses einen gewaltigen Wachstumsschub. ... Odo trat mit einem Anspruch an, der zuvor allein in der Gründungsurkunde für Cluny ausgesprochen worden war: die Gründung einer mönchisch im Kloster lebenden Gemeinschaft als etwas aufzufassen, das dem Heil aller lebenden und verstorbenen Christen dienen sollte. Genau besehen war dies kein geringerer Anspruch als jener der Gesamtkirche, nur, dass er hier im Unterschied zur Gesamtkirche auf dem Boden der Erneuerung mönchischen Lebens im Kloster erhoben wurde. Weil Odo davon überzeugt war, ‚in der Zeit des gegenwärtigen Lebens ist alles derart in Unordnung, dass Du nirgends auch nur eine Spur der Wahrheit sehen kannst, wohl aber erkennen kannst, dass alles voller Bosheit und Luxus ist‘, dass der Welt ihr Ende droht, ‚die Zeit schon gekommen ist‘, ‚jegliche Ordnung der Religion und der Christenheit sich ins Schlechte verwandelt hat‘, ‚machte er sich keine Gedanken um das morgen‘, wollte er Seelen retten. Bei sich selbst hatte er damit angefangen, insofern er wie ein Mönch gelebt hatte, noch bevor er Mönch geworden war. Seine eigenen Eltern gewann er für das mönchische Leben im Kloster. ... Odo als Mönch und Abt hätte mit seiner Sorge um das Seelenheil nicht nur der Mönche, sondern auch aller Laien kaum ein Echo gefunden, hätte er seinen Zeitgenossen nicht unermüdlich das Bild christlichen Lebens vorgehalten, in dem er den Maßstab aller Erneuerung suchte: das Bild, das die Apostelgeschichte vom Leben der Urkirche in Jerusalem verkündet. ‚Dieses Leben‘, schrieb er, ‚ist die Art und Weise, wie Mönche zu leben haben, die das Gemeinschaftsleben bindet.‘ Wie die Apostelgeschichte beschreibt, allen sei alles in der Urkirche gemeinsam gewesen, wer Besitz gehabt hätte, hätte ihn den Aposteln zu Füßen gelegt, damit auch den Armen ihr Teil in der Gemeinde zugekommen wäre, so sah Odo darin das Vorbild für die Mönche, die auf persönlichen Besitz verzichteten und in ihrer freiwilligen Armut vom gemeinsamen Klosterbesitz zu leben bereit waren. Dieser könnte außer den Mönchen als den freiwillig Armen auch den Armen, die es unfreiwillig waren, dienen. Es mochte den höchsten Anspruch, den Odo erhob, wenn er mönchisches Leben im Kloster als Verwirklichung des apostolischen Vorbildes der Urkirche in Jerusalem verstand, in den Augen der Zeitgenossen glaubwürdig gemacht haben, wenn diese der Armut der Mönche in Cluny glauben konnten. ... Odo machte ... in der Gemeinschaft der Cluniacenser Ernst mit der Aufgabe, die ihnen, der Benediktsregel gemäß, in der Gründungsurkunde anvertraut war: täglich Werke der Barmherzigkeit für die Armen und die Pilger zu tun. Odo verlangte dieses jedoch von jedem Christen, besonders von solchen, die reich waren. ... Und aufs erstaunlichste wertete der begeisterte Mönch die Laien auf, wenn er ihnen ... vor Augen stellte, die Mönche seien engelgleich, wenn sie vollkommen lebten, gefallenen Engeln aber gleich, wenn sie zu weltlichen Wünschen zurückkehrten. ‚Unvergleichlich besser jedoch ist der gute Laie gegenüber dem Mönch, der sein Gelübde bricht.‘ Neu dürfte es in den Ohren der Adeligen geklungen haben, wenn ihnen Odo in einer Predigt, angelehnt an die Worte aus einer Predigt Papst Leos d. Gr., zurief, sie sollten erkennen, dass sie von königlichem Geschlecht und Teilhaber am priesterlichen Amt seien. Auch wenn sie die theologische Begründung dafür aus der Taufe nicht verstanden hätten, wäre ihnen nicht entgangen, wie ernst sie genommen und wie hoch sie gestellt wurden. ... Manche Adlige hat Odo mit seiner Begeisterung angesteckt, ihr Leben am Maßstab der Urkirche mönchisch zu erneuern.“8
Papst Gregor und seine Vorgänger – die Reformbewegung begann unter den deutschen Päpsten Clemens II. (1046 – 1047), Viktor II. (1055 – 1057) und dem Elsässer Leo IX. (1049 – 1054)9 – wollten eine glaubwürdigere Kirche. Dahinter verbarg sich ein Gedanke, der für das weitere religiöse Leben im Mittelalter ausschlaggebend sein sollte:
„Hier auf Erden sollten Lebensentwürfe verwirklicht werden, wie sie in der Schrift vorgegeben sind. Leitbild war die Einheit der Kirche.“10
Papst Gregor verband dieses Ziel an erster Stelle mit einer Reform der kirchlichen Hierarchie:
„Ein aus der Heiligen Schrift abgeleiteter Lebensentwurf, in dem das Priestertum neben und über den Laien stand; ... eine Form der kirchlichen Einheit, verbunden mit der absoluten päpstlichen Führungsrolle. Priestertum und monarchische Stellung des Papstes waren die Leitbilder.“11
Die Reform zielte auf die Unabhängigkeit und Freiheit der Kirche („Libertas ecclesiae“) gegenüber der weltlichen Macht, vor allem gegenüber dem Kaiser. Sie wehrte sich dagegen, dass Bistümer und Abteien durch Laien, d.h. durch Könige, Fürsten und Adlige vergeben wurden (die sog. Laieninvestitur), z.B. durch Zahlungen von hohen Geldsummen (Simonie)12 oder durch Fürsprache einflussreicher Persönlichkeiten, die dem Bewerber, nach erfolgreicher Übernahme eines Bistums, zusätzliche Verpflichtungen aufnötigten.13 Die Investierten standen in dauernder Abhängigkeit ihrer Gönner. Infolge dessen waren sie auch meist nicht am Seelenheil der Menschen interessiert, sondern an der wirtschaftlichen und finanziellen Ausbeutung. Das führte u.a. dazu, dass sie für geistliche Amtshandlungen Geld verlangten. Um dem Priestertum eine neue Würde zu verleihen, forderten die Anhänger der päpstlichen Reformen die Einhaltung des Zölibats.14 Deshalb verkündete Papst Gregor, „dass nur der würdige Priester wirksam die religiösen Funktionen vollziehen könne.“15 Er ließ die „simonistischen, die nicht ausschließlich von der Kirche berufenen Priester ebenso wie die beweibten und unkeuschen Priester als unrechtmäßige wirkungslose Usurpatoren des priesterlichen Amts“16 bezeichnen und als Ketzer verfolgen, sofern sie weiterhin die Messe zelebrierten oder kirchliche Ämter weiter erwarben17:
„Priestern, Diakonen und Subdiakonen, die im Verbrechen der Hurerei (des Ehebruchs mit der Kirche) verharren, verbieten wir im Namen des allmächtigen Gottes und in der Vollmacht des heiligen Petrus den Eintritt in die Kirche, bis sie Buße tun und sich bessern.“18
Den Garanten für glaubwürdige Geistliche und für die Unabhängigkeit der Kirche und Klöster sah Gregor in einem starken Papsttum: Papst Gregor VII. (*1019/30 +1085), der zeitweise Mönch eines cluniazensischen Klosters war, bevor er an die Kurie berufen und 1073 Papst wurde, war davon überzeugt, dass es in der Welt nur um
„das Ringen zwischen dem Gottes- und dem Teufelsreich, um den kämpferischen Einsatz der Gotteskinder [ging], damit der Friede, die Gerechtigkeit und Liebe Gottes möglichst viele Menschen erfülle. Zu diesem Kampf waren alle Christen, vor allem jedoch die geistlichen und weltlichen Amtsträger gerufen.“19
Gottes Reich war für Gregor die ecclesia universalis (die universale Kirche) mit den von Gott eingesetzten Gewalten der weltlichen und der geistlichen Macht (Regnum, Königtum und Sacerdotium, Priestertum). In dieser universalen Kirche sollte Gott ungehindert wirken können. Für die göttlichen Dinge waren aber für Gregor ausschließlich die Priester zuständig. Aus diesem Grund besaß das Sacerdotium den höheren Rang. Die Priester sollten frei sein für das göttliche Handeln in der Welt. Es ging Gregor um die Unabhängigkeit des Klerus und der Klöster von aller weltlichen Einflussnahme. Die dem Sacerdotium gebührende Autorität konnte aber nach Gregor nur einer sichern: der Papst in Rom.20 Daher glaubte Gregor, alle Christen müssten „dem für ihr Seelenheil verantwortlichen Papst gehorchen und unter seiner Führung für das Gottesreich streiten, nicht nur die seiner oberbischöflichen Gewalt untergebenen Priester und Mönche, sondern auch die weltlichen Herrscher.“21
Gregor beabsichtigte nicht, die königliche Herrschaft zu entmachten. Es ging ihm neben der Unabhängigkeit der Priester auch darum, dass die weltlichen Herrscher Christus als ihr Haupt anerkennen. Wenn ein weltlicher Herrscher Christus nicht folge, dann entmachte er sich selbst. Die radikale Konsequenz Gregors:
„Kraft des päpstlichen Rechtes, letztlich zu entscheiden, wer Gottes und wer des Teufels sei, forderte er, einen unwürdigen Herrscher absetzen und die Untertanen vom Treueid lösen zu dürfen.“22
Es waren schließlich die geistlich-spirituellen Impulse der gregorianischen Reform, die einen neuen Aufbruch des religiösen Lebens in der Kirche verursachten: der Gedanke von einem würdigeren und glaubwürdigeren Klerus. Das Wirken eben jener „reformierten“ Kleriker, die wie die Apostel in Armut Christus nachfolgen wollten („vita apostolica“) und deshalb auch als Wanderprediger umherzogen, riefen in den einfachen Gläubigen eine neue Religiosität hervor.23 Sie setzten neue religiöse Bewegungen in Gang. Die vita apostolica und die paupertas vitae, ein Leben auf Wanderschaft wie die Apostel und die radikale Armut Christi, wurden innerhalb dieser Bewegungen zu den wichtigsten geistlichen Werten.24
Die reformatorischen Kräfte, die nach innen die Erneuerung der kirchlichen Hierarchie anstrebten, wirkten auch nach außen auf die Laien:
„Die religiösen Kräfte, die das Reformpapsttum zum Widerstand gegen den simonistischen und beweibten Klerus aufgerufen hatte, waren vielfach zu selbstständiger Aktivität erwacht und begnügten sich nicht mit der erneuerten Geltung der Klosterregel und des Kirchenrechts. Die Evangelien und Apostelschriften selbst wurden ihnen zur Norm des wahrhaft christlichen Lebens, zur Quelle ihrer Frömmigkeit, zum Appell an jeden Christen, sich wie Jesu Jünger und Apostel zu verhalten. Nach deren Weisung begannen Mönche, Eremiten, Kanoniker zu predigen, um die Gläubigen auch außerhalb des Klosters und Klerus aufzurütteln und für ein wahrhaft christliches Leben zu gewinnen.“25
Papst Gregor selbst rief Laienvereinigungen, wie die Pataria in Mailand, auf, gegen den unwürdigen Klerus vorzugehen.26 Er förderte auch den Gedanken, sich wieder mit der Ostkirche zu vereinigen und Jerusalem aus der Hand der Muslime zu befreien. Sein Nachfolger Urban II. (1088-1099) setzte schließlich den ersten Kreuzzug (1096-1099) in Gang. Hinter dem Ruf, das heilige Land zu befreien und die „Ungläubigen“ zu töten – der Papst betonte, so schrecklich sich dies für uns heute anhört, es sei Christenpflicht, fremdes und gottfernes Volk zu töten27 – verbarg sich ein
„mächtiger Ausdruck von Laienfrömmigkeit, der das Ideal der Bußpilgerschaft mit dem Gedanken des Heiligen Krieges verband, was die päpstliche Herrschaft weiter stärken sollte.“28
Trotzdem kann zur Zeit Gregors von einer direkten Förderung der Laienfrömmigkeit nicht die Rede sein. Im Zusammenhang mit einer „vita apostolica“ oder mit einem vertieften geistlichen Leben kam der einfache Gläubige, der Laie, überhaupt nicht vor: Man verstand darunter eine „vita communis“, wie sie in den Klöstern gelebt wurde29, und für Papst Gregor war das Wort „apostolisch“ gleichbedeutend mit „päpstlich“.30 Auch wenn die gregorianische Reform zu den bedeutsamen Umbrüchen beitrug31, so vollzog sich diese Reform „unter dem Banner der Rückkehr zur alten Ordnung, nicht unter dem des Aufbruchs“32.
Doch die von der Reform geweckten Geister meldeten sich zu Wort und ließen sich nicht mehr zum Schweigen bringen. Sie richteten sich schließlich gegen die von Gregor reformierte Hierarchie, die sie kritisch zu hinterfragen begannen, zum Beispiel
„ob die kirchliche Ordinierung des Priesters die einzige und ausreichende Berechtigung zur Vollziehung des christlichen Heilswerkes sei; ob nur die Kirche berufen und dazu eingesetzt sei, allein durch die von ihr bestellten Vertreter den göttlichen Heilsplan, den die Evangelien und die Apostel verkündet hatten, zu verwirklichen; ob nicht jeder einzelne Christ durch die Gebote der Evangelien und das Beispiel der Apostel aufgerufen sei, sein Leben unmittelbar nach den evangelischen und apostolischen Normen auszurichten; und ob andererseits derjenige ein echter Priester sei, der zwar von der Kirche dazu ordiniert ist, aber nicht lebt, wie das Evangelium es verlangt und wie die Apostel lebten. Aus solchen Fragen und Zweifeln erwuchs eine religiöse Gesinnung, die das Wesen des Christentums nicht mehr in der Kirche als Heilsordnung und in der Kirchenlehre als Dogma und Tradition erfüllt und verwirklicht sah, sondern nach einer Verwirklichung des Christentums als einer religiösen Lebensform suchte, die für jeden einzelnen echten Christen unmittelbar verbindlich und für sein Seelenheil wesentlicher sei als seine Stellung im hierarchischen Ordo der Kirche oder sein Glauben an die Lehren der Kirchenväter und Theologen.“33
Die kirchliche Heilsordnung sowie das theologische Lehrgebäude sollten sich von den Anweisungen des Evangeliums und dem Vorbild der Apostel her legitimieren, d.h. irdische Güter zu lassen und wie die Apostel in der Nachfolge Christi das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden. Diese Gedanken waren revolutionär, denn im religiösen und kirchlichen Leben hatten sie im Abendland bisher keine große Rolle gespielt34:
„Diese beiden Gedanken, die Forderung der christlichen, evangelischen Armut und des apostolischen Lebens und Wirkens, sind zu Brennpunkten einer neuen Auffassung vom Wesen des Christentums geworden, von der aus einerseits die bisher bestehende kirchliche Ordnung und Lehre der Kritik unterzogen und andrerseits ein neues Richtmaß für eine wahrhaft christliche Lebensgestaltung gesucht wird.“35
An der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert trat nun das Ideal von der freiwilligen christlichen Armut und von der apostolischen Nachfolge gleichzeitig in sehr unterschiedlichen Kreisen hervor und bestimmte die Entwicklung der religiösen Bewegungen: in den meist antikirchlichen, von der Kirche deshalb als ketzerisch verurteilten Bewegungen, und in kirchlich gesinnten Wanderpredigern36, denen sich zahlreiche Frauen und Männer anschlossen. Aus diesen Gruppen der Wanderprediger gingen sodann neue Orden und Klöster hervor.37
1 Für unsere Ausführungen besonders wichtig: Grundmann 1976, Bd. 1; Ders. 1977; Bünz u.a. 2007; Angenendt 2005, vor allem 44 – 68; Dinzelbacher 1988; 2003a; 2003b; Borst 1988; Ders. 2004. Wir werden in diesem ersten Teil meistens aus Grundmann 1977 zitieren. Die Ausgabe von 1977 ist ein photomechanischer Nachdruck der Erstausgabe von 1935, dem 1961 sowie 1977 Anhänge mit neueren Erkenntnissen zugefügt wurden. Außerdem fällt auf, dass selbst neuere, in dieser Arbeit aufgeführte kirchengeschichtliche Publikationen immer wieder auf Grundmann verweisen. Meines Erachtens gibt es bis heute kein Werk, das sich so ausführlich und in einem Zusammenhang mit den religiösen Bewegungen des Mittelalters auseinandersetzt und dabei auf eine so große Menge von zeitgenössischen Quellen zurückgreift. In einzelnen Themen, wie z.B. bei der Darstellung der Beginen und der Freien Geister, müssen jedoch neue Forschungserkenntisse berücksichtigt werden. Eine neuere Publikation über die religiösen Bewegungen, Bünz 2007, behandelt, da sie als Festschrift konzipiert ist, einzelne Themen.
2 Dazu: Wollasch 2007; Angenendt 2005, 55f.; Kempf 1999, 365-375. 401-461; Hauschild I 1995, 298 – 304. 425 – 433; Morrison 1993, 195 – 210.
3 Grundmann 1977, 13.
4 Zu Cluny: Siehe Wollasch 2007.
5 Vgl. Angenendt 2005, 55f.; Kempf 1999, 368-371. Von Gorze ging, seit 933, ausschließlich eine geistliche Erneuerung aus. Gorze blieb, im Gegensatz zu Cluny ein Eigenkloster und stellte das Eigenklosterwesen auch nicht in Frage. Allerdings hatte es Gorze im deutschen Sprachraum mit einem erträglicheren Eigenkirchenwesen zu tun als Cluny in Frankreich; dort waren es zum Teil die Adligen und Fürsten selbst, die ein Reformkloster förderten bzw. gründeten.
6 Zum Folgenden: Vgl. Kempf 1999, 371-375; Leclercq 1993, 149ff.; Wollasch 2007.
7 Vgl. Angenendt 2005, 333f.
8 Wollasch 2007, 37-42; Quellen: Odonis abbatis Cluniacensis vita s. Geraldi, in: Bibliotheca Cluniacensis, hg. Von M. Marrier – A. Duchesne, Paris 1614, Neudruck Mâcon 1915.
9 Vgl. Kempf 1999, 404 – 411.
10 Morrison 1993, 195. Vgl. Borst 2007, 177. 212.
11 Morrison 1993, 195.
12 Vgl. Kempf 1999, 392.
13 Vgl. Angenendt 2005, 45f.
14 Vgl. Angenendt 2005, 46. 457, mit weiteren Verweisen); Kempf 1999, 390f.
15 Grundmann 1977, 13.
16 Grundmann 1977, 13.
17 Vgl. Angenendt 2005, 457ff.; Grundmann 1977, 13.
18 Gregor VII., Epistulae 139; zit. n. Grundmann 1977, 13. Vgl. Angenendt 2005, 458.
19 Kempf 1999, 423.
20 Vgl. Angenendt 2005, 324f.; Kempf 1999, 424.
21 Vgl. Kempf 1999, 424.
22 Kempf 1999, 424. - Aus diesem Denken resultieren zahlreiche Konflikte zwischen Kaiser und Papst, zunächst zwischen Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. selbst, der zum berühmten Gang des Kaisers nach Canossa führte (1077), nachdem der Papst diesen exkommuniziert hatte. Zur Zeit Taulers führte der Konflikt zwischen Papsttum und Kaiser Ludwig der Bayer dazu, dass Tauler Straßburg verlassen und einige Jahre im Baseler Exil verbringen musste, da die Stadtregierung Straßburgs auf der Seite des exkommunizierten Kaisers stand.
23 Vgl. Angenendt 2005, 54
24 Vgl. McGinn 1996, 237
25 Grundmann 1977, 508. Vgl. Angenendt 2005, 54f.
26 Vgl. Borst 2007, 212; Angenendt 2005, 458. 460
27 Vgl. Borst 2007, 25
28 McGinn 1996, 237. Vgl. Erdmann 1965.
29 Vgl. Angenendt 2005, 55.
30 Vgl. Grundmann 1977, 505.
31 McGinn 1996, 233.
32 McGinn 1996, 234.
33 Grundmann 1977, 14.
34 Vgl. Grundmann 1977, 15: „Die monastische Reformbewegung hat zwar bei ihrer Erneuerung des benediktinischen Mönchtums auch den Verzicht auf Privateigentum in aller Strenge gefordert, keineswegs aber sich zu einem ‚Armutsideal‘ und zum Eigentumsverzicht der Klostergemeinschaft bekannt, sondern im Gegenteil nach machtvollem Reichtum der Klöster gestrebt.“
35 Grundmann 1977, 15.
36 Norbert von Xanten (1082 – 1134), begann als Wanderprediger. Zur gleichen Zeit wanderte auch Robert von Arbrissel (+1177) predigend durch Frankreich und sammelte zahlreiche Anhänger um sich, die sich die „Armen Christi“ nannten.
37 Norbert gründete zunächst ein Doppelkloster für Frauen und Männer (Prämonstratenser). Auch Robert gründete ein Kloster für die „Armen Christi“, das sich allerdings nach seinem Tod wieder auflöste.