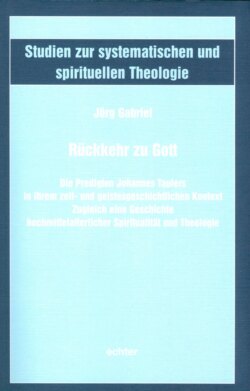Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 12
Drittes Kapitel Absicht dieser Arbeit
ОглавлениеIn all diesen Arbeiten – und das gilt auch für die Gesamtdarstellungen Taulers184 – werden wichtige Einzelfragen, die sich aus Taulers Predigten ergeben, behandelt, zum Beispiel Taulers Stellung zur vita activa und contemplativa, die Lehre der Selbsterkenntnis, die Gebetslehre, der theologische Schwerpunkt in der Trinitäts- und Kreuzestheologie, Tauler aus psychologischer Sicht, Taulers Einfluss in den Niederlanden, seine Beziehung zu Meister Eckhart. Das Kennzeichen dieser Arbeiten ist, dass Themen oder Fragen von außen, d.h. vom jeweiligen Autor, an die Predigten herangetragen werden.185 Der Verfasser greift ein oder mehrere Predigtthemen heraus und untersucht daraufhin den gesamten Predigtkorpus nach Aussagen zur entsprechenden Thematik. Gandlau beispielsweise hat akribisch alle Aussagen Taulers zur Trinitäts- und Kreuzestheologie aus den Predigten herausgearbeitet und diese paraphrasierend zu einem neuen Ganzen zusammengefügt.186 Der Nachteil eines solchen Vorgehens besteht darin, dass Taulers Gedanken aus dem Zusammenhang der jeweiligen Predigten gerissen werden. Dadurch aber kann die ursprüngliche und eigentliche Predigtaussage verloren gehen, weil sie in einen anderen Kontext gesetzt wird. Solche thematisch orientierten Ansätze – so interessant und berechtigt sie auch sind – können deshalb, wie schon Ruh feststellt, am „Denker Tauler“ vorbei gehen.187 Es wird kein einheitliches Bild des Predigers und seines Denkens gezeichnet. Nach Zekorn sticht in der Literatur über Tauler ohnehin vor allem „das Problem der Divergenz der Forschungsansätze und –ergebnisse ins Auge.“188 Bereits 1923 bemängelt Helander in seiner Arbeit,
„dass die vorhergehende Taulerforschung ... auch daran gelitten hat, dass man bei der Schilderung Taulers eine schematische Stellung außerhalb Taulers selbst eingenommen hat, woraus sich wieder ergibt, dass man im Innern Tauler an sich nicht hat verstehen können.“189
Tauler hat dadurch unterschiedliche, sogar einander ausschließende Deutungen erfahren190:
„Pantheist und Christ, Verfechter der theologischen und mystischen Tradition und Vorläufer der Reformation, treuer Sohn der Kirche und Rebell, Thomist und Neuplatoniker ... – dies alles (und noch einiges mehr) soll Tauler alles gewesen sein, wenigstens nach seinen Interpreten.“191
Taulers Werk besteht aus Predigten. Er hat keine philosophischen bzw. theologischen Traktate verfasst. Wie aber geht man mit diesen Predigten angemessen um? Kann man überhaupt eine innere Ordnung oder Systematik erkennen? Die Frage, die wir stellen, ist die nach der rechten Zugehensweise zu Taulers Predigten, nach dem angemessenen Ansatz, der uns den Rahmen für eine Systematik für diese Arbeit bietet.192 In diesem Zusammenhang gibt uns die Arbeit von Dick Helander193 (1923) einen wichtigen Hinweis. Helander macht deutlich: Wer Tauler verstehen will, muss ihn von seinem Selbstverständnis als Prediger her sehen.194 Für Zekorn, der Helander darin folgt, ist dieses Selbstverständnis „vielleicht sogar der einzige und entscheidende“195 Schlüssel zum Verständnis der Taulerschen Predigten. Ein derartiger Schlüssel verhindert nämlich, „Tauler mit einer ihm fremden Fragestellung und Erwartungshaltung zu lesen, wie es für die Forschungsgeschichte im Hinblick auf Tauler geradezu kennzeichnend ist.“196 Zekorn bezeichnet einseitig psychologische oder ethisierende Ansätze als „künstliche Zwangsjacken, die an der Verbindung von Glauben und Leben bei Tauler vorbeigehen.“197 Helander schlägt deshalb vor: „Wir müssen also in diesem Punkte anstatt dessen ein immanentes Verständnis einsetzen.“198 Dieses immanente Verständnis ist Taulers Selbstverständnis als Prediger und geistlicher Lehrer. Aus diesem Grund versucht Helander „nicht so sehr Taulers Beziehungen nach allen möglichen Seiten hin ins Auge zu fassen, als vielmehr Tauler an und für sich.“199 Helander entwirft einen Grundriss der Taulerschen Predigt in ihrer Gesamtheit. Dabei setzt er sich sehr ausführlich mit Taulers geschichtlichhomiletischer Position auseinander und ordnet ihn innerhalb der Klosterpredigten ein.200 Sehr ausführlich behandelt Helander auch die Textgrundlage201, die Form der Taulerpredigten202, seinen Predigtstil203 und Taulers Persönlichkeit als Prediger204. Außerdem fügt Helander seiner Arbeit noch zwei Predigten hinzu, die in Vetters Taulerausgabe nicht vorkommen.205 Man findet bei Helander eine gute Zusammenfassung von Taulers Denken, es bleibt allerdings, wie Helander selbst betont, ein Grundriss.206
Wir wollen in dieser Arbeit Taulers Denken ausführlich im Gesamtzusammenhang seiner Predigten darstellen, ohne – so weit als möglich – die einzelnen Predigten zu zergliedern. Auf Querverweise – sei es auf Aussagen in anderen Predigten oder auf Sekundärliteratur, die zum Verständnis Taulers beiträgt – kann nicht verzichtet werden. Wichtig ist allerdings, dass wir uns, was selbstverständlich sein sollte, streng an die Texte und an deren eigentliche Aussageabsichten halten; Deutungsschwierigkeiten sollen so weit als möglich von Tauler selbst her geklärt werden. Johannes Tauler soll uns als Prediger und Denker lebendig vor Augen gestellt werden, im Sinne Helanders geht es um einen „Tauler an und für sich.“207
Helanders und Zekorns Zugangsweise ist zuzustimmen. Wir dürfen Tauler nicht einseitig als einen Magister der Philosophie oder Theologie, sondern wir müssen ihn als einen Prediger, d.h. als einen Seelsorger und Lehrer geistlichen Lebens verstehen.208 Tauler ist ein Lebemeister, der in der Pastoral beheimatet war. Wenn wir also das Denken Taulers darstellen und verstehen wollen, sollte das, was seine Predigten und sein Anliegen charakterisiert, sichtbar werden. Dabei dürfen wir allerdings auch Weilners Ansatz nicht vergessen, demzufolge Tauler seine eigenen geistlichen Erfahrungen in seine Predigten einfließen lässt.
Auch wenn wir von einem immanenten Verständnis Taulers ausgehen, können wir seine Beziehungen nach außen nicht einfach außer Acht lassen, denn sowohl seine Identität als Prediger und Mystiker als auch der Inhalt seiner Predigten ist durch seine Lebenswelt und auch die historischen Zeitumstände mitbestimmt.209
Ebenso wichtig sind die geistesgeschichtlichen Grundlagen. Wenn etwa Tauler in seinen Predigten immer wieder vom „Grund“ in der Seele spricht, bleibt zu klären, was hat ihn dabei geprägt, welche Philosophie und Theologie hat ihn also in seinen Predigten beeinflusst? Zum Verständnis seiner Predigten sind diese Fragen unumgänglich. So geht aus dem Selbstverständnis Taulers als Prediger, Seelsorger und geistlicher Lehrer, der seine religiösen Erfahrungen weiter gibt, und aus der Fragestellung nach Taulers historischen und geistesgeschichtlichen Grundlagen die Systematik dieser Arbeit hervor.210 Dabei macht sich der Verfasser dieser Arbeit Sudbracks kritische Anmerkung zu Eigen: „Je mehr man Tauler systematisiert, je weiter weg von ihm geht man.“211 Wollen wir jedoch den Gedankenreichtum und die wertvollen Impulse Taulers für ein religiöses Leben in seinem Zusammenhang darstellen und verstehen, kommen wir um eine gewisse Systematik nicht herum.
Wie sieht diese konkret aus? Im ersten Teil der Arbeit werden wir die historischen Grundlagen Taulers darstellen. Diese setzen wir allerdings sehr viel früher an als in den bisherigen Arbeiten.212 Wie müssen nämlich den Prediger Johannes Tauler als Teil starker mittelalterlicher religiöser Bewegungen betrachten, die im 12. Jahrhundert ihren Anfang nahmen und sich auf deutschsprachigem Boden im heutigen Belgien und den Niederlanden, in Deutschland vom Oberrhein bis Köln am stärksten ausbreiteten.213 Zudem war Südfrankreich und der Norden Italiens von diesen religiösen Bewegungen erfasst. Diese Bewegungen, die Kleriker und Laien, vor allem auch Frauen, gleichermaßen erfassten, brachten ebenso viele Irrlehren wie heiligmäßige Frauen und Männer hervor, die neue Impulse in der Kirche setzten. Zu diesen Heiligen gehört auch der heilige Dominikus (1170 – 1221), der Ordensvater Taulers. Er gründete im 13. Jahrhundert den Predigerorden (Dominikaner), aus dem große Theologen214 und Prediger hervorgingen, aber auch gefürchtete Inquisitoren.215 Vor allem aber waren es die zahlreichen frommen Frauen216, Dominikanerinnen und Beginen, die sowohl Tauler als auch seine Mitbrüder Meister Eckhart und Heinrich Seuse in ihrem Predigen beeinflussten: „Die drei standen in einem engen und gegenseitigen Austausch mit der Frauenfrömmigkeit und sind erst vor diesem Hintergrund in ihrer Eigenart verständlich.“217
Im zweiten Teil betrachten wir die geistesgeschichtlichen Grundlagen des Dominikaners. Es gilt als anerkannte Tatsache, dass Tauler vom Denken Meister Eckharts geprägt worden ist.218 Auch Meister Eckhart dürfen wir jedoch nicht als isolierten Denker ansehen. Wir fragen auch bei ihm: Was hat sein Denken geprägt? Meister Eckhart gehört in seinen Ansätzen zu einer von Albertus Magnus ausgehenden Philosophie und Theologie, die im deutschen Sprachgebiet eine eigenständige Form fand, so dass von einer „deutschen Albert-Schule“ gesprochen werden kann.219 Auch bei Tauler finden wir Spuren dieses deutschen Albertinismus.220 Darüber hinaus dürfen wir auch nicht die gemeinsame Ordenstradition vernachlässigen. Denn wenn wir eine geistige und literarische Nähe zwischen Johannes Tauler und Meister Eckhart (1260 – 1328) feststellen221, obwohl beide vierzig Jahre auseinander liegen, dann ist das auch in der gemeinsamen Tradition des Ordens begründet222: „Bei beiden finden wir sehr lebendige Erinnerungen an Aussagen und Haltungen des heiligen Dominikus.“223 Deshalb werden wir die Spiritualität des heiligen Dominikus, die „deutsche Albertschule“ und schließlich Meister Eckhart genauer betrachten. In einem weiteren Kapitel gehen wir auch auf Taulers Zeitgenossen Heinrich Seuse ein. Im dritten Teil wollen wir schließlich – wie oben beschrieben – Taulers Denken ausführlich und textnah darstellen. Im abschließenden vierten Teil wollen wir Taulers Spiritualität in den Kontext mit modernen Spiritualitäten setzen.
184 Vgl. Eck 2006; Gnädinger 1993; Filthaut 1961; Helander 1923. Diesen (und anderen) Arbeiten soll jedoch keineswegs die Qualität abgesprochen werden. Vgl. Zekorn 1993, 11 zur Gedenkschrift von 1961: „Die Zersplitterung ihrer Beiträge vermag die vorangegangene Forschung allerdings nicht zu bündeln. Daher bot die Gedenkschrift keine hilfreiche Ausgangsbasis für die weitere Forschung, so dass die Unterschiedlichkeit der Ansätze bis heute symptomatisch bleibt.“
185 Weilner 1961, 43 weist auf die Schwierigkeiten derer hin, die versuchen, die Aussagen eines Mystikers zu interpretieren, ohne selbst über dessen Tugend bzw. innere Erfahrung zu verfügen: „Jegliche Art des Missverständnisses, ja des Missbrauchs lauert hier in unmittelbarer Nähe. Dazu kommt noch, was übersehen wird, die grundverschiedene innere Einstellung des Mystikers und seines Interpreten.“ D.h. wer den Text eines Mystikers deuten will, muss von einer „Unzahl stillschweigender, ja oft dem einzelnen Interpreten selbst nicht einmal bewusster Voraussetzungen, unter deren Einfluss sich seine Bemühung vollzieht“ (44), ausgehen.
186 Vgl. Gandlau 1993. Er hat dies allerdings auf die Spitze getrieben. Er hat die gesamte Arbeit so konzipiert.
187 Vgl. Ruh 1996, 486. Konkret bezieht sich Ruh, neben Gandlaus Arbeit, auf Gnädingers Monographie über Tauler (1993) und auf die Arbeit von Stefan Zekorn (1993). Er bemängelt an Gnädingers Monographie, dass in keinem der zwanzig Themen, die den Lehren Taulers gelten, von seinen spekulativen Ansätzen die Rede sei.
188 Zekorn 1993, 7.
189 Helander 1923, 40.
190 Vgl. Weilner 1961, 44.
191 Weilner 1961, 47; vgl. Zekorn 1993, 7.
192 Vgl. Zekorn 1993, 16.
193 Helander, Dick: Johann Tauler als Prediger, Uppsala/Schweden 1923.
194 Vgl.Helander 1923, V.
195 Zekorn 1993, 16.
196 Zekorn 1993, 16. Hoenen 1994, 425 spricht z.B. vom „Taulerschen Albertinismus“. RUH 1996, 486 wendet sich dagegen, Tauler zum „Albertinisten“ zu ernennen, unter Ausschaltung des Lebemeisters und Mystikers: „Das geschieht mit einer Zuspitzung (die allen bisherigen Beiträgen zum Thema fremd ist) ... . Das ist entschieden abzulehnen.“
197 Zekorn 1993, 17.
198 Helander 1923, 40.
199 Helander 1923, 41.
200 Vgl. Helander 1923, 55; ebenso Ruh 1996, 487.
201 Helander 1923, 79 – 133.
202 Helander 1923, 290 – 309.
203 Helander 1923, 328 – 336.
204 Helander 1923, 337 – 345.
205 Helander 1923, 346 – 361. Helander 1: „Von dem heiligen crúze“ (H 60), Helander 2: „Ueber Matth. V.1 uf. Unser herre gieng uf das gebirge etc.“ (H 71).
206 Vgl. Helander 1923, VI.
207 Helander 1923 41.
208 Vgl. Zekorn 1993, 16f.
209 Vgl. Mösch 2006, 6: „Taulers Predigten haben ... einen sozialgeschichtlichen Kontext“.
210 Vgl. Grundmann 1976, Die Geschichtlichen Grundlagen der Deutschen Mystik, in ausgewählte Aufsätze, Teil 1. Religiöse Bewegungen (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Stuttgart 1976, 243-268. Grundmann begründet, warum ein Wissen über die historischen Umstände der Deutschen Mystik so wichtig ist: „Die Deutsche Mystik hat deshalb überall diese beiden Seiten, die man beide sehen muss, wenn man ihre Eigenart verstehen will. Sie steht einerseits in der theologischen Tradition, in der die Dominikaner-Mystiker alle gleichmäßig geschult sind und zu deren Vermittlung sie bestellt sind. Das allermeiste vom philosophischen und theologischen Gedankengehalt ihrer Predigten und Schriften lässt sich daher tatsächlich auf scholastische Quellen zurückverfolgen ... . Eine solche Quellenanalyse der mystischen Theologie ist zweifellos ... unentbehrlich, aber sie ist nicht alles. Warum aus allen diesen Überlieferungen die Deutsche Mystik werden konnte, warum sie noch einmal zur religiösen Wirklichkeit wurden und nicht nur das theologische Denken, sondern das religiöse Leben bestimmen und gestalten konnte, das wird erst begreiflich, wenn man die andere Seite der Aufgabe erkennt, die die mystischen Prediger zu bewältigen hatten: dem religiösen Erleben, Fühlen und Denken und der mystischen Frömmigkeit der ihrer Leitung anvertrauten Kreise eine geistige Form zu geben“ (267f.).
211 Josef Sudbrack in einem Brief vom 2.2.1982 an Bernd Ulrich Rehe 1989, 204.
212 Vgl. u.a. Gnädinger 1993, 9 – 103.
213 Eine lesenswerte einführende Darstellung der historischen und geistesgeschichtlichen Hauptströme der sog. „deutschen Mystik“ im 14. Jahrhundert bietet Cognet 1968; Ders. 1980.
214 Z.B. der Universalgelehrte Albertus Magnus (1193/1200 – 1280) und sein Schüler Thomas von Aquin (1225 – 1274).
215 Wie z.B. den deutschen Dominikaner Heinrich Institoris (1430 – 1505), der Verfasser des „Hexenhammers“ (Malleus Maleficarum) (vgl. Tenberg 1990, Sp. 1307 – 1310, in BBKL II) oder der südfranzösische Dominikaner Bernhard Gui (1261/62 – 1331), der seine Erfahrungen als Inquisitor in seinem Buch „Practica officii inquisitionis“ festgehalten hat (vgl. Borst 2004, 613 – 618).
216 Zur Thematik Christliche Frauenmystik im Mittelalter: Siehe u.a. Stölting 2005; McGinn 1999; Ruh 1993; Dinzelbacher 1988; Ders. 1985.
217 Bangert 2003, 120.
218 Vgl. Büchner 2007; Mösch 2006; Haas 1971; Mieht 1969.
219 Siehe hierzu u.a. Sturlese 2007.
220 Vgl. Hoenen 1994, 391 – 396.
221 Vgl. Cognet 1980, 92: „Unter den großen Fortsetzern Meister Eckharts nimmt Johannes Tauler einen vordersten Platz ein.“
222 Vgl. Eck 2006, 17: „Natürlich konnte Tauler Eckharts Vorlesungen und Predigten hören, und sicher besaß er davon Abschriften. Doch ich meine, sie sind vor allem beide in der dominikanischen Tradition groß geworden, die noch relativ jung war, und es erstaunt mich, wie wenig in den Studien zur Deutschen Mystik darauf hingewiesen wird“.
223 Eck 2006, 17.