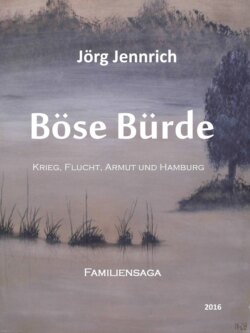Читать книгу Böse Bürde - Jörg Jennrich - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Olgas Tod
ОглавлениеAls am 3. Maisonntag 1943, der von den Nationalsozialisten bereits im Jahre 1934 als offizieller Feiertag eingeführte, Muttertag gefeiert wurde, stand ein unehrenhafter Termin an. Meine Mutter sollte das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter in Silber ausgehändigt werden. Nachdem sie im Januar 1943 ihr sechstes Kind gebar, wurde sie von Amts wegen auf Verleihung des Ehrenkreuzes vorgeschlagen. Der Ortsgruppenführer der NSDAP meldete sich bei uns mit großer Würdigung an. Zackig mit seiner braunen Uniform und einer Hakenkreuzarmbinde machte er dann bei meinen Eltern seine Aufwartung. Feierlich wurde dann meiner Mutter das Mutterkreuz in einer blauen Schachtel überreicht. Es gab Kaffee und Kuchen und natürlich reichlich Alkohol. Immer wieder war es meinem Vater eine Freude Nazis unter den Tisch zu saufen. Als der Ortsgruppenführer schwankend und lallend sich verabschiedet hatte, wanderte die Schachtel mit dem Ehrenkreuz sofort in die hinterste Ecke einer Schublade ihres Nachtschrankes. Sie wollte diese Naziauszeichnung nicht, musste sie aber, um nicht anzuecken, freundlich dankend annehmen.
Wochen später sollte diese Auszeichnung dazu dienen, eine junge russische Zwangsarbeiterin aus den Fängen dieser menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu befreien. Der „nette“ Ortsgruppenführer bot meinen Eltern Olga als Haushaltshilfe an. Olga, damals siebzehn Jahre alt, war eine von vielen tausenden jungen Frauen, die von den Nazis aus Russland nach Deutschland verschleppt wurden. Bis zum Überfall der Russen auf unsere Familie lebte Olga, wie eine Tochter in der Obhut meiner Eltern. Drei Tage nach den Misshandlungen an meiner Mutter und Schwester durch die sowjetischen Barbaren wurde Olga erschossen am Rande unseres Grundstückes im Graben gefunden. Sie wurde als Verräterin von ihren eigenen Soldaten unvorstellbar grausam misshandelt und ermordet.
In den Jahren 1942 bis 1945 befand sich in der Fürstenwalder Allee 401 das Arbeiterdurchgangslager Berlin Ost. Eines von berlinweit 3.000 Zwangsarbeiterlagern. Im Rahmen der NS-Zwangsarbeitereinsatzes kamen in der nahegelegenen Rampe Wilhelmshagen ab April 1942 fast täglich Güterzüge überwiegend mit deportierten Frauen und Kindern an. Sie stammten vor allem aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion und Polen. Hier wurden sie polizeilich erfasst und einige Tage unter primitivsten Bedingungen in zwanzig ständig überfüllten Holzbaracken untergebracht. Nach der Musterung und Vermittlung erfolgte der Weitertransport in entsprechende Zwangsarbeitslager und von dort aus wurden sie in der Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft, in mittelständischen Betrieben, bei Kommunen, Kirchen oder in Privathaushalten eingesetzt. Besonders in den Industriebetrieben herrschten für diese Zwangsarbeiter unmenschliche Bedingungen. Niemand konnte in der NS-Zeit in Deutschland leben, ohne ihnen auf Schritt und Tritt zu begegnen. Zwangsarbeiter waren allgegenwärtig. Rund 26 Millionen Menschen arbeiteten unfreiwillig in den besetzten Ländern wie auch im Reichsgebiet. Allein für die Zivilarbeiter gab es rund 30.000 Lager. Fast jeder Deutsche profitierte von ihrer Ausbeutung und ohne sie hätte der Krieg sicherlich früher geendet, weil die deutsche Wirtschaft zusammengebrochen wäre. Durch die unwürdigen Lebensbedingungen starben besonders viele Sowjetbürger, die von den Nationalsozialisten als Untermenschen behandelt wurden. Sowjetische Zwangsarbeiter hatten dann nach Kriegsende bei der Rückkehr in ihre Heimat unter weiteren Repressalien zu leiden. Sie waren dem pauschalen Vorwurf der Kollaboration mit dem Feind ausgesetzt. 157.000 Rückkehrer sollen wegen Verdacht auf gemeinsame Sache mit den Deutschen hingerichtet worden sein. Andere wurden mit Misstrauen konfrontiert und mussten längere Zeit Strafdienste in Arbeitsbataillonen der Armee leisten.