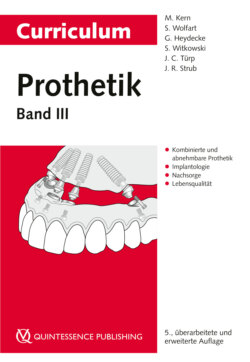Читать книгу Curriculum Prothetik - Jörg R. Strub - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
34.10 Labor: Vermessung, Design und Gerüstherstellung
ОглавлениеNun folgt die endgültige Vermessung des Arbeitsmodells. Beim Vermessen geht es darum, im Verband der zu umklammernden Zähne die vorteilhaftesten retentiven Zonen festzustellen. Dazu werden durch Kippung des in den Parallelometer eingespannten Modells zunächst mit einem im Parallelometer eingespannten Suchstab Ausmaß und Lage der untersichgehenden und damit retentiven Bereiche (sog. Infrawölbungen) der Klammerzähne festgestellt (Abb. 34-3). Hat man im Parallelometer eine für diesen Zweck optimale Modellpositionierung gefunden, wird für jeden Zahn der prothetische Äquator (Klammerführungslinie) mit einer Farbmine markiert (Abb. 34-4). Dieser gibt die nur für diese spezielle Modell-Positionierung gültige Trennungslinie zwischen der zervikal des prothetischen Äquators liegenden Infrawölbung (negative Region) und der okklusal befindlichen nicht untersichgehenden und daher nicht retentiven negativen Suprawölbung an. Auf diese Weise wird für die später an der Prothese direkt befestigten Klammern eine gemeinsame Einschubrichtung festgelegt.
Anschließend erfolgt die Bestimmung des Federwegs (Unterschnittstiefe, Eindringtiefe), den die Spitze des elastischen Endteils des Retentionsarms der Klammer beim Ein- und Ausgliedern der Modellgussprothese zurücklegt (maximale Auslenkung). Bei dem am weitesten verbreiteten Messsystem nach Ney (Lukadent, D-Schieberdingen) stehen dafür Messstäbe mit Messtellern verschiedenen Durchmessers zur Verfügung. Je nach Entfernung des Messstab-Schafts zum Rand des Messtellers (0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm) unterscheidet man im Grundset drei verschiedene Messstäbe (Nr. 10, 20, 30) (Abb. 34-5).
Abb. 34-3 Aufsuchen von Infrawölbungen (unterhalb der gestrichelten Linie).
Abb. 34-4 Einzeichnen des prothetischen Äquators mit einer im Parallelometerstab befindlichen Farbmine.
In speziellen Tabellen lassen sich die für die verschiedenen Zähne und Klammerformen gewünschten Unterschnittstiefen ablesen. Der Messstab wird derart an den Zahn angelegt, dass der prothetische Äquator vom Schaft berührt wird und der Messteller in einem bestimmten Abstand vom Äquator (der sog. Eindringdistanz) im ausgewählten Bereich des Klammerendpunkts am Zahn Kontakt hat (Abb. 34-6). Auf diese Weise wird ein definierter Federweg erzielt. Der Verlauf der Retentionsarme wird vom festgelegten Klammerendpunkt zur Klammerauflage eingezeichnet. Bei einer nur geringen Konvexität des Zahnes und einer dementsprechend geringen Unterschnittstiefe müssen retentive Bezirke in Form von non-invasiven Zahnumformungen (Kompositantragungen mit Schmelzätztechnik befestigt) geschaffen werden. Nur bei starker Zerstörung eines Pfeilerzahnes ist dessen Überkronung zur Schaffung von retentiven Bereichen angezeigt.
Die Retentionskraft einer Gussklammer hängt aber nicht nur vom Ausmaß des Federwegs (je größer, desto mehr Retention), sondern auch von der Klammerarmlänge ab (sehr kurze und sehr lange [zunehmende Elastizität] weisen eine geringere Retention auf – größeren Messteller wählen), ferner vom Klammerarmquerschnitt (je dicker, desto mehr Retention) und von dem materialspezifischen Widerstand gegen elastische Deformation (E-Modul, Einheit N/mm2; je größer der E-Modul, desto höher der Widerstand und damit der Retentionswert). Aufgrund des vorgegebenen Klammerarmquerschnitts (fabrikmäßig vorgegebene Wachsprofile) und des bekannten E-Moduls der verwendeten Metall-Legierung (i. d. R. edelmetallfreie Legierung, CoCrMo) werden individuelle Variationen der Haltekraft über die Unterschnitttiefe und Klammerarmlänge vorgenommen. Im Ney-System ist jedoch die Länge des Retentionsarmes ein Faktor, der bei der Bestimmung der Haltekraft der Klammer nicht berücksichtigt wird. Dieser Mangel wurde beim Rapid-Flex-Klammersystem (Bios-System) (DeguDent, D-Hanau) dadurch behoben, dass für die Herstellung der Klammern ein vorgefertigtes Wachsprofil verwendet wird, welches auf seiner gesamten Länge ein konstantes Verhältnis von Höhe zu Breite (8:10) aufweist (Kump 1986, Hohmann und Hielscher 2012) (Abb. 34-7).
Abb. 34-5 Messstäbe im Messsystem nach Ney.
Abb. 34-6 Bestimmung der Eindringdistanz. a Theorie: 1 Eindringdistanz, 2 Eindringtiefe; b Praxis. Der Retentionsarm einer E-Klammer verläuft vom I. direkt in den IV. Quadranten.
Abb. 34-7 Wachsprofil des Bios-Systems.
Nach dem Vermessen des Meistermodells wird die vom Zahnarzt angefertigte Arbeitsskizze auf das Modell übertragen. Anschließend werden an den Zähnen alle untersichgehenden Stellen, an denen der Modellguss nicht retentiv wirken soll (z. B. in den Bereichen des kleinen Verbinders), mit Wachs ausgeblockt. Auf die zahnlosen Kieferkämme (Unterlegwachs 0,4 bis 0,6 mm) und entlang des geplanten Verlaufs des späteren Lingualbügels (Unterlegwachs 0,2 bis 0,7 mm) wird eine dünne Wachsschicht aufgetragen. Unter großen Verbindern im Oberkiefer (Palatinalbänder, Gaumenplatten) wird an den Rändern eine feine halbrunde Radierung (ca. 0,5 mm tief) auf dem Meistermodell vorgenommen. Diese Radierung wird später in Metall wiedergegeben und dient zur Verstärkung der Ränder und zum dichten Abschluss am Gaumen. Im Bereich der Sättel von Freiendprothesen werden kleine Sattelstopps im Unterlegwachs ausgespart. An diesen definierten Stellen liegt das Gerüst später dem Kieferkamm direkt auf, während der Hauptanteil des Gerüsts unterfütterbar und somit basal von Kunststoff bedeckt ist. Das veränderte Meistermodell wird mit Silikonen dubliert, um ein Duplikatmodell aus einer feuerfesten Einbettmasse herzustellen. Da CoCrMo-Legierungen erst bei ca. 1300 bis 1600 °C schmelzen, sich Gips aber bereits bei rund 1200 °C zersetzt, ist eine gipsfreie, cristobalitgebundene Einbettmasse zu verwenden. Auf diesem feuerfesten Arbeitsmodell wird mit Hilfe von fabrikmäßig vorgefertigten Wachsprofilen das Gerüst modelliert (Marinello und Flury 1984a, Spiekermann und Gründler 1983)
Um die Klammerposition des Wachsprofils am Zahn an die gleiche Position zu platzieren wie am vermessenen Meistermodell, ist die Einschubrichtung des Gipsmodells auf das Einbettmassenmodell zu übertragen. Dies geschieht mittels speziell dafür hergestellter Anschläge, die mit Hilfe des Parallelometers an das Meistermodell mit Wachs fixiert und später durch die Dubliermasse in das Einbettmassenmodell übertragen werden. Dieser geschaffene Anschlag im Einbettmassenmodell ermöglicht das Wiederausrichten des Einbettmassenmodells auf dem Modelltisch zum Zwecke der endgültigen Vermessung und Markierung der Klammerpositionen für die Wachsprofile am Duplikatmodell. Eine weitere Möglichkeit, die vermessene Klammerposition am Meistermodell auf das Einbettmassemodell zu übertragen, kann durch eine vor dem Dublieren angebrachte Markierung, z. B. mit Wachs in Form einer Stufe am Meistermodell, durchgeführt werden.
Die Stärke des großen Verbinders soll im Randbereich 0,3 bis 0,4 mm, an der Basismitte 0,7 bis 0,8 mm betragen. Ein anderer Gesichtspunkt für die Gerüstmodellation ist die Berücksichtigung des Gegenkiefers zum Einbettmassenmodell. Es gibt klinische Situationen, bei denen es wünschenswert ist, das Einbettmassenmodell im Artikulator einzustellen. Dies wird z. B. bei Metallkauflächen und Rückenschutzplatten nötig. Mit einem entsprechenden Mehraufwand erlauben einige Dubliersysteme (Neostar, Dentaurum, D-Bispringen), das Duplikatmodell einzuartikulieren und zum Einbetten mit der Wachsmodellation aus dem Artikulator zu entnehmen. Die fertige Wachsmodellation sollte vom Zahnarzt auf Übereinstimmung mit der Gerüstzeichnung und auf die Dimensionierung der Wachsteile kontrolliert werden.
Mit Hilfe des Meister- und des Einbettmassenmodells werden visuell folgende Punkte kontrolliert:
Einschubrichtung
Lage aller Teile
Bei der Modellation des Wachses wird überprüft:
Klammerstärke
Stärke des kleinen Verbinders
Oberfläche des großen Verbinders (im Oberkiefer genarbt)
Stärke der Retentionen für die Prothesenzähne (Netzretentionen mit ausreichend stabiler Verbindung zum großen Verbinder)
Unterfütterbarkeit der Sättel (0,4 bis 0,6 mm durch Unterlegewachs auf dem Meistermodell)
Übergang Metallgerüst-Kunststoffsättel (muss überall klar definiert sein; Kontrolle auch am Unterlegewachs auf dem Meistermodell)
okklusale Auflagen
Okklusion bei Kauflächengestaltung in Modellguss
Stopps für das Gerüst bei der Freiendsituation im Unterkiefer
Okklusion unter Berücksichtigung der Auflagen
Frontzahnführung ohne Gerüstkontakte
Die letzten beiden Punkte können meistens nicht genau überprüft werden, da das Einbettmassenmodell in der Regel nicht montiert ist.
Nach Abschluss der Kontrollen wird die Wachsmodellation mit den Gusskanälen versehen und in ein ringloses Muffelsystem eingebettet. Dieses Vorgehen einer Wachsmodellation auf dem Einbettmassemodell wird auch als „Kerneinbettung“ bezeichnet. Wie beim Goldguss erfolgen nun das Ausbrennen, das Vorwärmen der Muffel und schließlich der Metallguss. Nachdem das in der Muffel befindliche Gerüst auf Zimmertemperatur abgekühlt ist und ausgebettet wurde, wird das Gerüst mit einem Sandstrahlgerät von noch vorhandener Einbettmasse und seiner Oxidschicht befreit. Die Gusskanäle werden abgetrennt und ihre Ansätze am Gerüst verschliffen. Hierauf erfolgt erstmals die Feinaufpassung auf das Meistermodell. Die Politur des Gerüsts schließt sich mit den folgenden Schritten an: elektrogalvanisches Glanzbad, schrittweises Polieren mit Gummirädern, Bürstchen und Schwabbel (Marinello und Flury 1984a).