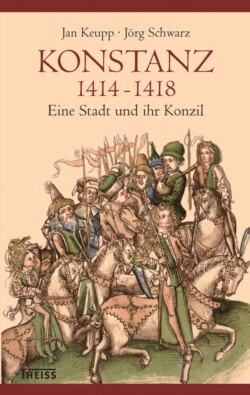Читать книгу Konstanz 1414-1418 - Jörg Schwarz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ringen um den rechten Ort
ОглавлениеRichental hat den Entscheidungsprozess sicherlich zu einträchtig dargestellt; hinter der Entscheidung für Konstanz stand vielmehr ein hartes Ringen. Die Waagschale zugunsten der Stadt am Bodensee neigte sich im Rahmen von Verhandlungen der königlichen Seite mit zwei Kardinälen im Oktober 1413. Zwei Monate später, im Dezember, trafen sich Sigismund und Johannes in Lodi. Neben anderen Fragen ging es hier noch einmal um den Ort des Konzils. Es regierte zunächst das Ausschlussprinzip. Eine Liste (chartula) wurde angefertigt, auf der der Papst alle Orte verzeichnet haben soll, die für die Kardinäle nicht infrage kamen. Möglicherweise hat Johannes hier noch einmal versucht, einen Konzilsort südlich der Alpen durchzusetzen. Auch vonseiten der deutschen Fürsten kam noch einmal ein anderer Vorschlag. Es war Herzog Ulrich von Teck, der – sicherlich wenig aussichtsreich – die Reichsstadt Kempten im Allgäu vorschlug, die in der Nähe seiner Ländereien lag. Doch es blieb bei Konstanz, einer Stadt, der man es eher zutraute, eine so große Versammlung aufzunehmen.
Sigismund hatte fürs Erste gewonnen; am 9. Dezember 1413 lud Johannes XXIII. für den 1. November 1414, den Allerheiligentag, seine „ehrwürdigen Brüder“ und „geliebten Söhne“ zu einem allgemeinen Konzil in die Stadt am Bodensee ein. Die „ehrwürdigen Brüder“, das waren die Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe; die „geliebten Söhne“, das waren die Elekten – also die schon gewählten, aber noch nicht geweihten Bischöfe –, die Äbte der Klöster sowie alle anderen Vorsteher geistlicher Einrichtungen.
Bewusst richtete sich die Einladung aber auch an alle weltlichen Würdenträger, denen er sich in christlicher Liebe verbunden fühle. Viel gebe es hier, in Konstanz, zu erledigen. Frieden und Ruhe seien in der Christenheit einzupflanzen, die Kirche als Ganzes sei zu reformieren. Entschieden stellte sich Johannes in seinem Schreiben in die Tradition seines Vorgängers, Papst Alexanders V., den Vorsitzenden über das „heilige Generalkonzil zu Pisa“.
Konstanz als Ort eines ökumenischen Konzils, Konstanz in der Nachfolge von Rom, Lyon, Vienne, den letzten allgemeinen Konzilien des Mittelalters, langfristig gesehen sogar in der Reihe von Nicäa (325), Konstantinopel (381), Ephesos (431) und Chalkedon (451) – ein Moment lang ist hier innezuhalten. Das Faktum ist zu wichtig, als dass man es einfach überspringen dürfte. Kirchengeschichtlich gesehen war die Entscheidung für einen Konzilsort in Deutschland etwas Neues, vielleicht sogar eine Revolution. Die Entscheidung scheint auf Zukünftiges vorauszudeuten – auf das Basler Konzil etwa, das nur wenige Jahrzehnte nach Konstanz fast zwanzig Jahre in der Stadt am Rheinknie tagen sollte, vielleicht sogar auf die Reformation, die von Deutschland aus ein ganz neues Zeitalter in der Geschichte der Kirche einläuten sollte. Mit Konstanz fing das alles an, und völlig zu Recht haben spätere Historiker geschrieben, dass mit der Entscheidung für den Konzilsort Konstanz die Kirche gleichsam nach Deutschland verlagert wurde. Nicht mehr in den Palästen und Kirchen des italienischen oder französischen Kirchenstaats wurden nun die Geschicke der Christenheit entschieden, sondern in den Gemäuern mittelgroßer oberdeutscher Reichsstädte. Darüber veränderte sich vieles. Beziehungen wurden neu ausgerichtet, Netze neu verknotet. Gewiss, auch vorher schon war der Austausch längst im Fluss, hatten nordalpine Geistliche Informationen und Wissen aus den päpstlichen Residenzen in Rom und Avignon in ihre Heimat beschafft, wurde in Köln oder Nürnberg, London oder Prag über das beraten, was an der Kurie in Rom und Avignon vor sich ging. Nun aber verlagerte sich das Geschehen ebenso wie die Informationsströme, der Fluss ging nicht mehr von Süd nach Nord, sondern von Nord nach Süd. Die Konsequenzen sollten erheblich sein.
Wenig später besuchten päpstliche Agenten die Stadt; nichts, was ihren kritischen Blicken, ihren bohrenden Fragen entging. Zwar hatte Sigismund noch in Lodi dem Papst die „Konzilstauglichkeit“ des Ortes versichert und nachdrücklich die „Fähigkeit“ (abilitas), das „Vermögen“ (capacitas) und die „Sicherheit“ (securitas) der Stadt beschworen. Doch das alles sollte, ja musste überprüft werden. Gab es genügend Unterkünfte für die erwarteten Teilnehmer? Konnte die Versorgung gewährleistet, konnten genug Lebensmittel in die Stadt geschafft werden? Wo sollten überhaupt all die Gespräche, Beratungen und Entscheidungen des Kongresses stattfinden? Man kann sich die sauren Mienen der Italiener vorstellen, als sie durch die Stadt am See mit ihren krummen Gassen zogen. Die hellen, weiten Plätze ihrer südländischen Urbanität suchten sie hier vergebens. Und war nicht auch das Klima hier einfach nur fürchterlich? Selbst die Einheimischen redeten doch davon, dass hier mindestens ein halbes Jahr lang ein nasser, nieseliger November herrsche. Wie sollte man zumal als Südländer einen längeren Aufenthalt in dieser Gegend überhaupt aushalten?