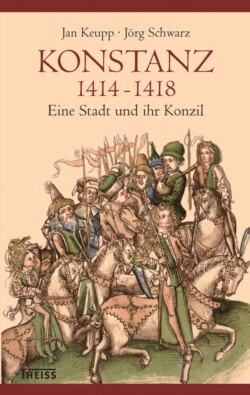Читать книгу Konstanz 1414-1418 - Jörg Schwarz - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weihnachten 1414
ОглавлениеZur Weihnachtszeit kam auch der römisch-deutsche König Sigismund, der Schutzherr, ja der eigentliche Initiator der Synode. Am 8. November war er in Aachen vom Kölner Erzbischof gekrönt worden – drei Jahre nach seiner Wahl. Er folgte damit einer Tradition, die einst Otto der Große (936–973) begründet hatte und der seither alle, die in dieses Amt gewählt wurden, Folge geleistet haben; so wirksam war die Vorgabe. Von Aachen aus zog Sigismund weiter nach Konstanz.
Auf dem Weg dorthin machte er Station in Straßburg, einer der großen Metropolen im Westen des Reiches, die wirtschaftliche Vormacht der Region, seit dem 14. Jahrhundert zünftisch beherrscht. Immer noch baute man an dem gewaltigen Münster aus dem rosafarbenen Vogesensandstein, jetzt nicht mehr im romanischen Stil wie noch im hohen Mittelalter, sondern im gotischen. Vor den Straßburger Bürgern hielt Sigismund eine vertrauliche Rede über die allgemeine politische Lage des Reiches. Auch die Kirche kam in der Ansprache vor, ihr Zustand bedrücke ihn. Der Protokollant notierte: „Dan von der bebste wegen meine er, daz sulle ein kurzes ende nehmen, und er habe auch große zulegunge (Hilfe) von des babstes wegin.“ Entschieden betonte Sigismund seine derzeitige Zusammenarbeit mit Johannes XXIII., beide zögen sie an einem Strick. Er machte aber auch klar, dass es ihm, dem König, vor allem darum gehe, das Problem der Spaltung endlich zu lösen, notfalls radikal – also auch ohne oder notfalls gegen Johannes. Sigismund forderte das „kurze Ende“. Ein Herrscher schickte sich an, den gordischen Knoten der Kirche zu durchhauen.
Mit großem Gefolge waren der König und seine Gemahlin Barbara von Stuttgart aus in den Konzilsort aufgebrochen. Mit den beiden zogen der Kurfürst Rudolf von Sachsen († 1419), die Gräfin Elisabeth von Thüringen sowie die Schwester der Königin, Königin Anna von Bosnien. Mit Pferden und Wagen ging es von Stuttgart über die Alb nach Überlingen. Es war der 24. Dezember 1414, der Heilige Abend. Der See war erreicht: eine große, dunkle Fläche, an deren anderem Ende schemenhaft der Bodanrück zu erkennen war, ein bewaldeter Höhenzug zwischen dem Überlinger und dem Unteren See. Vielleicht noch irgendwo die Lichter eines Dorfes. Sonst Totenstille; der See sorgt nachts für Ruhe. Nur das Plätschern der Wellen und das Aufschreien einiger Wasservögel am Hafen.
Längst war die Nachricht vom Nahen des Königs auch nach Konstanz gedrungen und löste dort hektische Betriebsamkeit aus. Die Ratsstube, das Aushängeschild der Stadt, wurde angeheizt. Aufgeregt benachrichtigten die Ratsherren die Schiffsleute: Alle Schiffe, die vor Anker lägen, seien klarzumachen! Es sei hinüberzusetzen nach Überlingen, um den König, der dort warte, abzuholen. Der aber begab sich dort zunächst einmal für eine kurze Zeit zur Ruhe, die bisherige Reise war anstrengend genug. Zuvor jedoch ließ er noch eine wichtige Botschaft an den Papst in Konstanz versenden. Wieder berichtet Richental davon: Er möge, so der König an den Papst, mit den ersten beiden der drei Weihnachtsmetten auf ihn und auf die Königin warten!
Zu nächtlicher Stunde die Überfahrt. Die Konstanzer hatten tatsächlich alle ihre Schiffe geschickt. Der Konvoi wurde beladen, Fackeln beleuchteten die Szenerie. Die Segel gesetzt, es ging los. Um zwei Uhr – „ zwo stund“ nach Mitternacht, wie wiederum Richental schreibt – landeten der König und sein Gefolge in Konstanz. Wie sie in der kurzen Zeit den Weg über den See geschafft haben sollen, wissen wir nicht. Irrt Richental mit seiner zweiten Stunde? Wenn man an die umständliche Beladung von Mensch und Material in Überlingen, wenn man an die Geschwindigkeit denkt, mit der Lastsegelschiffe damals über den See fahren konnten, dann mag zwei Uhr fast utopisch, drei Uhr als Ankunftszeit viel realistischer sein. Mit dem Gefolge und den Dienern begab sich das Königspaar von der Landestelle ins Rathaus der Stadt. Kein weiter Weg, etwa hundert Meter. Nur das Konrads- oder Fischbrucktor durchschreiten, dann innerhalb der Stadtmauer noch ein Stück nach Norden, und der König und die Königin standen auf dem Fischmarkt vor dem Rathaus. In der Ratsstube wärmten sich die beiden auf. Die Ratsherren erquickten die Gäste mit Malvasierwein, vielleicht gewärmt. Wie gut das alles tat nach der Überfahrt! Als Geschenk der Bürger erhielt das Königspaar zwei Brokattücher, kostbare Baldachine. Unter diesen, von je vier Stangen getragen, schritten der König und die Königin nur wenig später zum Münster. Mitten im Zug flackernde Kerzen mit ihrem schwachem Licht, aber der Feierlichkeit der Stunde angemessen.
Der Papst und sein Klerus hatten mit dem Beginn der Messe tatsächlich gewartet. Müde, erschöpft und wohl auch ein wenig ratlos standen sie in der eisigen Kirche, zermürbt von der Verschiebung des Zeitplans. Es war gegen fünf Uhr morgens: Endlich – der König war da; der Gottesdienst konnte beginnen, eine Erlösung für alle. Sigismunds Plan war vollkommen aufgegangen, wie viele Nerven er auch alle Beteiligten gekostet haben mag. Warum um alles in der Welt aber war es dem König so wichtig, dass nicht eher mit der Messe begonnen wurde, als bis er da war? Die Antwort ist einfach: Es war der königliche Weihnachtsdienst, den er als Laie hier ausüben wollte, ja, seinem Herrschaftsverständnis gemäß ausüben musste. Und zwar nicht einfach irgendwann in der Heiligen Nacht oder irgendwo, sondern mit ihm – dem Papst – in der Kirche zu einem ganz bestimmten Punkt während des Gottesdienstes.
Der königliche Weihnachtsdienst: Es handelte sich dabei um einen seit der Regierungszeit Kaiser Karls IV. (1346–1378), also des Vaters Sigismunds, bezeugten Brauch, der dem römisch-deutschen König das Recht zugestand, im Rahmen der feierlichen Weihnachtsmette in der Heiligen Nacht den Vers aus dem Lukas-Evangelium vorzutragen oder auch vorzusingen: „Es ging ein Gebot aus von dem Kaiser Augustus, dass der gesamte Erdkreis geschätzt werde.“ Dazu erschien der König in einem geistlichen Gewand mit Pluviale, einem halbkreisförmigen, ärmellosen Mantel oder mantelähnlichen Umhang, und der Stola. Auf dem Haupt trug er die Krone, umgeben war er von Fürsten des Reiches, von denen einer das Reichsschwert über dem Haupt des Vortragenden zu halten hatte. Er, der König und zukünftige Kaiser, das sollte der Akt ausdrücken, besaß zu dieser Stunde die Möglichkeit, alle Welt daran zu erinnern, dass es zur Zeit der Geburt des Erlösers zwar noch keinen Papst, wohl aber bereits einen Kaiser gegeben hatte. Es war die Heilige Schrift selbst, die das alles so formulierte. Der König hatte es nur noch vorzutragen. Und so geschah es auch zu Konstanz 1414, in der Heiligen Nacht.
Richental berichtet darüber:
„Und sang man das ampt Dominus dixit ad me etc. (…) Und do es kam zu dem evangelii, do gieng der Romsch Küng mit vil brinnenden kertzen uff die kantzel und sang das Evangelium Exiit edictum etc.“
Eine wertvolle, über Richental hinausgehende Interpretation des Geschehens bietet ein französischer Benediktiner aus St-Denis, der zwar, was den konkreten Ort der Lesung betrifft, aus dem Herkommen schöpft, aber verstanden hat, warum die Aktion so wichtig war: Der Papst, so der Benediktiner, habe dem Kaiser zu Gefallen bestimmt, dass dieser „zum Zeichen kaiserlicher Würde“ (ipse in signum imperatorie dignitatis) das Evangelium Exiit singen konnte. Wir hören den Druck heraus, der auf Johannes in dieser Nacht gelastet haben mag, die Zumutungen des Königs und zukünftigen Kaisers, die dieser dem Papst abverlangte.