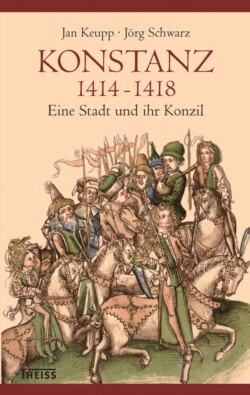Читать книгу Konstanz 1414-1418 - Jörg Schwarz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Konzil – Was ist das?
ОглавлениеDer Gegenstand dieses Buches ist ein Konzil, das große Konzil, das in den Jahren 1414–1418 in der Stadt Konstanz am Bodensee stattfand. Ein vierjähriges, schon durch seine schiere Dauer auffallendes Ereignis, das Geschichte machte, in Konstanz selbst und weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ein Ereignis nicht nur der städtischen oder der Kirchen-, sondern eines der gesamten europäischen Geschichte, ein Weltereignis, ohne Übertreibung, zumindest dann, wenn man – was zu Beginn des Zeitalters der großen Entdeckungen gerade noch gerechtfertigt sein mag – den europäischen Erdteil aus der Sicht der Europäer als „Welt“ bezeichnen will. Doch ein „Konzil“ – was ist das überhaupt? Was bedeutet der Begriff? Wo kommt er her? Damit wollen wir beginnen.
Der Begriff „Konzil“ kommt aus dem Lateinischen (concilium). Er hat – wie so viele andere Begriffe dieser europäischen Großmuttersprache, die ja so streng haushälterisch denkt und in der ein Wort sowohl für eine Sache selbst wie auch für das glatte Gegenteil davon stehen kann – mehrere Bedeutungen. Concilium bedeutet zunächst einmal ganz allgemein „Versammlung“, „Kreis“ oder „Schar“, wer immer sich hier versammeln, einen Kreis bilden oder als „Schar“ auftreten mag. In einem enger gefassten Sinne bezeichnet der Begriff eine politische Versammlung – im Grunde sind wir der von uns gesuchten Bedeutung schon ganz nahe –, vor allem die römische Senatsversammlung oder -sitzung oder aber auch die Tributkomitien der plebs, der einfachen Leute Roms also, die nicht im Senat zusammenkommen durften. Rom barg bekanntlich eine Welt, war sie aber nicht als solche, und außerhalb der Stadt konnte der Begriff auch für „Landtag“ oder „Bundestag“ stehen. Und wenn die römischen Dichter, die Poeten des Weltreichs die Vokabel gebrauchten, dann mochten sie sie auch im Sinne einer „Vereinigung“ oder einer „Verbindung“ verwenden.
Nun aber sind wir endgültig am Zuge; denn das Latein als die neben dem Griechischen wichtigste ältere Sprache unseres Kontinents überdauerte bekanntlich das Ende des Römischen Reiches im Westen und bestand weiter – dies ein Begriff der Fachleute – als Mittellatein, als das Latein des Mittelalters. Und hier nimmt der Begriff, und zwar sehr früh schon im Mittelalter, im Grunde noch in der Antike, jene Bedeutung an, die die unsrige werden wird, nämlich im Sinne einer Versammlung der Kirche, der organisierten christlichen Kirche, die sehr schnell schon merkte, dass das gemeinschaftliche Leben unter dem Dach ihrer Religion sich nicht von selbst regeln ließ, sondern dass man sich versammeln und sich beraten und dass man auf diesen Versammlungen und Beratungen und durch diese ordnen und entscheiden, bestätigen und strafen muss.
Die beherrschende Gestalt der frühen Konzilien der Kirche war zunächst nicht der Papst, sondern der Kaiser, genauer gesagt der oströmische Kaiser, und zwar noch bevor er seit 476 für mehrere Jahrhunderte der einzige Kaiser war, den es in Europa (und Asien) geben sollte. Es war der Kaiser, der das Konzil einberief, es durch seine Beamten leiten ließ und sich um die Verwirklichung seiner Beschlüsse kümmerte. Seit 1054 gingen West- und Ostkirche, gingen der Papst in Rom und der Patriarch in Konstantinopel endgültig getrennte Wege. Und nachdem die westliche Kirche ebenfalls ungefähr in dieser Zeit mit eben diesem Papst an der Spitze einen ungeheuren Aufschwung in Selbstverständnis und Selbstbewusstsein genommen hatte, begann der Papst, die Versammlungen seiner römischen Kirche zu Versammlungen auszubauen, die eine übergeordnete, eine „universelle“ Gültigkeit besitzen sollten.
„Konzil“ ist – selbst in dem ins Auge gefassten engeren Sinne des mittelalterlichen Latein – nie gleich „Konzil“ gewesen. Oder wenigstens in den seltensten Fällen. Über das, was ein Konzil ist, haben sich viele die Köpfe zerbrochen, die Kirchenrechtler, die Verfasser der Streitschriftenliteratur in den großen Kontroversen zwischen Papst und Kaiser, die Protagonisten der theologischen Debatten zwischen West- und Ostkirche sowie – wir rücken noch einmal ganz eng an unser Thema heran – die unterschiedlichen Parteien in der großen Kirchenspaltung des Abendlandes um 1400. Einer einfachen Aufteilung zufolge lassen sich die Universalkonzilien der geeinten Kirche von denen der Westkirche unterscheiden. Damit hätte man zum Beispiel das von Kaiser Konstantin dem Großen (306–337) einberufene Konzil von Nicäa von 325 mit seinem berühmten Glaubensbekenntnis, das für die West- und Ostkirche gleichermaßen Gültigkeit besitzt, etwa von dem III. Laterankonzil von 1179, in dem es nur um westkirchliche Belange ging, sinnvoll abgegrenzt.
Noch nichts gesagt ist damit freilich über die Vielfalt der Konzilien in der Westkirche selbst. Folgt man den Kirchenrechtlern des Hochmittelalters, dann lassen sich drei Arten (genera) von Konzilien auseinanderdividieren: zum einen die Generalkonzilien, zum zweiten die Provinzialkonzilien sowie drittens die Diözesansynoden. Möglich – und durchaus nicht unsympathisch, wenn man Vereinfachungen für ein erlaubtes Mittel der Erklärung hält – ist aber auch die Zusammenfassung dieser drei Gruppen in zwei, die dann, um verständlich zu bleiben, freilich weiter aufgeschlüsselt werden müssen: zum einen in die Gruppe der Universal- oder Generalkonzilien, zum anderen in jene der Partikularsynoden, die wiederum in den Bereich der Partikularsynoden selbst sowie in jenen der Bischofssynoden zerfällt. Das, was wir mit Konstanz 1414–1418 ins Auge fassen wollen, wäre somit ein Universal- oder Generalkonzil, eine Versammlung, die Gültigkeit für die gesamte westliche Kirche beanspruchte, wenngleich der Osten aus den Geschäften des Konzils keineswegs ausgeblendet werden kann, was sowohl die Anwesenheit hochrangiger Würdenträger als auch die das Konzil beschäftigende Frage nach der „Griechenunion“, also der Vereinigung mit der Ostkirche, bezeugt.
Die Probleme des Themas sind hiermit aber noch längst nicht alle beseitigt – sie fangen im Grunde jetzt erst richtig an. Wer muss auf einem Konzil anwesend sein, damit es als Konzil gelten kann? Ist die Anwesenheit eines Papstes Grundvoraussetzung? Welchen Willen repräsentiert es – den des Papstes oder den der Gesamtkirche? Wie weitreichend dürfen seine Entscheidungen sein? Kann ein Konzil irren? Ist es unfehlbar? Mit all diesen Fragen sind wir mitten im Konstanz der Jahre 1414–1418 angelangt.