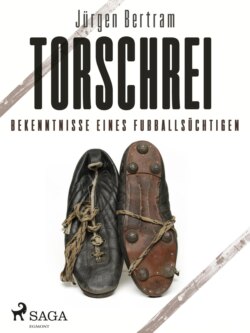Читать книгу Torschrei - Bekenntnisse eines Fußballsüchtigen - Jürgen Bertram - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 Kopfrechnen
ОглавлениеMein Vater: »Hiiiiii.«
Ich: »Huuuuuu.«
Er: »Haaaaaa.«
Ich: »Hoooooo.«
Er: »Heeeeee.«
Mehr fällt uns nicht ein an den radiolosen Augustabenden, als im Wechsel diese langgezogenen Töne auszustoßen. Die Hirsche in den Harzwäldern geben, wenn sie sich verständigen wollen, ähnliche Laute von sich. Ich habe das Spiel erfunden, mit dem wir die grauenvolle Stille in unserem Wohnzimmer zu füllen versuchen. Fängt mein Vater, so die Regel, zum Beispiel mit dem Vokal »I« an, dann muss ich einen anderen Vokal, zum Beispiel ein »U« oder ein »O«, dagegensetzen. Reagiere ich mit einem »I«, also demselben Buchstaben, steht es 1:0 für meinen Vater.
Meistens verliere ich das Spiel, weil ich mich viel zu oft auf die Stubentür konzentriere. Ach, würde sie sich doch öffnen und meine Mutter über ihre Schwelle treten. Aber meine Mutter erscheint nicht; natürlich nicht. Mein Vater legt während unseres Spiels immer mal wieder den Finger an seine Lippen. Pssst, bedeutet das. Wir dürfen die gnädige Frau nicht stören!
Einmal in der Woche, meistens am Samstagnachmittag, besuchen wir nun den Friedhof, der eine knappe Stunde von unserer Wohnung entfernt liegt. Ich trage die grüne Gießkanne, mein Vater den Rechen für das zusammenzuharkende Laub und die Eisenkralle, mit der man das um das Grab wuchernde Unkraut lockern kann. Manchmal bricht mein Vater unterwegs einen Ast ab und schiebt ihn mir zwischen die angewinkelten Arme und die Schulterblätter. Es ist eine Übung, die mich zu der kerzengeraden Haltung zwingt, wie mein Vater sie einnimmt, wenn er mit der gnädigen Frau telefoniert. Wer in der Jugend krumm geht, sagt man im Harz, der bekommt als Erwachsener einen Buckel.
Am Anfang bewege ich mich auf diesem Friedhof mit gemischten Gefühlen. Einerseits macht es mir Angst, dass hier Menschen unter der Erde liegen, die nicht mehr reden, lachen, weinen, jubeln, schimpfen können, und dass ich, hätte meine Mutter ihre Ankündigung wahrgemacht, mich mitzunehmen, dazu gehören würde. Andererseits geht von den steinernen Engeln, den schattigen Alleen, den goldenen Schriftzügen, den kühn von Zweig zu Zweig springenden Eichhörnchen ein großer Reiz aus. Und irgendwann ist mir dieses geheimnisvolle Gelände zwischen dem Bahndamm und der Ausfallstraße nach Hildesheim so vertraut wie das Stadion am Osterfeld. Die Anordnung der Gräber, Wege, Brunnen und Komposthaufen könnte ich genauso präzise aufzeichnen wie die taktische Ausrichtung von Goslar 08 vor einem Heimspiel.
»Generalkonsul« – »Dr. jur. dipl. rer. pol.« – »Dipl.-Bauingenieur« – »Gewerberat Dipl.-Ing.« – »Mittelschulrektor« – »Justizsekretär« – »Regierungsbaurat a.D.« – Die vielen Titel auf den Steinen erinnern mich an die Geschichte, die meine Mutter immer erzählte, wenn ihr das ständige »Herr Direktor« oder »Gnädige Frau« meines Vaters mal wieder auf die Nerven ging: In Fürstenwalde bei Berlin, der Heimatstadt meiner Mutter, haben die Schüler der Oberprima ihr Abiturzeugnis erhalten. Um dies der Bevölkerung kundzutun, tragen sie bei ihrem Marsch durch die Straßen extra für diesen Zweck angefertigte Mützen. Der Einzige, der auf eine Mütze verzichtet, ist einer der Brüder meiner Mutter, mein Onkel Gerhard. Er hat das Abitur als Bester bestanden. »Heute ist er Oberbaurat«, fügte meine Mutter ihrer Schilderung stets hinzu. »Aber auf seinen Titel legt er nicht den geringsten Wert. Sag deinen Kriegskameraden, dass sie den bloß nicht mit ›Herr Oberbaurat‹ anreden sollen.«
Eine von Efeu berankte Edeltanne, mehrere dunkelgrüne Eiben und ein rot leuchtender Vogelbeerbaum säumen die weitläufigste Ruhestätte auf diesem Friedhof. »Darré« steht auf einer riesigen, stets mit frischen Blumen geschmückten Steinplatte. »Bei Adolf«, sagen die Leute über den hier ruhenden Toten, »war das ein ganz großes Tier.« Als »Reichsbauernführer«, erfahre ich aus dem Lexikon, hat Richard Walther Darré in der »Reichsbauernstadt Goslar« dem Mann mit dem Schnurrbart gedient, den man vergangenes Jahr vor dem Jägerdenkmal mit »Heil Hitler« grüßte. Als »Politiker der NSDAP« habe er die »Blut und Boden«-Idee propagiert. NSDAP? Ist das nicht die Partei, der auch mein Vater angehörte?
Befinden wir uns auf der Höhe dieses Grabes, verlangsame ich meine Schritte und lasse mich hinter meinen Vater zurückfallen – wie der Halblinke Fritze Schröder, wenn er sich, um sich der gegnerischen Abwehr zu entziehen, im Mittelfeld versteckt. Ich komme einfach nicht an dem Vogelbeerbaum vorbei, ohne mir ein paar seiner Früchte zu grapschen und sie mal mit dem rechten, mal mit dem linken Fuß von mir zu stoßen. Bei dieser das Ballgefühl ungemein schulenden Übung kommt es darauf an, dass man die winzige, manchmal schon verschrumpelte Beere überhaupt trifft. Wenn fünf von zehn Versuchen gelingen, ist das schon ein Erfolg.
»Tooor«, flüstere ich, als eine der Beeren über die Linie eines steinernen Torbogens mit der Aufschrift »Generaloberst Heinz W. Guderian« kullert. Der »schnelle Heinz«, der, wie die »Goslarsche Zeitung« schrieb, den »Offensivstoß auf Moskau« anführte, liegt hier also begraben. Nach wenigen Schritten nehme ich das 1: 0, das ich schon für mich verbuchte, wieder zurück. Dieses Tor, gestehe ich mir ein, habe ich dem Zufall verdanken, nicht meinem Können.
Zwischen den Gräbern des Reichsbauernführers und des Panzergenerals befindet sich ein von einer Hecke umrahmtes Feld, das die Aufschrift auf einem Kreuz als »Ehrenfriedhof« bezeichnet. Die Gräber reihen sich hier »auf Kante« wie die Wege und Beete in unserem Garten im Bergtal.
Unter die Namen der »Gefallenen« hat man ihr Geburts- und Todesjahr graviert. Ich ziehe die untere von der oberen Zahl ab und errechne so das Alter, das sie erreichten. 1916–1940 = 24 Jahre. 1924–1940 = 16 Jahre. 1891–1944 = 53 Jahre. 1908–1945 = 37 Jahre. 1902–1944 = 42 Jahre; wie meine Mutter. Ob auch ich es bis 42 schaffe? Mit Begonien haben wir das Grab meiner Mutter bepflanzt. Unser Nachbar, der alte Müller, riet uns dazu. »Begonien«, meinte er, »sind nicht kaputt zu kriegen.«
Manchmal möchte ich den Friedhof am liebsten gar nicht wieder verlassen. Denn jenseits dieses so friedlichen Parks wittere ich nur noch Gefahren, rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Als ich auf dem Nachhauseweg von der Schule beobachte, wie ein Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene die Rammelsberger Straße hinunterrast, denke ich sofort: Das ist mein Vater! Der Steiger Baumann – Herzinfarkt. Der Buchhalter Wolters – Herzinfarkt. Warum nicht auch mein Vater? Erst als er abends mit mir Kopfrechnen übt, weiß ich: Er lebt.
3136 minus 2113. Oder 244 durch 13. Oder 73 mal 54. Oder 1237 plus 4534. Mit der Stoppuhr misst mein Vater, wie schnell ich die Aufgabe löse. Wer gut im Kopfrechnen ist, sagt er, hat im Büro schon mal einen Vorteil. Will er, dass auch ich eines Tages im Büro arbeite?
Zieht über dem Rammelsberg ein Gewitter auf, bin ich mir sicher, ganz sicher, dass gleich ein Blitz unser Haus in Brand setzen wird.
Kündigt der Wetterbericht »leichte Bewölkung« an, schrecke ich zusammen, weil »leichte« wie »Leiche« klingt. Qualm steigt von einer Bergkuppe auf, als ich den dicken Otto, der Margarine an Lebensmittelgeschäfte ausliefert, auf einer Fahrt durch das Harzvorland begleite. Zwei Autos, phantasiere ich, sind zusammengestoßen. Die Insassen verbrennen gerade. Als wir den Hügel erreichen, stellt sich heraus, dass auf einer Halde alte Reifen vor sich hin kokeln.
Ich bin so erleichtert, dass ich dem dicken Otto übereifrig dabei helfe, die Kartons mit Margarine in die Lager zu tragen. In Osnabrück, wo der Oberligaverein VfL zu Hause ist, wird die Margarine hergestellt. »Frihoma« ist ihr Markenname.
Der Küchenchef im Stadthotel
spricht hocherfreut zur Kaltmamsell:
Noch mal so gut das Essen schmeckt,
seitdem Frihoma ich entdeckt.
Kurz vor Weihnachten trifft allerdings ein, was ich seit Monaten befürchte. Blau ist die Farbe des Briefes, den das Gymnasium an meinen Vater schickt und den ich rechtzeitig abfange. Ein Blauer Brief, das weiß ich von meinen Mitschülern, verheißt nichts Gutes. Und tatsächlich endet das Schreiben mit der Bemerkung: »Versetzung erheblich gefährdet.« Mit seiner Unterschrift möge mein Vater bestätigen, dass er die Mitteilung erhalten hat.
Mir ist klar: Wenn er diesen Brief liest, belegt mich mein Vater endgültig mit einem Fußballverbot, der schlimmsten aller Strafen. Ich denke an Torwart Macha, Mittelläufer Thielemann, den Halblinken Fritze Schröder, den Halbrechten Walter Salier, den Linksaußen Juppe, an meine eigenen Spiele auf der Wiese hinter dem Jägerdenkmal, an die Montagnachmittage, die ich in der Lesehalle in der Marktstraße verbringe, um im »Niedersachsen-Sport« und im »Kicker« die Tabellen, die Spielberichte und die Kommentare zu studieren …
Und mir fällt ein, was mir ein Mitschüler erzählt hat, der in einer ähnlichen Lage war wie ich: Man fischt aus einem Aktenordner irgendein Schreiben mit der Unterschrift des Vaters heraus. Dann teilt man eine nicht zu alte Kartoffel in zwei Hälften und presst eine der feuchten Hälften auf diesen Schriftzug. Dann überträgt man das sich auf der Innenfläche abzeichnende Muster ganz vorsichtig auf den Brief, den der Vater unterschreiben soll. »Wichtig ist«, hat der Mitschüler gewarnt, »dass dabei die Hände nicht zittern.«
Meine Hände zittern schon beim Durchschneiden der Kartoffel. Um mich zu beruhigen, richte ich meinen Blick auf den Gipfel des Rammelsberges, wo sich die Fichten im Dezemberwind wiegen. Die Wohnzimmertür öffnet sich – mein Vater. Ich schaffe es nicht mehr, die Beweisstücke in der Schublade verschwinden zu lassen und gestehe alles. Nach einigen Schlägen und Tritten spricht mein Vater das Urteil: Fußballverbot – für immer.
Ich balle meine Finger zu Fäusten, presse die Nägel ganz fest in die Handflächen. Von Goslar 08, so schwöre ich mir, lasse ich mich durch niemanden trennen. Auch durch meinen Vater nicht. Ich werde ihn austricksen wie Fritze Schröder die gegnerische Verteidigung. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr.