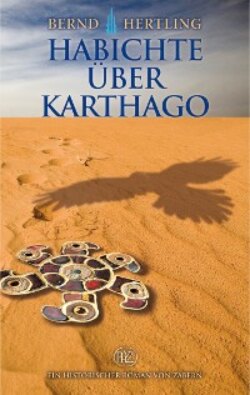Читать книгу Habichte über Karthago - Jürgen Hertling - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Engel der Rache
Оглавление29. April 429 A. D.
Die Fesseln an den Handgelenken fügten ihr Schmerzen zu, die sie nicht mehr gewillt war zu ertragen. Je länger sie in diesem Zustand verblieb, desto geringer war ihre Chance auf Befreiung. Sie atmete tief durch, mehrmals, ließ ihren Kopf herabhängen, so dass er vor ihrer Brust baumelte, und bewegte ihn in rhythmischen Drehungen, bis plötzlich ein Schauer durch ihren Körper ging. Wie tot hing die keltische Gefangene an dem Pfosten, an den sie die suebischen Krieger gefesselt hatten.
Die schwarzhaarige Frau, die, ihrer zierlichen Figur hohnsprechend, über eine erstaunliche Geschicklichkeit im Nahkampf verfügte, war doppelt gesichert worden. Man hatte sie in einen Schweinekoben gesperrt und ihr zusätzlich die Hände hinter einem tragenden Pfosten zusammengebunden, an den man sie im Grätschsitz gelehnt hatte. Bei ihrer Gefangennahme hatten die Sueben sich von ihrer Gefährlichkeit überzeugen müssen, und so hatte Prinz Hermigar angeordnet, dass zwei Männer zu ihrer Bewachung abgestellt wurden. Diese jedoch, ältere Krieger, die dem groß angelegten Aufklärungsvorstoß, den Hermigar soeben mit der im Lager stationierten Einheit durchführte, ohnehin nicht hätten folgen können, zogen es vor, sich die Zeit mit den Lieblingsbeschäftigungen des beschäftigungslosen Soldaten, Trinken und Würfelspiel, zu vertreiben.
„Dunnerkeil on Wolkebruch, schlag ra, schlag ra, itz händ i allts verlore!“
„Isch des kähl, I brouch koin Kriag, om reich z‘werra!“
Derart ihrer Obsession huldigend, schenkten die beiden Krieger natürlich auch der Dohle, die auf dem Innenhof des zum Lager umfunktionierten Gehöfts herumhüpfte und vermutlich Futter für ihre Jungen suchte, keinerlei Beachtung. Scheinbar ziellos hüpfte das Flattervieh herum, bis es schließlich einen metallisch glitzernden Gegenstand, der aussah wie ein Stückchen Kupferblech, aufhob und damit herumspielte. Anscheinend erfüllte es seinen Zweck, denn nach einigem Herumprobieren balancierte der Vogel das blitzende Beutestück quer im Schnabel und schlüpfte damit in den langen Stall. Kurz darauf erschien er wieder auf dem Hof und flog mit eiligen Flügelschlägen in südlicher Richtung davon.
Die Dohle achtete ständig auf ihre Deckung im Gehölz und im Gesträuch. Sie hatte sich ungefähr eine Laufstunde weit vom Lager entfernt, als sie Männer wahrnahm, die sich durchs Gestrüpp kämpften.
„Große Morrigan, kehren die Sueben schon um?“
Sie flog näher an den Trupp heran. Nein, das waren keine Sueben, aber was waren das dann für Krieger, die da geduckt durchs Unterholz pirschten? Vermutlich gehörten sie zum Heer der Feinde der Sueben und waren Angehörige jenes anderen Germanenvolkes, das zu suchen sie unterwegs war. Waren sie Vandalen, die nun ihrerseits Hermigars Bereitstellung auskundschaften wollten? Wenn ja, liefen sie in die richtige Richtung und würden bald fündig werden.
Weiter.
Bald schon fand die Dohle die Sueben, sie spähten immer noch in die andere Richtung aus, waren jedoch im Rücken der gegnerischen Streifschar. Hierher durfte sie sich nach ihrer Flucht nicht wenden. Um kurz zu verschnaufen, ließ sich das Tier im verwinkelten Geäst einer hohen Steineiche nieder, die den Wald überragte, und flatterte sodann von Ast zu Ast bis in die Krone des Baumriesen hinauf. Von hier aus hatte sie einen guten Überblick. In ihrem Rücken das Suebenlager, vor ihr war bereits die Küstenlinie schwach am Horizont erkennbar.
„Große Morrigan, hilf!“
Sie schwang sich in die Luft und flog zielstrebig in Richtung Meer, bis sie auf ein stark befestigtes Lager stieß, das offenbar das Hauptquartier der Vandalen war. Zu Fuß eine gute Tagesstrecke, das hieß zwei Nächte, wenn alles glattging. Bald hatte sie das Lager erreicht und ließ sich erneut auf einem großen Baum nieder, um abzuschätzen, mit wem sie es zu tun haben würde. Ein zahlenmäßig starkes Heer war hier untergebracht, es wimmelte von germanischen Kriegern. Hoffentlich waren sie weniger wild als ihre Peiniger, denn dieses Lager war ihr von Caffah gewiesenes Ziel, das sie nun nach langer Suche endlich gefunden hatte. Aber vorher war es anscheinend unbedingt nötig gewesen, sich von der feindlichen Partei fangen zu lassen ...
Sie putzte ihr Gefieder und bemerkte erst sehr spät die beiden jungen Männer, die mit Pfeil und Bogen ausgerüstet näherkamen. Der ältere, etwas größere, trug einen für sie fast heimisch wirkenden bunten Kriegsmantel und ebenso farbenfrohe Hosen aus Leder, sein mittelblondes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, begann sich an der Stirnpartie zu lichten, was er mit einem von der Sonne weitgehend gebleichten Vollbart kompensierte. Der jüngere, kleinere war von etwas untersetzter Statur, doch strahlte er Energie und Ausdauer aus. Auch er trug seine dunkelbrünette schulterlange Mähne offen, wie bei den meisten Germanenstämmen üblich, doch ohne jenen seltsamen Knoten, den sich die Sueben an der rechten Schläfe in ihr Haar wanden. Er war glattrasiert und hatte, was ihr trotz der Entfernung auffiel, erstaunlich grüne Augen, die in der Sonne blitzten. Die beiden jungen Männer verband etwas. Das war für sie, mit dem scharfsichtigen Vogelauge ausgestattet, auf den ersten Blick erkennbar. Schließlich waren sie beide mit dem Schutzzeichen der Göttin gezeichnet. Neugierig beäugte der Vogel die beiden Gestalten, die mittlerweile ein gutes Stück näher herangekommen waren, mit quergestelltem und geneigtem Kopf. Der dunkle Krieger gefiel ihr gut, zu gut, denn sie konnte den Blick nicht von ihm wenden. Hierher musste sie gelangen! Hier würde ihre Botschaft Verständnis erfahren, dieses Zeichen hatte die Göttin ihr zum rechten Zeitpunkt geschickt, denn nach druidischer Auffassung verlieh die Göttin ihren Schutz keinen unwerten Männern.
„Ich bin sprachlos. Nach all der Zeit hast du dich ja nicht so arg verändert – äußerlich. Aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass du in der Zwischenzeit keine Frau mehr angerührt hast“, hörte sie den Größeren sprechen, „und was mich daran am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass du gesagt hattest, dir würde dabei gar nichts fehlen.“
„Nun, als Adept der pythagoreischen Lehren muss man auf so manches verzichten“, gab der Dunkle nachdenklich zurück. „Man muss viel tun, um rein zu sein, sich bestimmter Nahrungsmittel enthalten – so gut es eben geht –, jetzt in der Kriegszeit kann man das nicht alles befolgen, auch soll man zum Beispiel seine Sinnesorgane stärken, durch bestimmte Übungen des inneren Hörens, der auf Innen wie Außen gerichteten Aufmerksamkeit. Schau nur, dort drüben auf dem Ast der Vogel: Ich würde sagen, es ist eine Dohle und keine Krähe, ich kann das Grau im Nacken sehen – ich wette, du nicht!“
Der Größere blinzelte angestrengt. „Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren“, meinte er, „ich könnte jetzt nicht erkennen, ob das dort eine Dohle ist. Ich glaube, ich schieße sie herunter, dann werde ich mir Klarheit verschaffen können.“
Kaum dass er die bedeutungsschweren Worte gesagt hatte, legte er auch schon einen Pfeil auf die Sehne und zielte auf das arglose Federvieh.
Wie versteinert saß sie da, reglos vor Schreck. Sie sah sich in ihrem Vertrauen in die Göttin getäuscht. Das also ist das Ende, dachte sie noch. Doch in dem Moment, als der Pfeil von der Sehne losschnellte, erhielt er plötzlich eine andere Richtung und bohrte sich zuletzt in einen nahe stehenden Baumstamm.
«Truchthari, du Barbar! Nur weil du dir einbildest, dass du schlechter siehst, willst du das unschuldige Tier hier töten? An dir ging Eudaimons Unterricht wohl spurlos vorüber. Du kannst doch nicht einfach zum Scherz ein Tier töten. Zum Nahrungserwerb sehe ich es ja noch ein, aber nur so aus Jux und Tollerei?!“
Der kleinere Krieger, offensichtlich in heiligem Zorn, hatte dem Größeren während des Schusses einen Stoß versetzt und ihr somit das Leben gerettet.
„Wer Tiere verschont, wird auch nicht tierisch über eine allein wandernde Frau herfallen“, schloss sie aus dem Verhalten des jüngeren Kriegers und machte sich auf, zurück in den Schweinekoben.
Nun begann der schwierigste Teil der Befreiungsaktion: Hatte sie das Kupferblech so abgelegt, dass sie es mit den nun schon fast tauben Fingern würde greifen können? Sie tastete sich nach unten und spürte, dass sie es recht gemacht hatte, doch wollten die Hände nicht gehorchen. Das Werkzeug entglitt ihr, zum Glück ohne Geräusch. Sie verbiss sich die Verwünschung, die ihr auf der Zunge lag. „Jetzt ist dein Geist so stark und doch vermagst du keinen Finger zu rühren, wenn es um deinen eigenen Körper geht“, murmelte sie vor sich hin und schüttelte den Kopf. Doch dann konzentrierte sie ihre Willensanstrengung auf die rechte Hand und das Blech am Boden. Plötzlich war ihr Tastsinn wieder aktiv, und es gelang ihr, das flache Kupferteilchen, das für ihre Freiheit stand, tatsächlich in die Finger zu bekommen und damit an ihrer Fessel zu sägen – endlich, nach einer schieren Ewigkeit, gab das Seil nach und riss entzwei. Das wiederkehrende Blut trieb ihr Tränen in die Augen, und es war ihr, als würden ihre Hände von innen her mit heißem, pulsierendem Blei ausgegossen. Doch mit der Zeit kehrte mit dem Blut auch die Muskelspannung zurück. Sie rieb ihre Hände aneinander, fühlte nach, wie gut es tat, sie wieder richtig bewegen zu können und spürte, wie die Kraft langsam bis in die Fingerspitzen hineinwuchs. Sie lockerte die Fingergelenke, indem sie die Knöchel der Reihe nach krachen ließ. Dann erst fühlte sie sich stark genug und bereit und nahm ihre vorherige Position wieder ein, mit hinter dem Pfosten verschränkten Armen. Mit einem Mal fing sie an, wie am Spieß zu schreien.
„Willst du wohl ruhig sein, du Schlampe!“, polterte einer der beiden Wächter. Sie aber hörte nicht auf zu brüllen, steigerte sich vielmehr in einen hysterischen Krampf hinein, dass sie selbst Angst bekam, ihr würde nach spätestens zwölf Herzschlägen die Luft zum Atmen wegbleiben. Doch setzte sie das sehr lästige, ja schier schmerzerregende menschliche Dauergeräusch fort, bis endlich einer der Sueben in den Koben gestürmt kam. Er kam gerade recht, um zu sehen, wie die Gefangene die Besinnung verlor. Schwer fiel ihr Kopf gegen den sich nur noch schwach bewegenden Brustkorb. „Jetzt ist sie wenigstens still“, dachte der Krieger. Zur Sicherheit wollte er jedoch ihre Fesseln nochmals überprüfen, man konnte ja nie wissen, was derart rasende Frauen anrichteten. Er bückte sich zu ihr herunter, kniete nieder und fummelte im Halbdunklen an ihren Handgelenken herum – um festzustellen, dass da etwas für ihn Lebensnotwendiges fehlte!
Diese Erkenntnis nützte ihm nichts mehr, denn mit der Schnelligkeit und Zielsicherheit einer Katze fuhr die Rechte der Keltin zum Griff seines Kurzschwertes, das er am Gürtel trug, riss es aus der Scheide und stieß die Klinge bis ans Heft in seine Kehle. Wie aus einem Sturzbach spritzte das Blut, und der Suebe sank röchelnd zu Boden. Die dunkle Frau trennte schließlich das Haupt vollends ab und ließ das Blut in einer riesigen Lache zusammenlaufen.
„Für dich, oh Morrigan, Göttin des Krieges, nimm mein Opfer gnädig an“, murmelte sie neben dem Torso. Den Kopf legte sie behutsam zu Boden, sah ihm in die Augen. „Verzeih mir, dass ich dich getötet habe! Du warst nicht mein Feind, und du warst sicher ein tapferer Krieger. Mögest du zu Ruhm und Ehre wiedergeboren werden!“
Sie schlich sich aus dem Koben in den langen Gang des Stalles und spähte nach draußen. Anstatt sich um seinen Kameraden zu sorgen, ging der andere Suebe in eine entfernte Ecke des Lagers, um während der sich unerwartet ausdehnenden Spielpause sein Wasser abzuschlagen. Sie konnte keine Zeit darauf verschwenden, sich auf die Suche nach ihren beschlagnahmten Waffen zu machen, also gürtete sie sich kurzerhand mit dem Dolch und dem Sax des Getöteten. Sodann entfernte sie sich den Gang entlang aus dem Blickwinkel der Wache. Seltsam schnaubende Laute drangen aus der letzten einzelnen Box, sie erinnerten an lange, gleichmäßige Atemzüge. Vermutlich war hier ein krankes Pony untergebracht. Im Nu war sie im Freien, überquerte lautlosen Schrittes hinter dem Rücken des Sueben den Platz und näherte sich dem offen gelassenen Tor.
Oben auf dem Pfosten saß die Dohle und keckerte. Flugs ließen sie das Lager der Sueben hinter sich und entfernten sich unbemerkt in den Wald.
Die hispanischen Wälder waren von anderer Art als die heimischen der Grünen Insel, viel lichter in der Stammhöhe, dafür mit hoher, weitverzweigter Bodenvegetation bedeckt. Hier auf dem warmen Sandboden mochte es Schlangen geben, sie musste achtsam sein. Ihre größte Sorge galt jedoch den zweibeinigen Schlangen, dem suebischen Streiftrupp, der bald wieder zurückkehren musste. Sie lief mit locker federndem Gang durch das Gestrüpp, sie war es gewöhnt, sich im Wald aufzuhalten und dort große Strecken zurückzulegen. Der Wald war ihr bester Freund – neben den Vögeln im Allgemeinen und ihrer Dohle im Speziellen. Hurtig wie ein Bilch erklomm sie eine Eiche und verbarg sich im dichten Laub der ausladenden Äste. Sie überprüfte ihren Sitz in einer stabilen Astgabel und begab sich, nachdem sie sicher war, keinesfalls abrutschen zu können, auf die zweite Reise an diesem Tag. Diesmal kostete es sie wesentlich mehr Kraft, in die Dohle zu schlüpfen. Ja, sie spürte förmlich einen ansonsten nicht gekannten Widerwillen von Seiten des Tieres. Noch nie hatte sie Morrigan, wie sie ihre aviatische Hülle nannte, zweimal an ein- und demselben Tag heimsuchen müssen.
Erneut flog sie in dieselbe Richtung los und stieß schon bald auf eine Lichtung, auf der die verrenkten und verkrümmten Leichen einiger vandalischer Späher lagen. Sie musste Distanz schaffen, solange die Sueben noch nichts von ihrer Flucht erfahren hatten, also beschloss sie zurückzufliegen und hinterher einen Haken zu laufen, um die heimkehrenden Krieger zu umgehen. Nach kurzer Zeit war die Dohle zurück und ließ sich neben der puppenhaft schlaffen Figur auf dem Baum nieder. Plötzlich sträubte sie das Gefieder wie vor Schreck und keckerte sodann vergnügt vor sich hin. Währenddessen ging ein Beben durch den hingesunkenen Frauenkörper und die schlanke Gestalt richtete sich, wie aus dem Schlaf erwachend, auf, reckte kurz die Glieder und kletterte behende zum Erdboden zurück, um ihren Dauerlauf durch den Wald wiederaufzunehmen. Kurz bevor die Nacht anbrach, ihre Flucht fiel ausgerechnet auf Neumond, ließ sie sich nochmals in der Deckung des Wurzelstocks eines umgestürzten Baumes nieder, um kurz auszuruhen. Ihre Gedanken wanderten, nein, zogen sie wie an einem Seil, das um ihren Hals geschlungen war, zum Lager der Vandalen. Der dunkelhaarige Krieger! Hoffentlich konnte sie möglichst rasch zu ihm gelangen, er würde sie schützen, denn es war gewiss kein Zufall, dass er ihr, besser gesagt Morrigan, das Leben gerettet hatte. Sie spürte ein bestimmtes Verlangen nach ihm, nicht nur das gewöhnliche Verlangen nach körperlicher Vereinigung, wie sie es gut kannte. Nein, ähnlich wie damals bei dem alten Druiden Caffah, der sie in die Kunst eingeführt hatte, geschah es ihr nun, dass auch ihr Geist nach Vereinigung verlangte, sie sich offenbar ohne den Menschen überhaupt zu kennen, bereits in ihn verliebt hatte. Er trug das Zeichen auf der Stirn, aber das trug auch sein Freund …
Als die ersten Stimmen der Waldvögel ertönten und sich ein fahler Schein am östlichen Horizont abzeichnete, war es ihr gelungen, ein wesentlich größeres Stück Wegs zurückzulegen, als sie ursprünglich angenommen hatte. Das Meer war deutlich nähergerückt, und sie konnte das Lager der Vandalen in der Ferne erahnen. Bis zur dritten Stunde kämpfte sie sich weiter durch das Gesträuch, doch ließ ihre Achtsamkeit nach, öfter verletzte sie sich jetzt an Dornen und abgebrochenen Zweigen, die wie Lanzetten im Laub lauerten. Diese Signale der nachlassenden Kraft nahm sie geflissentlich wahr. Sie hatte gelernt, alleine im Wald zu überleben. Die Morgenstunden hielten für die Geübte jede Menge Trank bereit, sie streifte das kostbare Nass von den Blättern der Sträucher, von den Grashalmen und presste es aus den unter der südlichen Sonne allerdings nur spärlich gedeihenden Moospolstern. Langsamer gehend begann sie, den Waldboden nach Essbarem abzusuchen, fand auch Pflanzen, deren Wurzeln kraftspendende Wirkung besaßen und grub sie mit dem Kurzschwert aus. Dieses frugale Mahl, obendrein in der wenig beliebten Geschmackskombination aus bitter und süß, schlang sie, auf einem umgestürzten Baumstamm kauernd, hastig hinunter und fühlte sich augenblicklich gestärkt. Am Waldrand erklomm sie wieder eine der hohen Steineichen, die mit ihrer enormen Höhe und der schütteren Belaubung einen idealen Aussichtsposten bot. Die Augen mit der flachen Hand abschirmend, versuchte sie sich einen Überblick über das vor ihr liegende Terrain zu verschaffen.
Der Macchiendschungel, der sich nun vor ihr erstreckte, wirkte wie ein Labyrinth. Wie sollte sie sich darin zurechtfinden? Mit einer derartig undurchdringlichen Vegetation war sie nicht vertraut. Sich an der Sonne orientierend, kämpfte sie sich durch das unübersichtliche Gestrüpp, doch schon bald musste sie sich erschöpft geschlagen geben, und ließ sich, wie sie dastand, zu Boden fallen. Es tat gut, den sich von Dauerlauf und Mundatmung wie versengt anfühlenden Atemwegen etwas Erholung zu gönnen. Sie atmete tief aus, dabei hielt sie sich die Seiten und horchte dem Atem lange nach, bevor sie wieder Luft einsog und sich Brust und Herz weiteten.
Eine gewisse Ratlosigkeit machte sich in ihr breit. Kein Wölkchen trübte den metallisch blauen Himmel, um die Strahlen der sengenden Sonne abzuhalten. Langsam, aber sicher wurde es der Keltin zu heiß, und allmählich fühlte sie sich der Anstrengung, bei den herrschenden Temperaturen mehrere Stunden sehr konzentriert und ohne Wasser durch diesen Niederurwald pirschen zu müssen, nicht gewachsen. Die Gefangenschaft bei den Sueben und die damit verbundene Mangelernährung waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Als die Sonne im Zenit stand und sie schier zu verbrennen drohte, wurde ihr klar, dass es unmöglich war, weiterzugehen. Niedergeschlagen ließ sie sich in dem Schatten, vielmehr der Vorstellung von Schatten, den die filigranen Pflanzen boten, nieder und beschloss, zu warten bis die ärgste Hitze vorüber wäre. Sie legte sich auf den staubigen Boden, das Kurzschwert griffbereit, und war innerhalb einer halben Minute eingeschlafen. Neben ihr kauerte Morrigan im Geäst eines Strauches. Den Schnabel weitgeöffnet, den Stoß gefächert und die Schwingen abgespreizt, versuchte sie, der Hitze auf ihre Weise zu trotzen. Die wohltuende Kühle des Abends weckte die Druidin aus ihrem Schlaf. Erst jetzt spürte sie, wie zerschlagen sie war, ein paar Kratzer hatten sich entzündet und schmerzten in pulsierendem Rhythmus und ihre Beine fühlten sich, kaum dass sie aufgestanden war, an wie mit Blei gefüllt. Wohl hatte ihr Wille über den Körper triumphiert, doch klagte der geschundene Sklave nun seine Rechte ein. Nirgends konnte sie hier schmerzlindernde Pflanzen entdecken und verfluchte erneut die Umstände, die sie hierher gebracht hatten.
Geduldig wartete sie auf den Neumondabend, um sich mit Hilfe der Planeten und des Zodiakus zu orientieren. Unter dem hispanischen Himmel sah sie sich vor eine nicht ganz einfache Aufgabe gestellt, konnte aber schließlich das Sternbild der Jungfrau am südlichen Horizont anvisieren. In zwei Stunden würde es von der Waage, in der sich gegenwärtig der Planet des Göttervaters aufhielt, abgelöst werden, sie musste sich also leicht südöstlich halten, um auf das Lager der Vandalen zu treffen. Der Weg war beschwerlich, da sie immer wieder nach oben schauen musste, um sich der Richtung zu vergewissern. Morrigan balancierte auf ihrer linken Schulter, wie immer, wenn ihre Meisterin nachts unterwegs war. Der Vogel schien Spaß dabei zu empfinden, wenn er getragen wurde und zupfte öfter seine Trägerin am Ohrring oder nestelte in ihren Locken herum. Die Druidin nahm es gelassen als Zeichen der Vertrautheit zwischen ihr und dem übermütigen Federvieh hin. Etwa eine Stunde nach Mitternacht erreichte sie das Lager der Vandalen.
Jetzt wollte sie nichts mehr riskieren. Mit aller Macht rief sie in die Dunkelheit lateinische Wortfetzen von Freundschaft und Gastrecht. Sie verzichtete auf das ihr geläufige Gotisch, um keinen falschen Eindruck zu erwecken.
Es kam auch eine lapidare Antwort, ebenfalls in der seltsamen Form des Lateinischen, die sich in jener Zeit bedenkenlos verwenden ließ: „mane manem!“ Was wohl so viel heißen sollte wie: Warte bis zum Morgen!
Von dieser Reaktion wenig überrascht, beschloss die Fragerin erneut die notwendige Wartezeit mit Schlafen zu überbrücken und ließ sich in respektvoller Entfernung, wiewohl in Hörweite nieder. Allerdings wollte sie in der Nähe des Germanenlagers nicht auf einen gewissen Schutz verzichten. Bald stand neben der sich auf den Schlaf vorbereitenden Frau, wie ein Schatten im diffusen beginnenden Licht des sehr frühen Morgens, die schemenhaft wabernde Gestalt eines hochgewachsenen Mannes. Im Augenblick, als ihre überreizten Sinne den Wächter wahrnahmen, ließ sie ihren überanstrengten Geist willenlos in die Abgründe des Schlafes sinken. Wer das Dunkel mit den Augen zu durchdringen vermochte, würde eine Gestalt, gewandet in einen weiten, altmodischen Mantel, gelehnt auf einen langen, mit Runen verzierten Speer wahrnehmen, die Wache neben der Schlummernden hielt. Kein Krieger würde das Wagnis auf sich nehmen, sie unter seinem Schutz beschleichen zu wollen ...
Ein zugleich feuriger und eisiger Schreck riss sie jäh aus dem Schlaf, als ihr brutal die Arme auf den Rücken gedreht wurden. Die Sonne stand zwar noch niedrig am östlichen Himmel, doch war ihr Licht bereits stark genug, die mühsam aufgebaute Illusion des Wächters in die Schatten der Nacht zurückzudrängen. Ein unartikulierter Schrei entrang sich ihrer Kehle. Nicht schon wieder! Jetzt war sie an der richtigen Adresse und dann passierte es ihr erneut. Sie hatte schlichtweg verschlafen und sich wie ein Karnickel in der Schlinge fangen lassen!
Auch die Waffen hatten sie ihr abgenommen. „Lass mich sofort los“, fauchte sie den blonden Hünen an, der sie, als sei sie nichts weiter als ein leichtes Netz voll erlegter Tauben, hochhob und über die Schulter warf, obwohl sie wie wild mit den Beinen strampelte. Ihre Hände waren schon wieder zusammengebunden. Schnell war ein Haufen von Kriegern zusammengelaufen und bildete ein gaffendes Menschenknäuel um den Wachtposten, der das schreiende zarte Wesen herbeitrug und abstellte wie ein Müller sein Getreide. Ihre Pobacken schmerzten heftig, als sie hart zu Boden fiel. Obwohl sie wegen des allgegenwärtigen Schmutzes, der übel verfilzten Haare und der eher praktisch ausgerichteten Kleidung wenig anziehend aussah, bekamen die Vandalen große Stielaugen. Seitdem die Vorbereitungen fürs Übersetzen angelaufen waren, lebten sie kaserniert, ihr Kontakt mit Frauen hatte sich darauf beschränkt, bei Gelegenheit vorüberkommenden Marktweibern und ihren Töchtern aus der Ferne nachzupfeifen.
Ein Tumult brach los. „Ich darf zuerst“, verkündete der Finder der Beute. „Das wäre ja noch schöner“, dröhnte eine stark basslastige Stimme aus dem Hintergrund, und eine untersetzte Gestalt, deren Gesicht von blondem Bart schier zugewachsen war, drängte sich nach vorne. „Ich bin hier der primus pilus, und“, er grinste breit, wobei er ein gelbes Pferdegebiss entblößte, „wie der Name schon sagt, der erste Speer darf zuerst!“ Sein Kontrahent gab sich jedoch noch nicht geschlagen und giftete zurück. Allerdings gingen die meisten Worte des Streites wegen des verwendeten Jargons am Ohr der Keltin vorbei. An und für sich war es ihr egal, welcher der Kontrahenten sich des Siegerrechtes bedienen würde. Immer war es dasselbe, wenn sie allein auf Krieger traf. Sie war Beute, nichts mehr. Ihre Wut hielt ihre Angst jedoch in Grenzen. Wie konnte sie sich nur so kurz vor dem Ziel noch fangen lassen!
Die beiden Rivalen waren inzwischen zu Tätlichkeiten übergegangen. Der Zenturio packte den Wachsoldaten und ließ ihn mit Hilfe eines gekonnten Wurfes, Gesicht voraus, in den Staub fallen. Gerade als er sich seiner redlich verdienten Beute zuwenden wollte, trieb ihn ein heftiger Tritt gegen das Hinterteil über sein Ziel hinaus – die Druidin drehte sich geschickt weg, und er wurde in den Haufen der umstehenden Männer katapultiert. Dröhnendes Gelächter umbrandete sie, die wie in einer Wolke saß und die Schmerzen in den Gliedern nicht mehr spürte. Die Szene war so ganz nach dem Geschmack der Soldaten. Zwei gestandene Mannsbilder rauften sich auf Teufel komm raus um eine gefangene Frau, die gebunden und hilflos zusehen musste. Wutschäumend drehte sich der Zenturio um und wollte gerade sein Schwert zücken, als in das Tohuwabohu plötzlich eine helle, jugendlich ungeschliffene Stimme drang. „Was ist denn hier los?“
Die Hand des Zenturios entfernte sich unauffällig vom Schwertknauf, um Staub von der Hose zu klopfen.
„Lasst mich mal durch!“ Bereitwillig bildeten die Schlachtenbummler eine Gasse, durch die eine der Frau wohlbekannte Gestalt herankam. Sie dankte der Göttin, auf die wohl doch Verlass war, denn es handelte sich um keinen anderen als jenen dunkelhaarigen Krieger, dem sie schon einmal ihre Rettung zu verdanken hatte.
Offensichtlich hatte er, seiner Jugend zu Trotz eine gewisse Autorität bei den Soldaten, denn das Geschrei verstummte augenblicklich und die beiden Kampfhähne zogen sich grummelnd zurück, ehe das erwartete Unwetter sich über ihnen entladen konnte. Wenige Augenblicke später stand auch der blonde Krieger neben seinem Freund. Sein Atem ging keuchend, er war wohl aus einer entfernteren Ecke des Lagers herbeigeeilt. Offensichtlich hatte er sich soeben die Haare gewaschen, denn er trug die langen Schläfenhaare zu einem wenig kunstvollen Knoten auf der Stirn zusammengeflochten. „Was haben wir denn da?“, wandte er sich an die Kauernde.
„Wen! Bitte!“, kam es bissig zurück, „auch wenn ich eine Frau bin, bin ich doch eine Person und keine Sache!“
Der Schwarzhaarige pfiff anerkennend durch die Zähne. Sie spricht gotisch. Phantastisch, endlich hier auf eine Frau zu treffen, mit der man auch reden kann, schien er damit sagen zu wollen. „Umso besser, wer bist du denn?“
„Man nennt mich Ceridwen. Ich komme von der fernen Insel Hibernia, wo ich Priesterin der Göttin bin, eine filid …“ Auf ihre verständnislosen Gesichter hin, ergänzte sie: „Die Römer nennen uns Druiden! Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Deshalb bitte ich um angemessene Behandlung. Bindet mich los und bringt mich zu eurem Kommandeur, vorher bin ich nicht bereit, weitere Mitteilungen zu machen!“
Ein Grinsen zog kurz das Gesicht des dunklen Kriegers, der sie eingehend musterte, in die Breite. Er wandte sich zu seinem triefenden Freund. „Hast du schon einmal daran gedacht, Truchthari, dass man den alten Spruch: ‚victrix causa diis placuit, sed victa Catoni‘ auch so übersetzen könnte, dass dem alten Bock Cato nicht die ‚besiegte Sache‘, sondern eben ‚die Besiegte‘, also eine durchaus weibliche Person, gefallen hätte?“ Beide blickten herab auf die schmutzige, gefesselte Druidin und lachten herzhaft.
Ceridwen senkte den Blick zu Boden, die Göttin schützt keine unwerten Männer, versuchte sie sich einzuhämmern, doch fiel es ihr immer schwerer, dieser Sentenz aus den Regeln Glauben zu schenken.
„Wer sagt mir, dass du nicht lügst und eine Spionin der Sueben bist?“, wollte der blonde Barbar, nun wieder ernst, wissen. Ruckartig fuhr ihr Kopf hoch, kalt blickte sie ihm in die Augen.
„Sueben?“ Sie spuckte aus, was ihr nicht leichtfiel, ihr Mund war völlig ausgetrocknet. „Diesem Pack bin ich gerade entkommen. Macht mich jetzt endlich los!“
„Binde sie los, in Gottes Namen“, beeilte sich Arwid einen Krieger anzuweisen. Die Vandalen schauten allesamt betreten zu Boden. Aus dem großen Spaß, den sie sich mit der Gefangenen erhofft hatten, würde also nichts werden. Den Spaß würden nun die Anführer haben. Wie immer, wenn man als gemeiner Krieger seine Schäfchen nicht sofort ins Trockene brachte, hatte man das Nachsehen.
Ceridwen erhob sich und klopfte umständlich ihre zerissenen Gewänder ab. „Gibt es hier bei euch ein Waschhaus? Ich will nicht so zerzaust und schmutzstarrend meine von den Göttern aufgetragene Mission erfüllen.“ Mit blitzblauen Augen blickte sie dem nassen Blondschopf ins Gesicht. Jegliche Anwandlung von Furcht oder Beklemmung war von ihr gewichen, nicht zuletzt die Gegenwart des dunklen Kriegers verlieh ihr eine gewisse Sicherheit. Mit unsicherer Geste wies Truchthari auf jenen Zeltbau, aus dem er gerade gekommen war.
„Im Übrigen hätte ich nichts dagegen, wenn ihr mir Kleider besorgen könntet, denn die Sueben haben mir alles abgenommen, als sie mich abfingen. Morrigan, hierher“, pfiff sie die Dohle zu sich. Gemeinsam verschwanden sie im Zelt.
Truchthari schluckte. Wo sollten sie hier, in einem Lager der Nachhut, wo nur Soldaten hausten, Frauenkleider auftreiben?
Nachdem sich Ceridwen gründlich gewaschen und auch ihre Haare mühsam entwirrt hatte, erschien sie im vollen Glanz ihrer natürlichen Schönheit vor den Kriegern. Ein römisches Untergewand, das durchgeschnitten und zu einem reichlich knielangen Wickelrock umfunktioniert worden war, hatte sie mit einer ärmellosen Tunika kombiniert, alles in allem eine Tracht, die ihre weiblichen Formen aufs Deutlichste zur Geltung brachte. Ein Anblick, der die Stielaugen der Vandalen nur verlängerte. Doch die gefangene Druidin schritt, ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen, selbstbewusst durch das Spalier der Soldaten zurück zu den Anführern. Arwid und Truchthari hielten die Luft an. So eine Frau hatten sie noch nie gesehen, sie wechselten einen kurzen, allessagenden Blick: Nicht irritieren lassen!
Ceridwen, die sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst war, warf den Kopf in den Nacken, um sich ein paar Locken ihrer noch nicht ganz trockenen Mähne aus dem Gesicht zu schütteln. Ihre meerblauen Augen fixierten den Blick des grünäugigen, dunklen Offiziers, bohrten sich förmlich in sein Inneres. Er begann unwillkürlich heftig zu schwitzen und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Es blieb ihm nur mehr die Flucht ins Formelle.
„Darf ich dich in mein Zelt einladen, wo wir alles ungestört besprechen können?“
Die umstehenden Krieger murrten. Arwid sah Truchthari an. „Du und Balamber, ihr kommt mit“, ordnete er an. „Es wird keine Geheimnisse geben“, wandte er sich im Gehen an die Soldaten.
Die Gruppe ging gemessenen Schrittes entlang der Via regia zum Zelt des Kommandanten. Die Vorhänge am Eingang wurden zurückgeschlagen, so dass Einblick ins Zeltinnere gegeben war. Allerdings würden die Krieger der Unterredung nicht folgen können, da es grundsätzlich nicht erlaubt war, auf Hörweite heranzukommen. Doch den Anblick der geheimnisvollen Botin wollte sich keiner entgehen lassen. Die allernächste Zukunft würde wohl eine große Schlacht bereithalten, wurde allenthalben schon gemunkelt, machte doch das Gerücht die Runde, im Dämmerlicht der Morgenstunden hätte sich die unverwechselbare Gestalt des Schlachtenlenkers Wotan gezeigt.
Arwid ließ sich in einem Scherenstuhl neben dem aufgebockten Kartentisch nieder. Das Zelt hatte nur wenig Barbarisches an sich und orientierte sich, wie die ganze Lagerordnung, am römischen Vorbild. Zwar war dieses Idealbild des Militärlagers nicht ganz umzusetzen gewesen, da die Gefolgschaftsherren von ihren Kriegern umlagert werden wollten, wie es dem Herkommen entsprach. Dennoch waren die Kompetenz- und Hierarchieverhältnisse der Streitkräfte nach römischer Art gegliedert, was die Schlagkraft des Heeres erheblich gesteigert hatte. In diesem so römisch anmutenden Zelt fiel lediglich die Ausrüstung der drei Vandalen aus dem Rahmen, denn sie waren nach germanischer Sitte gekleidet und mit entsprechenden kleinen Repräsentationswaffen versehen. Um den kriegerischen Anlass des Treffens zu betonen, hatte sogar die ansonsten schmucklose Keltin das erbeutete Kurzschwert zurückerhalten und in ihren Gürtel gesteckt. Ihr wurde der Platz gegenüber dem Kommandeur zugewiesen, Truchthari und Balamber, der Schattenspender des Vandalenprinzen, flankierten die beiden. „Nun hast du Kunde erhalten, wer ich bin, doch ist mir noch immer nicht bekannt, wen ich vor mir habe“, sagte die keltische Druidin rundheraus. Der verdutzte Arwid faltete seine langfingrigen Hände und stellte sich knapp als Legaten und Königssohn vor. Auch er ging sofort in medias res. „Du nanntest dich eine Botschafterin der Götter, was hast du uns zu bringen?“
„Nichts Geringeres als die Rettung deines Volkes! Der Suebenprinz Hermigar will euch überfallen und vernichten, wenn ihr am Übersetzen nach Africa seid.“
Sie ließ die Worte verhallen und beobachtete die Mimik der Vandalen. Während Truchthari ungläubig grinste und Balamber so tat, als habe er nicht recht verstanden, zeigte Arwid keinerlei Reaktion. „Nun, das überrascht mich nicht sonderlich“, konterte er, „wir haben ihn bereits ausspionieren wollen, doch sind unsere Späher nicht wiedergekehrt, wir erwarten sie jede Stunde.“
„Da könnt ihr lange warten! Ein kleines Detachement der Sueben hat sie aufgegriffen, ich wurde während meiner Flucht aus dem Lager Zeugin ihres Todes. Ich will nicht viele Worte machen, wo Taten notwendig sind. Eure Feinde stehen in großer Zahl in einer einzigen Bereitstellung, denn sie wollen erst angreifen, wenn das Gros eurer Truppen übergesetzt hat, um den Tross und die Nichtkombattanten auszuplündern.“
„Das sieht Hermerich, diesem Schweinehund ähnlich!“, entfuhr es Arwid. „Warum aber willst ausgerechnet du, eine Priesterin eines Glaubens, dem wir allesamt nicht anhängen, unser Volk retten? Ist eure Religion derart auf Nächstenliebe ausgerichtet, dass eure Götter Botinnen zu allen gefährdeten Kriegsheeren der Welt schicken, um sie vor dem Untergang zu bewahren?“
Arwid fixierte die Schöne und versuchte, sich nicht von ihrem Äußeren beeinflussen zu lassen, denn er begann zu spüren, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als dass er ihr vertrauen dürfte. Doch er schüttelte den Kopf. „Nein, Hermerich schickt eine Agentin, deren Zauber alle erliegen, weil man nicht anders kann, als ihr zu glauben, da man einem derart charmanten Wesen einfach nicht misstrauen kann, und baut damit eine Falle auf, in der sich der nicht mehr ganz ahnungslose Feind trotzdem fängt. Ich zweifle an der Wahrheit deiner Worte, Keltin.“
„Das verwundert mich nicht! Unsere Götter sind alles andere als reine Menschenfreunde, wir opfern ihnen auch Menschen, um uns ihrer Gunst zu versichern. Und doch wissen wir, dass unsere Götter auf uns angewiesen sind, und uns, ihr Volk, retten wollen. Wir haben einen Spruch erhalten, der uns vor dem eigenen Untergang warnt:
‚Männer aus dem Norden, stark im Eisen, werden herfallen über die grünende Eiriu, werden ihre Viehherden verheeren, ihre Frauen schänden und die Männer Mils töten. Städte werden sie errichten, um das Land zu beherrschen, Kreuz und Hammer werden regieren, brennen werden die Dörfer und hadern die Menschen untereinander.‘
Caffah, unser Meister, ist von den Göttern durch Träume wachgerüttelt worden, er ist überzeugt, dass die Stunde der äußersten Gefahr unmittelbar bevorsteht“, fuhr sie fort. „Ihr müsst wissen, dass ihr, euer Volk, im Plan der Götter eine große Rolle spielt. Sehr im Verborgenen könnt ihr den Männern Mils helfen, wie sie euch, durch mich weniger verborgen Hilfe gewähren werden. Ich werde mich zu euch gesellen und euch meine Kräfte zur Verfügung stellen, wo immer es notwendig sein wird.“
„Schön gesprochen“, meckerte Truchthari in seiner kratzigen Stimme, „auf eine wackere Kriegerin wie dich haben wir natürlich gewartet, dass du uns hier heraushauen wirst, mit deinem Kurzschwert und deinem komischen Vogel ...“
Ein flammender Blick der Keltin brachte ihn zum Schweigen, er fühlte sich plötzlich nicht ganz wohl mit seinem Spott. „Du wirst verstehen, dass wir, wie Arwid eben schon sagte, dir nicht so ohne Weiteres glauben können“, milderte er seine Aussage ab.
Ceridwen sah ihn nur umso durchdringender an. „Erlaube mir kurz in deine Seele einzudringen“, forderte sie.
Truchthari war natürlich nicht bereit, dies zuzulassen: „Am Ende verhext du mich noch, und ich kenne mich nachher nicht wieder, kommt nicht in Frage“, lehnte er kategorisch ab und wandte sich hilfesuchend an Arwid.
„Tu’s für König, Volk und neue Heimat“, meinte der nur jovial und grinste. Derartige Sprüche kannte Truchthari noch von früher, aus seiner besten Zeit als Herzensbrecher in ganz anderen Zusammenhängen, doch zuletzt gab er, das Gesicht reine Skepsis, nach.
„Ich verspreche dir, dass dies keinerlei Spuren hinterlassen wird, ich will dir nur ein paar Wahrheiten über dich erzählen, die euch beweisen, dass ich übernatürliche Fähigkeiten habe und imstande bin, euch wirkungsvoll zu helfen.“
Ceridwen versetzte sich unnötigerweise in Trance, denn alles, was sie hier aufführte, war der reine Bluff. „Ich sehe durch deine Augen.“ Sie machte eine Kunstpause. „Als Junger sahst du sehr gut, jetzt bist du“, sie schätzte sein Alter, „zwischen 22 und 24 Jahre alt“, da über Truchtharis Geburt wenig bekannt war, konnte er selbst nicht genau sagen, wie alt er nun sei, ihre Aussage entsprach also seinem persönlichen Blickwinkel und war gut getroffen, „vor Kurzem wurdest du daran gehindert, einen schwarzen Vogel abzuschießen. Du bist die rechte Hand des Legaten“, sie wies auf Arwid, „und ihm schicksalsmäßig verbunden, denn auch du trägst das Zeichen der Göttin auf der Stirn. Ich glaube, das genügt, ich will hier keine Intimitäten ausplaudern.“
Truchthari war beeindruckt, ebenso Arwid. Beide versicherten dem ungläubigen Balamber, dass es sich so zugetragen hatte, dass sie vorgestern bei einem Streifzug eine Begegnung mit einer Krähe oder Dohle hatten, die beinahe letal für das Tier ausgegangen wäre, da sie unnatürlich lange sitzen geblieben sei, als sie sich ihr genähert hätten. Doch mit einem Blick auf die Dohle zu Füßen der Zauberin Betrug witternd, wollte Truchthari sich mit dem bisher Gesagten nicht völlig zufrieden geben. Er verschränkte die Arme vor der Brust. „Welche Art Zeichen meinst du?“
„Du, wie dein Freund, ihr beide seid von der Göttin ausgezeichnet. Ihr tragt ihr Schutzzeichen auf der Stirn und seid also in die Pläne der Götter einbezogen, anscheinend ohne es zu wissen oder dafür vorbereitet zu sein.“
Truchthari entsann sich seines Haarknotens. Sie konnte also kein sichtbares Zeichen auf seiner Stirn meinen, es war also, versetzt mit einigen Wahrheiten, doch nur Dichtung, was sie da vorbrachte. Er grinste breit und frech. „Du meinst also eine Art Zeichen, das nur speziellen Menschen wie dir zugänglich ist, einen Hokuspokus, dessen Wahrnehmung nur bestimmten Priestern vorbehalten bleibt, nicht wahr?“
„So habe ich mir deine Reaktion vorgestellt.“ Ihr Lächeln war zwischen Verführung und der Überheblichkeit derer, die etwas besser wissen, angesiedelt. „Nein, das Zeichen kann jeder sehen, der will. Hättest du also die Güte, deinen Haarknoten zu lösen?“
Truchtharis Neugierde erwachte.
„Schau dir zuerst deinen Freund Arwid an. Eine einzige dicke, blaue Ader zieht zur Nase, doch vom Haaransatz her laufen drei feinere Äste, die diese Ader speisen. Bei ihm sind sie schwerer einzusehen als bei dir, der du genau dasselbe Zeichen trägst. Mit dieser Vierheit schützt dich die Göttin. Man kann es nicht immer sehen, aber wenn du dich kurz bückst, wird es sich offenbaren.“
Truchthari, dessen Eitelkeit ihm schon diverse Stunden physiognomischer Betrachtungen seines Konterfeis beschert hatte, war überrascht. Sollte es da ein Detail geben, dem er zu wenig, besser gesagt, überhaupt keine Aufmerksamkeit gewidmet hätte? Auch an Arwid war ihm das gerade beschriebene Indiz göttlichen Schutzes noch nie aufgefallen. So genau also siehst du dich an, dachte er bei sich und warf einen verstohlenen Blick auf Arwids Stirn. Tatsächlich konnte man da, wenn man nur darauf achtete, diese seltsame Zeichnung der Blutwege, die in etwa der „Ma“-Rune entsprach, ausmachen. Und Gott machte ein Zeichen an Kain und seinen Nachkommen, dass sie nicht Schaden nähmen oder so ähnlich, spannen sich seine Gedanken weiter.
„Nun, was ist“, wurde er von Arwids Stimme aus seinen Tagträumen gerissen, „willst du dem Ansuchen der domina nachkommen, oder bist du tatsächlich zu eitel, deinen nach oben gerutschten Haaransatz in ihrer Anwesenheit entblößen zu wollen?“
Verwirrt und gehorsam löste er mit fahrigen Bewegungen seinen Haarknoten, bückte sich für ein paar Sekunden, und schnell wurde das besagte Zeichen erkennbar, wie er der Reaktion der anderen entnehmen konnte. Nein, nie hatte er darauf geachtet, doch erschien es ihm einleuchtend, dass man darin das Schutzzeichen einer weiblichen Gottheit sehen mochte, schließlich stand die Rune „Ma“ für „Mutter“.
„Ihr beiden solltet euch an der Religion der Mutter ausrichten, ihr hättet mehr vom Leben“, belehrte Ceridwen die verblüfften Freunde.
„Ich hoffe, du bist nicht gekommen, uns eine neue Religion zu bringen“, verteidigte Truchthari seine Glaubensrudimente gegen neue spekulative Ungewissheiten, „wir Arianer haben nämlich mit der alten schon genügend Schwierigkeiten. Aber auch unser Gott machte Menschen, die ihm besonders wertvoll erschienen, ein Zeichen an der Stirn, damit sie nicht von anderen getötet würden, dazu brauchen wir nicht extra eine neue Göttin! An Arwid solltest du dich schon gar nicht versuchen, der ist Pythagoreer, den kannst du nicht mit einer Untergottheit abspeisen, er dient nur dem allerhöchsten Prinzip der Harmonie.“
Der so Charakterisierte wischte die Debatte mit einer Handbewegung beiseite.
„Nun, Ceridwen, du gabst vor, uns retten zu wollen. Beweise es und verrate uns etwas über die suebischen Bereitstellungen!“
„Ihr vertraut mir also?“
Beide Freunde nickten, auch Balamber schloss sich der allgemeinen Zustimmung an. Den Zauber mit den Zeichen auf der Stirn konnte er sich überhaupt nicht erklären. Die Frau war also eine Hexe, so viel stand fest. Es fragte sich nur, für wen sie hexen würde, für die Vandalen oder für die Sueben. Er seufzte. Man würde sich einfach auf seinen und seiner Männer starken Arm verlassen müssen, wenn es zur Schlacht kommen würde. Dann würde man den Sueben, ob mit oder ohne magische Unterstützung, schon zeigen, wo die Riesen die Stufen hinab zur eisigen grauen Hel in den Fels gemeißelt hatten.
Während Arwid auf ihren Bericht wartete, lehnte sich Ceridwen genüsslich zurück und streckte sich in sehr unkeuscher Manier. Der Prinz blickte befangen zur Seite, die beiden anderen bekamen glasige Augen, während die Keltin die Situation zu genießen schien und die Arme hinter dem Kopf verschränkte, immer noch ihre weibliche Pracht deutlich zum Ausdruck bringend. Gottlob saß sie mit dem Rücken zu der wartenden Schar der Krieger außerhalb des Zeltes. Herausfordernd leckte sie sich die Lippen. „Ich weiß, woran ihr drei jetzt denkt“, orakelte sie.
„Dazu gehören nun aber wirklich keine übernatürlichen Kräfte“, platzte Arwid verlegen lachend los.
„Aber keiner von euch könnte das, was er sich gerade ausmalt, durchführen, wenn ich es nicht ebenfalls wollte. Hermigar ist auch gescheitert an mir. Fünf Nächte lang musste ich sein Lager teilen, und er hat es kein einziges Mal geschafft! Ich habe ihm die Männlichkeit verzaubert, versteht ihr, es rührte sich nichts, und ich weiß nicht, ob sich jemals wieder etwas bei ihm rühren wird! Vielleicht habt ihr die Güte, diese Geschichte im Lager kursieren zu lassen, denn ich bin es Leid, dauernd die Annäherungsversuche irgendeiner Soldateska abzuwehren.“
Sie schlug die Beine wieder sittsam übereinander und richtete den Oberkörper auf. Das waren klare Worte. Betreten sahen sich die drei Vandalen nach irgendetwas Beschauenswertem in der Umgebung um. Nicht zuletzt um der Situation ihre Peinlichkeit zu nehmen, zog Ceridwen ihr Kurzschwert aus der Scheide und zeichnete damit Linien in den staubigen Boden des Zeltes.
„Hier ist euer Heer, hier die Guadiana, hier liegt Merida ...“
Eine halbe Stunde später jagten Meldereiter auf den besten Pferden, die sich im Lager fanden nach Tarifa, dem Haupthafen der Invasionsflotte, der nur wenige Meilen entfernt lag. Männer wie Rösser bedeckte eine Kruste aus Staub und Schweiß, als sie dort anlangten. Mit pfeifenden Lungen stürmten die Melder ins Zelt des Königs, der irritiert aufblickte, da er es nicht gewöhnt war, bei Besprechungen gestört zu werden. Doch der Anblick der ihm entgegenschwankenden, verdorrten Gestalten machte ihm die Dringlichkeit ihrer Nachricht überdeutlich bewusst. Was er da von den Boten seines Sohnes erfahren musste, überstieg seinen Erwartungshorizont bei Weitem. Hermerich sann also nicht auf einen kleinen Raid mit Beute und vielleicht etwas Landnahme als Ziel, der Suebenkönig wollte ihnen offensichtlich ernsthaft das Fell über die Ohren ziehen, das ganze Vandalenvolk versklaven. Warum sonst hätte er seinen Kronprinz Hermigar, den sturen Draufgänger, mit dem kompletten Heer ausgeschickt?
Geiserich war außer sich. Nach all den Jahren der intensiven Vorbereitung war endlich alles Nötige unternommen, um den Sprung in diese Welt jenseits des Meeres, die ihre Heimat werden sollte, zu wagen. Er hatte verschiedene Stützpunkte sowohl als Start- als auch als Zielhäfen ausgewählt, die nötigen Schiffe an der Meerenge zusammengezogen, wo nötig, Verhandlungen geführt – und das alles sollte nun umsonst gewesen sein? Sollte sein Traum vom Inselreich in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus? Diesen Traum wollte er verwirklicht sehen und kein Suebe sollte ihn daran hindern. „Sollen sie bekommen, wonach sie verlangen“, Geiserichs Faust fuhr krachend auf den Tisch herab, „wir werden sie zermalmen!“
Rasch wich die Wut, und mit kühlem Kopf überschlugen der König und sein Stab, wen man wo noch erreichen und mobilisieren könnte. Geiserich reagierte blitzschnell, war ihm doch klar, dass seine Chance in der überraschenden Prävention bestand. Meldereiter auf Meldereiter jagten aus dem Hauptquartier, die Truppen, die noch nicht übergesetzt waren, zu alarmieren. Die Fähraktion musste bis auf Weiteres unterbrochen und alle verfügbaren Krieger ins Hauptlager zurückkommandiert werden, um sich von dort in Eilmärschen in die nordwestlich gelegenen Macchien in Bewegung zu setzen.
Die mit Furcht erwartete Verwirrung bei den Kriegern blieb aus. Fluchend und schimpfend, aber diszipliniert ließen sie ihre Sippen zurück. Sie wussten, dass das Überleben ihrer Familien davon abhing, ob es ihnen gelang, die Sueben zurückzudrängen. Der Hass auf den Feind wuchs mit jeder Meile, die sie in der Dunkelheit gegen ihre ursprüngliche Zielrichtung marschieren mussten, und die Offiziere hofften dringlich, dass die Wut der Gemeinen nicht verraucht sein mochte, bevor man auf die Sueben stieß. Geiserich setzte auf die überlegene Kampfmoral derer, die alles, was ihnen lieb ist, verteidigen, auch gegen einen weit überlegenen Feind.
Drei Tage später standen sie bereit zur Schlacht. Schmerzlich fehlte dem König das Gros der alanischen Reiterei, die er als erste hatte übersetzen lassen, um über bewegliche Einheiten am anderen Ufer zu verfügen und eventuell heranrückende römische Verteidiger auszuspionieren. Erneut steigerte er sich hinein in Wut und Rachegelüste. Arwid war mit Truchthari und der Nachhut eingetroffen und besprach sich ein letztes Mal mit dem Vater. Von Balamber unterstützt, würde er den linken Flügel, der im Wald operieren würde, befehligen. Dort wo sie kämpfen würden, waren sie allein auf sich gestellt, ohne direkte Verbindung zum Zentrum.
„Ich werde sie in den Kessel hier treiben“, erläuterte Geiserich seinen Plan, „ihr müsst nur verhindern, dass sie den Wald als Fluchtrefugium nutzen, dann sind sie in der Ebene isoliert und wir werden sie gegen die östlichen Hänge drängen, wo es für sie kein Entrinnen geben wird. Wie besprochen wird nur jeder dritte Mann sichtbar aufgestellt, die anderen sollen sich in den Sträuchern tarnen, was ja nicht allzuschwer fallen wird“, der König blickte herausfordernd in die Runde. „Morgen werden wir das feige Suebenpack vom Erdboden tilgen.“
Arwid musterte besorgt die entgleisende Mimik des Königs. „Lass dich nicht hinreißen“, redete er beruhigend auf den schäumenden Oberfeldherrn ein, „der Engel der Rache ist ein schlechter Ratgeber.“
„Willst du mir etwa vorwerfen, mein Plan sei von Gefühlen bestimmt?“, versetzte der König streitlustig. „Ich bin neugierig, ich will dazulernen, klär mich doch bitte auf, gibt es eine bessere Strategie?“ In einer Situation wie dieser war er gefährlicher als ein Rudel ausgehungerter Wölfe. Sein blitzender Blick bohrte sich in die Augen seines Sohnes. Hier war wieder eine jener seltenen Gelegenheiten, in welchen Arwid sich gezwungen fühlte, in die Augen des Vaters zu blicken, in jene bannenden Augen, die sonst immer unter den vorspringenden Brauen so gut verborgen lagen. Nie hätte er in ihrem Grün eine derart schneidende Kälte vermutet. Ihn schauderte, doch hielt er dem Blick stand, auch er war erregt.
„Vater, hör mir bitte zu! Ich meine, du sollst dich nicht von deinem gerechten Zorn dazu hinreißen lassen, Werke der Unmenschlichkeit zu tun. Wir drängen die Sueben ab, kesseln sie ein und zwingen sie zum Frieden. Sobald sie begreifen, dass sie chancenlos sind, werden sie Emissäre mit ausgerissenen Grassoden schicken, und dann solltest du das Symbol der Kapitulation annehmen, statt sie zum Kampf bis zum letzten Mann zu reizen. Haben wir sie erst entwaffnet, dürften wir Ruhe haben vor diesen Störenfrieden.“
Der König sah Arwid herausfordernd an. Ein schiefes Lächeln verunzierte seine angespannte Mimik. „Wer ist jetzt hier gefühlsgelenkt? Du mit deiner Humanitätsduselei oder ich in meinem ‚gerechten Zorn‘, den du mir freundlicherweise zugestehst? Lass den Krieg nur meine Sorge sein! Was hier in der nächsten Zeit passiert, hängt einzig und allein von meiner Entscheidung ab. Und jetzt geh und sieh zu, dass du deinen Auftrag erfüllst!“
Arwid hob wie betend die Hände, die Handflächen vor seinem Körper dem Himmel zugewandt. Doch der aufgebrachte König bedachte seine hilflose Geste einzig mit einem hingespuckten „Geh!“ Resigniert zog sich der Prinz zurück. Während er die Gurte seines Pferdes ein letztes Mal völlig überflüssigerweise überprüfte, ging es ihm nochmals durch den Kopf: Wie gut, dass er damals die Adoption in den Status eines legitimen Sohnes verweigert hatte und sein eigener Herr geblieben war. Sicher war er stolz, der Sohn des gefürchteten Geiserich zu sein, doch weit mehr erfüllte ihn die Tatsache mit Stolz, dass er es gewagt hatte, sich ihm wohl als einziger Mensch in seinem Bannkreis widersetzt zu haben. Und doch war der Vater, aller Gereiztheit und verletzter Eitelkeit zu Trotz, ihm gegenüber nie wirklich hämisch oder destruktiv vorgegangen. Oft fragte Arwid sich, über welchen immensen Schatz innerer Kraft sein Vater wohl verfügen musste, wie er nur ohne sichtbare Zeichen von Anstrengung die ständigen Schmerzen in seinem Bein, die andere zermürbt hätten, unter Kontrolle halten konnte. Ihn selbst würde diese Anstrengung, jene nicht unbeträchtlichen Kräfte in Dauerspannung zu halten, überfordern. Manchmal auch befiel ihn ein heimliches Grauen und er fürchtete eine künftige Apokalypse mit ihm als Hauptdarsteller, die alles Bekannte übersteigen würde. Doch jetzt, an diesem Maientag des Jahres 429, würde er funktionieren, seinem Vater keinen Grund zur Kritik geben.
*
Mit Geschrei warf man sich den flüchtenden Sueben entgegen, die versuchten, sich in den Wald zu retten. Der Angriff Hermigars, den er aus der Überraschung heraus vorzutragen wähnte, war in den ersten Wellen bereits versandet und festgelaufen. Kopfloses Chaos begann sich auszubreiten, als seine Krieger bemerkten, dass sie in eine Falle getappt waren. Arwid ließ es sich nicht nehmen, in der ersten Reihe mitzufechten, neben seinem Freund Truchthari und dem primus pilus Balamber, der das Gröbste für ihn erledigen würde, wenn er in zu arge Bedrängnis geriet. Auch Ceridwen hatte sich nicht abhalten lassen, gegen ihre vormaligen Peiniger mitzukämpfen. Plötzlich jauchzte sie in einem infernalischen Schrei auf: „Hermigar!“
Sie wies auf einen stattlichen Recken, der sich auf seinem Schimmel den Weg durch die vandalischen Reihen erstritt. Er führte das Schwert wie ein alter, in unzähligen Gefechten erprobter Haudegen, sein Ross war dahingehend abgerichtet, dass es nach den Köpfen der Umstehenden auskeilte und auf diese Weise so manchen Krieger fällte.
Arwid und Truchthari sahen ihre Chance. Sie lösten sich aus der Schlachtreihe und sprangen auf ihre Rösser, die hinter der Kampflinie angepflockt auf ihren Einsatz warteten. Sofort folgte ihnen Ceridwen. „Der gehört mir und der Göttin!“, rief sie und als rachelüsterne Trias hefteten sie sich an die Fersen des Suebenprinzen, der bereits die vandalischen Linien im Walde durchbrochen hatte.
„Stell dich mir, ich schone dich!“, rief Arwid dem Fliehenden nach. Doch der kümmerte sich wenig um Versprechungen, die sich vielleicht nicht halten ließen, und gab seinem Schimmel die Sporen. Truchthari versuchte indes, ihm den Weg abzuschneiden, indem er in stumpfem Winkel zum Kurs des Sueben anritt, was dieser nach angemessener Zeit mit einem Haken quittierte, der die Verfolger aufsprengte, da Truchthari nun, wohl mit waghalsiger Geschwindigkeit, jedoch fatalerweise in die völlig falsche Richtung dahingaloppierte. Arwid und Ceridwen hatten einiges an Abstand gutgemacht, als der Suebe endlich den jenseitigen Waldrand erreichte. Es war nicht mehr allzuweit zur Guadiana, die durch das enge Tal brauste. Sie war wohl kein wilder Strom, aber doch ein Fluss, der mit beachtlicher Geschwindigkeit dahinschoss und seine Tücken haben mochte. Hermigar holte aus seinem Pferd die letzten Reserven heraus und jagte mit dem Mut der Verzweiflung auf das rettende Ufer des Flusses zu, dicht gefolgt von der uneinigen Allianz aus Arwid und Ceridwen, weiter hinten mühte sich Truchthari vergeblich ab, den Vorsprung der anderen noch wettzumachen.
Plötzlich riss der Suebenprinz sein Pferd überraschend herum, um ebenso plötzlich gegen seine Verfolger anzureiten. Er zückte einen Wurfspeer aus der ledernen Scheide und warf ihn mit der Schnelligkeit eines Fischspießers, der springende Äschen harpuniert, in Richtung Ceridwen. Ihr Reittier bäumte sich auf, blutiger Schaum stand vor seinem Maul, der Speer war ihm durch den Hals gefahren und hatte die Reiterin nur um eine Handbreit verfehlt. Ihr Pferd stürzte, sich schier überschlagend, mit einem herzzerreißenden Schrei zu Boden, so dass die Druidin nur durch eine kunstvolle Rolle über den weichen Waldboden ihren Hals retten konnte. Arwid stand nun allein dem flüchtigen Heerführer gegenüber.
„Ich will dich nicht töten!“, rief er. „Ich bin Arwid, König Geiserichs Sohn, du ergibst dich keinem minderen Söldner!“
Hermigar lachte wild, „Ich ergebe mich vor allem keinem Bastard!“, klang es von vorne und der Suebe sprengte erneut in die andere Richtung, dem Fluss entgegen, davon. Sein Angriff auf Ceridwen hatte deutlich gemacht, dass ihm die Keltin offensichtlich gefährlicher erschienen war, weshalb Arwid ein Gefühl von verletzter Eitelkeit beschlich. Was wollte dieses aufgeblasene Bürschchen eigentlich? Er war doch verloren, sah er das nicht ein?
Nun gut, wer sterben will, dem gib einen Dolch, hörte er sich, oder zumindest eine Stimme in sich, sagen. Er forderte nun seinerseits von seinem Reittier das Letzte und machte einiges an Distanz zu dem Flüchtigen wett. Doch verfehlte sein noch aus vollem Galopp geschleuderter Speer das Ziel um mehr als eine Pferdelänge und fuhr mit Wucht in den Boden. Hermigar hatte mittlerweile das Flussufer erreicht und saß ab. Er erwartete seinen Gegner in geduckter Haltung, die Beine breit gespreizt, mit dem Schild kunstgerecht die linke Seite deckend, das lange zweischneidige Schwert entblößt in der Rechten. Er glaubte offensichtlich gleich überritten zu werden.
Arwid jedoch vermied diese in seinen Augen unfaire Kampfesweise und saß seinerseits ab. Wenn schon gefochten werden musste, diktierte ihm seine Ehre, dann sollte das direkte Duell Mann gegen Mann entscheiden, wer am Leben bleiben dürfte. Der Suebe, der ahnte, dass er erneut ein Friedensangebot erhalten würde, ließ Arwid keine Zeit, um Luft zu holen, sondern sprang ihn sogleich wie eine Raubkatze an. Pfeifend fuhr seine Spatha auf Arwids Kopf herunter und nur mit Mühe konnte dieser der Wucht des Hiebes standhalten, indem er ihn mit dem rechterhand geführten Schild parierte, dessen eisenbeschlagenen Rand er gegen die Klinge des Prinzen brachte. Zu seinem Glück fiel dem Sueben nichts besseres ein, als dieses Manöver zu wiederholen, was den nun Vorgewarnten dazu bewog, dem Hieb entgegenzukommen und ihm den Schildrand eine Spur schräger zu präsentieren. Somit gelang es ihm, das Schwert seines Feindes einzuklemmen. Hermigars Spatha, die in Arwids Defensivwaffe eine tiefe Kerbe hinterlassen hatte, saß darin fest und ließ sich nicht ohne Weiteres daraus befreien, all sein Reißen und Rütteln half nichts. Auch bei dieser Aktion hielt er sich zu lange auf, so dass ihm die beißende Schärfe Astrapias durch Sehnen und Muskeln des Unterarmes schnitt, als ob ein gekochtes Stück Braten tranchiert werden sollte. Kraftlos erlahmte die Hand, ließ das Schwert fahren und sank, die Finger verkrümmt, nieder.
Es gelang Hermigar, der seine Schmerzen mit keinem Laut quittierte, mit der linken Hand das Kurzschwert aus der Scheide zu nesteln, den Schild hatte er fallen gelassen. Ein unheimliches Lachen machte sich auf seinem Gesicht breit, lautlos zunächst, doch anschwellend im Heulen, gellte es durch das Tal, so dass sich Arwids Nackenhaare aufstellten und ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief.
„Bastard ... Feigling ...!“, hörte er aus dem wirren Wust geringschätziger Vokabeln, mit dem ihn sein waidwunder Feind bedachte, heraus, „zu feige, einen Linkshänder zu töten!“
Arwids Schwerthand zuckte vor, doch ging der unbedachte, von der augenblicklichen Wut gelenkte Stoß ins Leere, ein weiterer glitt am Schuppenpanzer des Gegners ab. Schon in diesem Augenblick tat es Arwid leid, gegen diesen Mann zu fechten. Erneut rief er ihm zu, sich zu ergeben, was den Sueben jedoch nur umso mehr reizte. Mit einem Mal wandte sich der irrsinnig lachende Hermigar, Schaum vor dem Mund, wortlos von seinem Gegner ab, nahm ein paar Schritte Anlauf und sprang kopfüber in den Fluss, um nicht mehr aufzutauchen.
Arwid verspürte nur Mitleid mit seinem Kontrahenten. Er hoffte, er möge nicht ertrinken, hoffte er möge sich in die Freiheit retten, die ihm allerdings nur Schande einbringen würde, verwundet und geschlagen wie er war. Mit gemischten Gefühlen spähte er auf den Fluss hinaus, doch nirgends sah er den Blondschopf Hermigars hochkommen.
Sein Herz war nicht erfüllt von der Freude befriedigter Rache, sondern von Trauer. Hermigar war sein Feind, warum? Hätten sie nicht ebensogut Freunde sein können?
Truchthari kam angetrabt. Er hatte Ceridwen aufgelesen, die vom Sturz etwas benommen schien. Mit vereinten Kräften fingen sie den stolzen Schimmel des Sueben ein und machten sich sodann schweigend auf den Weg zurück zur Schlacht, deren vom Wald gedämpfter Lärm immer noch aus dem Hintergrund an ihre Ohren drang.
Arwid ließ den behelmten Kopf hängen, Ceridwen erholte sich langsam von ihrem Schrecken und Truchthari sah sich als zu spätgekommene Hilfstruppe. Er hätte darauf gebrannt, das blutige Haupt Hermigars seinem König zu überbringen. Arwid in seiner Unerfahrenheit hatte alles verpfuscht. Einen Mann wie diesen Hermigar fing man nicht! Man tötete ihn, und noch in fernen Zeiten würde man sich von den Barden in den vandalischen Hallen Africas dann die Lieder über diesen großen Kampf vorsingen lassen können. Doch für einen Sieg wie diesen, ohne wenigstens die Rüstung des Feindes erbeutet zu haben, würde niemand Arwid große Huldigungen entgegenbringen. Der Freund tat ihm leid ob seines Ungeschicks. „Und, wie fühlst du dich“, brach er endlich das ihm unerträgliche Schweigen, „nach deinem ersten Sieg?“
„Der Suebenprinz ist sicher tot“, quetschte Arwid hervor.
„Das ist allerdings das mindeste, was man erwarten darf nach seinem Abgang“, versuchte ihn Truchthari zu trösten, „solange hält es keiner unter Wasser aus: Er ist sicher hinüber, darauf kannst du dich verlassen, du hast ihn“, stotterte er mit einem Mal, „wenngleich eher indirekt ... aber dennoch ... sicher ist er wegen der fehlenden zweiten Hand ertrunken!“ Unbeholfen nickte er wiederholt mit dem helmbewehrten Kopf: „Ja ganz sicher! Nein, ich versteh das ja, dass du ihn lieber in ehrlichem Zweikampf mit einem gezielten Schwertstreich zu seinen Ahnen geschickt hättest, aber es ist nun einmal anders gekommen. Aber“, er legte tröstend seine Hand auf Arwids Ellenbogen, „selbstverständlich kannst du dir diesen Kampf als Sieg an die Brust heften.“
„Ich ... ich habe ihn getötet“, stierte ihn Arwid aus mattgrünen Augen an, „dabei hätten wir Freunde sein können! Verstehst du?“
„Bist du verrückt geworden?“ Truchthari prallte entrüstet zurück. „Er war ein Suebe und mit diesem stinkenden Rattenpack willst du dich anfreunden?“
Arwid schüttelte die Hand des Freundes ab. „Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich es hasse, wenn Gewalt mit Gewalt vergolten wird, wenn gekämpft, getötet“, er wies mit der behandschuhten Hand auf die Keltin, „vergewaltigt wird! Ich fühle mich schuldig am Tod dieses erfolgversprechenden jungen Kriegers, verstehst du das denn nicht?“
Doch Truchthari sah ihn nur unter zweifelnd zusammengezogenen Brauen an. Er fuhr sich mit der Linken unter der Nase hin und her, wie um störende Barthaare zu bändigen und schüttelte den Kopf.
„Wie fühltest du dich denn, als du deinen ersten sogenannten Feind ermordet hattest?“, wollte Arwid plötzlich wissen und fixierte Truchthari mit einem unangenehm bohrenden Blick.
„Ermordet!? Wenn ich das schon höre“, fauchte Truchthari ungehalten, „dieser ‚sogenannte‘ Feind wollte ans Leben des Königs, das zu verteidigen ich geschworen hatte, da gibt es doch keine Frage?“
„Eines Königs, dessen Leben, wenn du ehrlich bist, dich nicht so sehr in Sorge versetzte, wie du jetzt vorgibst“, stichelte Arwid, „schließlich war Gundarich damals meinem Vater doch nur im Wege. Ein antiquierter germanischer Rabauke mit Keule und Wolfsfell, der, je eher desto besser, abtreten sollte! Du brauchst mir nichts vormachen, Truchthari! Deine Treue galt immer nur meinem Vater, nie Gundarich! Wenn du damals bei Sevilla jemanden tötetest, dann nur im Affekt der Kampfeslust, was du nun als Heldentum verbrämst!“
Truchthari schielte zu der schwarzlockigen Keltin hinüber, die ihm, nach wie vor, nicht übel gefiel. „Aber Gundarich war damals schwer angeschlagen, als ich mit meinem Detachement anrückte“, verteidigte er sich, vorgeblich zu Arwid gewandt, „und da …“
„Ich wollte nicht den Hergang deiner Heldentat hören“, beharrte nun Arwid auf einer Abkürzung der wohlbekannten Geschichte vom langen Einzelkampf gegen den abgesessenen Panzerreiter. Jene Geschichte vom flinken Helden Truchthari, der dem grobschlächtigen Franken den tödlichen Speer zwischen Kinnriemen und Brustharnisch in die Kehle gerammt hatte und dadurch den schönen eisernen Spangenhelm mit dem angenieteten Nackenschutz, der jetzt sein Haupt zierte, erbeutet hatte. Den Helm hatte er letztendlich sage und schreibe dreimal umarbeiten lassen müssen, bis er endlich auf seinen kleinen Kopf gepasst hatte. „Ich wollte wissen, wie du dich dabei fühltest!“
„Großartig natürlich“, versetzte der Freund eine Spur zu reflexhaft, als dass man ihm hätte Glauben schenken dürfen, „es war die Erfüllung des Kriegerlebens, das Resultat aus literweise vergossenem Schweiß und schmerzenden Schwertschwielen von den stundenlangen Einzelkampfübungen und dem Exerzieren in der Phalanx. Wenn du dann plötzlich spürst, dass du mit Hilfe irgendeines Kunstgriffes die Oberhand gewonnen hast“, schwadronierte er ungehemmt dahin, „und der andere mit allem, was er tut, zu langsam sein wird, sein erbärmliches Leben zu retten, das ist ein Augenblick, der Flügel verleiht. Und diesen Augenblick musst du ausnutzen. Wenn du dich dann antöten lässt und zögerst, bist du dran!“
Arwids nach Wahrheit forschender Blick vermochte, vor allem angesichts der neben ihnen reitenden exotischen, blutrünstigen Kriegerin, nicht den von Trotz gefärbten Stolz in den Augen Truchtharis zu durchdringen. „Ich hätte mich eher, wie du es nennst, antöten lassen, anstatt zu töten! Gegenwärtig jedenfalls, fühle ich mich erbärmlich“, versetzte er.
Als sie wieder in den Wald eintauchten, wollte Ceridwen unbedingt noch einmal zum Lager der Sueben reiten, in dem man sie eingesperrt gehalten hatte.
„Ich wäre sehr glücklich, wenn ich meine eigenen Kleider wieder bekäme und meine Waffen und Kräuter“, erklärte sie den Freunden.
Arwid blickte despektierlich auf die kleine Druidin herab. „Um der Dame ihr Puderköfferchen zurückzuholen, werden wir jetzt zu dritt das Lager stürmen und alle darin kurz und klein schlagen, hast du dir das so vorgestellt?“
Außer einem verschmitzten Lächeln, das von hilflos hochgezogenen Schultern verstärkt wurde, erhielt er keine Antwort. Die Wirkung dieses Lächelns auf seine Emotionen musste er schnellstens lernen zu überwinden, sagte er sich im Geiste, sonst würde er bald als zuckendes, blutüberströmtes Opfer der Druidin im Kessel ihres männermordenden Kultes versinken.
„Also gut“, meinte Arwid errötend, aber überzeugt, das taktisch Richtige zu tun, „wir sollten den Sueben diese letzte Zufluchtstätte wegnehmen, so es denn leicht möglich ist.“
Ceridwen ritt nahe an ihn heran, so nah, dass sie ihre langen geheimnisvoll duftenden Locken mehr als rein zufällig vor seinem Gesicht wehen lassen konnte, was ihn über das durch die Sichteinschränkung übliche Maß hinaus verwirrte. Truchthari überholte ihn, blieb jedoch hinter der Keltin und verdrehte, nur für den Freund sichtbar, die Augen nach oben, als suchte er unter seinem Helmrand nach dem Beistand irgendwelcher Liebesgottheiten. Ihren Pferden die Sporen gebend, verließen sie den Ort des Geschehens in Richtung Truppe, wo sie der über ihr unversehrtes Erscheinen sichtlich erleichterte Balamber empfing. Es gelang ihnen dann auch tatsächlich mit nur geringer Verstärkung aus den Reihen der taktischen Reserve das kleine suebische Lager zu erobern, denn es waren nur wenige Krieger zur Bedeckung zurückgeblieben, die sie rasch aufrieben.
Das Lager war auf den Überresten einer schon seit längerer Zeit verwaisten villa rustica angelegt worden, deren Terrain wohl vor Menschengedenken mit viel Mühe und Plackerei dem Urwald abgetrotzt und wesentlich schneller von der üppigen Vegetation zurückerobert worden war. Mit einem ersten forschenden Blick in die Runde entdeckte Balamber sogleich die Leichen der vandalischen Späher, die in einer Ecke des Lagers achtlos auf einen Haufen geworfen worden waren. Man las sie auf und verbrachte die steifen, verrenkten Gestalten auf eine Pritsche, die von zwei Pferden zum Lager gezogen werden sollte. Gerade als sie anfingen, mit aus den Wachfeuern entzündeten Fackeln das Lager mit seinen Zelten und den improvisierten Stallungen anzustecken, ertönten markerschütternde Schreie aus einem der Verschläge. Truchthari sah Ceridwen misstrauisch an. „Sagtest du nicht, du wärest die einzige Gefangene hier gewesen?“
Ceridwen zuckte die Achseln. „Schaut ihr mal, wer da so lamentiert, ich suche inzwischen mein Bündel?“
Die Hilfeschreie kamen von weiter hinten aus einer Einzelbox, die wohl ursprünglich für ein Reitpferd gedacht gewesen sein mochte.
Arwid, Balamber und Truchthari liefen hinüber und erblickten zwei mal vier Finger, lang und der Situation hohnsprechend recht gepflegt, die um die gut übermannshohe Oberkante der Boxentür gekrallt waren. Offensichtlich mühte sich ein darin eingesperrter Mensch mit Klimmzügen ab, auszubrechen, was durch die niedrige Decke des Gebäudes vereitelt wurde. „Lasst mich raus, befreit mich! Civis romanus sum!“, tönte es von innen, „der Kaiser in Rom wird es euch danken und reich vergelten!“
Die Freunde wechselten einen Blick; wer ist das heutzutage nicht, römischer Bürger?, wollte er wohl sagen.
„Mach den Verschlag auf“, ordnete Arwid an, und der vierschrötige Zenturio warf seine zweieinhalb Zentner Lebendgewicht sooft gegen die Tür, bis sie unter Knarren und Knacken seinem Impetus erlag. Gespannt blickten die Männer auf die freigewordene Türöffnung. Heraus trat würdevoll ein hochaufgeschossener Mann, wohl Anfang der Dreißiger, dem man sofort ansah, dass er Geschmack und Sinn für Ästhetik besaß, denn seine Kleidung war von der schlichten Eleganz, die von der „Hauptsache teuer und ausgefallen“-Fasson des reichen Durchschnittsrömers seiner Zeit deutlich abwich. Rasch verließen sie die Düsternis der Stallungen, bevor die Flammen aus den hölzernen Bauten aufloderten und diese rasch verzehrten. Versprengte Sueben würden hier nichts vorfinden, was ihnen hilfreich sein könnte.
„Ich bin euch sehr dankbar für meine Errettung“, verneigte sich der Römer vor seinen Befreiern, „gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin C. Severianus, nicht nur römischer Bürger, sondern waschechter, zumal altrömischer Einwohner der urbs, der Hauptstadt des Erdkreises.“
Mit nicht uninteressiertem Erstaunen beäugte er die dunkelhaarige Schönheit, die mit fröhlichem Lächeln, ein voluminöses Bündel unter dem Arm, die unvermeidliche Morrigan daneben herflatternd, heraneilte. Ceridwen blickte zum Stall hinüber und musste lachen. Ohne die Übrigen aufzuklären, wandte sie sich an den Römer: „Du scheinst ja ein Gesegneter der Götter zu sein, du also warst das arme Pony in der Box, das ich so schön gleichmäßig atmen hörte. Kann es sein, dass du es fertiggebracht hast, meinen Schreikrampf und meine Flucht hier aus dem Stall schlichtweg zu verschlafen?“
„Das ist gut möglich“, erwiderte er errötend, „meinen Schlaf scheint wirklich Morpheus persönlich zu bewachen.“ Seine Augen, im gedämpften Licht der Stallung hatten sie noch fast schwarz gewirkt, waren hell, das sorgfältig geschnittene, nicht einmal durch die Umstände der Gefangenschaft zu verwüstende sandfarbene Haar trug er in der Mitte gescheitelt. Ein paar helle Streifen auf seinen Unterarmen legten Zeugnis ab von gehabtem Reichtum, vermutlich in Gestalt von Silberarmbändern, die nun, nach der Schlacht, vielleicht erneut den Besitzer gewechselt haben mochten und wohl die Muskeln eines wackeren Vandalen umwanden.
„Angenehm, domina, Eure Bekanntschaft machen zu dürfen! Ihr seid wohl ebenfalls römischer Abstammung – wenngleich Eure Kleidung die Vermutung nahelegt, dass Ihr Euch ... nun, wie soll ich mich ausdrücken ... akklimatisiert habt.“
„Nicht jedes feurige Ross kommt aus der peträischen Provinz, Gaius ...“, klärte ihn Cerdiwen auf. Der Römer lächelte. Bedacht, nicht sofort als „lateinischer Weiberheld“ schief angesehen zu werden, wandte er sich mit bemühtem Interesse an Arwid.
„Ich nehme an, Ihr gehört dem Stamm der Vandalen an, jenen tapferen Kriegern, die sich anschicken, dem Reich die africanischen Provinzen zu entreißen?“
Truchthari, dem der Mann durchaus sympathisch war, wunderte sich über dessen geschnörkelte Sprache: So also drückte sich der vornehme Stadtrömer aus. Der Akzent, mit dem sein Gegenüber sprach, wollte ihm irgendwie nicht römisch vorkommen, doch kannte er zum Vergleich keinen Stadtrömer persönlich. Nein, aller Sympathie zum Trotz blieb er misstrauisch.
„An ein Entreißen denkt hier niemand. Wir werden als römische Untertanen dort siedeln“, stellte Arwid klar. „Aber das ist jetzt nicht das Thema, vielmehr würde mich interessieren, was du hier treibst.“
„Ich bin Geograph und dabei, das westliche Reich zu bereisen, um alles aufzuschreiben, was mir an Bemerkenswertem unterkommt.“
„Aha, so etwas wie ein moderner Herodot?“
Truchthari mischte sich ein: „Aber du warst doch sicher nicht ganz auf dich gestellt, oder?“
Der Römer zog, fast unmerklich, eine Augenbraue hoch. Das mit dem Herodot schien ihm zu imponieren, wenngleich sich jener nicht gerade als Geograph in der zivilisierten Welt einen Namen gemacht hatte. Er entgegnete kein kritisches Wort, was jedoch reine Höflichkeit sein konnte, ebenso wie er sich, ganz Kavalier, den Gesprächspartnern jedes Wissen einfach zutrauend, nicht anerkennend über die Kenntnisse der antiken Literatur von Seiten des Barbaren äußerte.
„Selbstverständlich nicht“, sein Blick glitt prüfend über seine sorgfältig manikürten Hände, „doch töteten diese Barbaren hier meine Begleiter, ich selbst blieb nur mit knapper Not am Leben. Was jedoch das Schrecklichste an der ganzen Sache ist, die Sueben haben meine Schriftrollen als Fidibus verwendet – Papyrus brennt rasch, heiß und ansteckend. Derartigen Zunder hatten diese Wilden natürlich noch nie zu Gesicht bekommen. Alles über die Diözesen und Provinzen Obergermaniens, Galliens und die Iberische Halbinsel ist verloren. Aus dem Gedächtnis bringe ich es nicht mehr zusammen und zurückreisen erscheint mir bei der gegenwärtigen politischen Situation nicht angeraten.“
„Nein, damit ist es jetzt wohl vorbei – vorläufig“, verkündete Truchthari lakonisch und grinste Arwid an, „mein lieber C. Severianus. Wie Ihr Euch sicher erinnern könnt, habt Ihr ‚Dank und Vergeltsgott‘ durch den Kaiser angekündigt, was ich mir selbstverständlich nicht entgehen lasse. Betrachtet Euch, auch wenn es mir selbst schwerfällt, als meinen Gefangenen – und jetzt geht’s hier lang“, er deutete mit der Spatha auf den Pfad, der aus dem Lager hinaus in den Wald führte und sich dort rasch verlor.
Der Adamsapfel des Römers hüpfte. Das Gesicht reinste Entrüstung ließ er nach kurzem inneren Kampf resigniert die Arme hängen. „Barbaren“, murmelte er vor sich hin und mit Vergilscher Empörung ergab er sich in sein Schicksal. „Überall dasselbe: Auri sacra famis!“
Truchthari winkte zwei Gestalten, deren Statur nicht den Eindruck erweckte, als würden sie Fluchtversuche ihres Gefangenen lediglich mit „Haltet ihn!“ zu vereiteln versuchen, heran. „Gebt acht, dass er nicht fortläuft!“ Mit diesen Worten schwang er sich auf sein Pferd. Das Gespann mit den aufgetürmten Leichen der Gefallenen konnte nur mit viel Mühe durch den Wald gebracht werden, während die Reiter vorausstoben, um eventuell noch in die Schlacht eingreifen zu können. Dies erschien ihnen allerdings immer unwahrscheinlicher, je mehr sie sich dem Waldrand näherten, denn es erscholl kein Kampfgeschrei und keinerlei Lärm aufeinanderprallenden Eisens und stampfender Rösser war zu hören. Auf halbem Weg kam ihnen Reginbald entgegen, der sie sichtlich erleichtert willkommen hieß.
„Als ihr euch Hermigar an die Fersen geheftet habt, war die Schlacht schon so gut wie geschlagen. Die Sueben sammelten sich ein letztes Mal und griffen nach Art der Urväter in der Eberkopfformation an.“ Er platzierte das stumpfe Ende seines Speers auf dem Fußrücken und ließ den Schaft durch die hohle Hand nach oben gleiten, bis er nurmehr wenige Handbreit unten herausragte und fischte damit einen herrenlos auf einem Baumstumpf liegenden schönen Helm mit Halsberge zu sich herauf. Kennerisch klopfte er auf die angenieteten Spangen. „Das ideale Geschenk für meinen Halbfreien, Heimito, er hat sich heute ausgezeichnet geschlagen und verdient, als freier Mann angesprochen zu werden.“ Er strich sich den Bart. „Ach, Kinder, heute ist ein guter Tag, verdienten Männern die Freiheit zu schenken oder sie zu befördern“, sein breites, zufriedenes Lächeln ließ massive, gesunde Schneidezähne unter den Borsten des Oberlippenbartes sehen. „Gut, dass schon Geiserichs Vater, der gute alte Godegisil, Gott hab ihn selig, was die Schlachtaufstellung betrifft, bereit war, von den Römern zu lernen, und unser König seinerseits sich nicht zu blöd vorkam, diese Errungenschaften zu pflegen und weiterzuentwickeln. Wir ließen den Eberkopf dieser dummen Sueben anrennen mit Geheul und Gebrüll, Luren- und Flötengekreisch, und als sie nahe genug heran waren, dass sie ihren Sturmlauf nicht mehr hätten bremsen können, ließ Geiserich unsere dichten Reihen nach links und rechts auseinanderlaufen, so dass sich zwei taktische Dreiecke bildeten, zwischen denen die Sueben durchliefen. Bis sie gebremst hatten und recht wussten, was vorging, hatten wir sie in die Zange genommen und mit geringer Mühe aufgerieben.“
Die beiden Vandalen und die Keltin lachten über die Rückständigkeit der Feinde und waren neugierig, was der König ihnen zu erzählen hatte.
Bald stießen sie auf das Gros des Heeres. Eine seltsame unbewegte Stille lag über dem Ort. Schweigend sammelten sich die vandalischen Abteilungen und machten sich zum Abmarsch fertig. Den Freunden fiel sofort unangenehm die gedrückte Stimmung auf, die bei der Truppe herrschte. Im ersten Augenblick dachte Arwid, sein Vater sei in der Schlacht geblieben, doch er erspähte in der Entfernung seinen blauen Wimpel und die unverwechselbare Gestalt zu Pferd. Sie waren gerade rechtzeitig gekommen, um nicht Zeugen einer Tragödie riesigen Ausmaßes sein zu müssen, wenngleich ihnen der Anblick ihrer Spuren nicht erspart blieb.
Der Kupfergeruch des Blutes lastete über der tautriefenden Blumenwiese und nahm ihr jeden Zauber, den sie unter allen anderen Umständen auf die Reiter ausgeübt haben mochte. Sollten das die Felder der Seligen sein? Ein Gruß aus dem Jenseits, der Tod umrahmt von duftenden Blumen, wie bei einem Begräbnis? Arwid fröstelte. Die grünende, blühende Ebene war übersät mit Farbklecksen, die aus sicherer Entfernung noch auflockernd und belebend wirkten, um sich jedoch beim Näherkommen als grausige Zeugnisse menschlicher Abgründigkeit zu entpuppen. Hier an der Guadiana lag annähernd die Hälfte der suebischen Krieger enthauptet neben ihren bunten Waffenröcken, hingestreckt in den Feldern. Wer glücklich die Schlacht, in der die Vandalen wie Berserker gefochten hatten, überlebt und sich ihnen auf Gnade oder Ungnade ergeben hatte, war niedergemacht worden. Geiserich hatte ohne jegliches Ansehen der Person sämtliche Gefangenen über die Klinge springen lassen. Der König brach den Stab ein einziges Mal, für alle, die in seine Gewalt geraten waren. Flehentliches Bitten um Gnade, wie todesmutiger Trotz in den letzten Augenblicken wurden gleichermaßen mit einem raschen Schwertstreich bedacht. Es gab kein Entkommen für die entwaffneten Gefangenen.
Arwid befiel ein Würgereiz, dem er nur mit Mühe widerstehen konnte. Er versuchte krampfhaft seinen Geist von der lastenden Situation zu befreien und flüchtete sich in Etymologie. Diese Schlächterei nach dem Gefecht gab wohl ursprünglich dem Kampf den Namen „Schlacht“: Der Besiegte wurde als Opfer für mörderische Götter abgeschlachtet. Aber das mochte doch Jahrhunderte, wenn nicht länger, zurückliegen. Schließlich hatte man heutzutage Mittel, um derartige Exzesse, wenn sie schon unvermeidbar waren, wenigstens zu ritualisieren, zu entschärfen, so dass der Besiegte nicht völlig vernichtet wurde. Er konnte sich nicht lösen von dem grausigen Anblick, der sich ihm darbot. Die kopflosen Körper, verkrümmt und verrenkt, wie sie gefallen waren nach dem Streich des Henkers, daruntergemischt ihre mitunter noch behelmten Schädel, hingewürfelt und verstreut, düngten sie die friedliche Erde mit ihrem Blut. Wie achtlos zurückgelassene Gerätschaften, die niemandem mehr von Nutzen sein mochten, beschmutzt und besudelt, boten sie ein abstoßendes Bild.
Auch Truchthari, der schon bei Sevilla gekämpft hatte und einiges gewöhnt war, konnte die Augen nicht von den leeren, glasigen Blicken der Erschlagenen wenden. Wie ein Kind, das sich vom Anblick des grauenerregenden Albs nicht lösen kann, schielte er immer wieder nach den grässlich verzerrten körperlosen Gesichtern. Auch er war allmählich blass geworden, suchte den Blick Arwids, der ins Leere wandernd, nicht mehr wahrnehmen wollte, was sich ihm hier darbot. Ein mildes Lüftchen wirbelte den am Boden klebenden Metallgeruch des Blutes, das in Strömen vergossen worden war und das kurze Frühlingsgras mit einem glitschigschmierigen Film überzogen hatte, auf. Die beiden Freunde vermochten den verdoppelten Sinneseindrücken keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen und mussten sich übergeben, ehe sie absteigen hätten können.
Niemand kümmerte sich um ein ordentliches Begräbnis, ja, Geiserich war so weit gegangen, den Befehl auszugeben, die Leichen der Feinde nicht mehr anzurühren, sie nicht einmal zu verscharren. Klamm und übelriechend warteten die entseelten Körper als wohlfeile Beute für Bären, Wölfe, Füchse und Geier, die vom Leichengeruch angelockt herankommen würden, sobald sie sich ungestört wähnten. Schneller noch als diese Helfer der Hel würden sich ansässige Bauern und Landarbeiter über das Leichenfeld hermachen, auf der Suche nach Brauchbarem: Schuhe, Schmuck, Mäntel, Waffen und Münzen, die ja ihren Trägern nicht mehr von Nutzen sein konnten. Und natürlich die unvermeidlichen Talismane, wie Finger, Haare, Ohren eines Geköpften, mit deren Hilfe bei kundiger Anwendung kein Feind dem Malvolent standhalten und sich kein Frauenherz dem begehrlichen Werber verschließen konnte.
Nicht zuletzt, damit es zu keiner Inflation im Handel mit Objekten der schwarzen Magie in Baetica kommen sollte, vergruben die ersten, die sich mit diesen makaberen Hoffnungsträgern ihrer Begehrlichkeit ausrüsteten, die überschüssigen Schädel, bevor andere es ihnen gleichtun konnten. Eine Schar von unterweltlichen Dämonen, wenn nicht gar der Teufel selbst, so würde später erzählt werden, sei hier über eine marschierende Armee hergefallen und habe allen die Köpfe abgebissen. Auf diese Weise kamen wenigstens Teile der Sueben unter die Erde und wurden nicht, wie ihre sonstigen Überreste, Beute der Aasfresser.
Auf dem Weg zu den Häfen, wo die Einschiffung der Nichtkombattanten in der Zwischenzeit weitergegangen war, ritt Geiserich von der Spitze der Truppe nach hinten und gesellte sich zu Arwid und Truchthari. Sein Triumph war ebenso überwältigend wie nutzlos, was sich in seinem Gesicht deutlich widerspiegelte, das keine Spur von Freude oder Erleichterung über den Sieg aufwies. Verdrossen starrten die grünen Augen unter dem einfachen, schmucklosen Helm ins Leere. Arwid verspürte seinerseits nur wenig Lust, seinem Vater vom unseligen Ende des Suebenprinzen zu berichten. In erwartungsvollem Schweigen ritten sie nebeneinander her. Schließlich löste der König die Spannung.
„Ich habe einen großen Fehler gemacht“, begann er, „und ich schwöre mir selbst zu, nie wieder so zu handeln, wenn es um politische Entscheidungen geht. Ich wollte Hermerich ein für alle Mal zu verstehen geben, dass sein hinterhältiges Verhalten der übelste Ausbund an Ränke ist, den ich bisher erlebt habe, dabei habe ich mich hinreißen lassen, Niedertracht mit Niedertracht zu vergelten.“
Einen Augenblick lang glaubte Arwid, seinen Vater plagten Skrupel wegen der gemordeten Krieger, wegen der Tränen unzähliger Frauen und Kinder. Er spürte Mitgefühl in sich aufsteigen, ob der großen Verantwortung und Schuld, die der König auf sich geladen hatte. Doch rasch wurde er eines Besseren belehrt.
„Ich habe in einem Spiel mit vier Figuren eine völlig entfernt, was niemals nur für den von Vorteil ist, der diese Figur schlägt. Mit diesem Zug lade ich Theoderich ja geradezu ein, für seine Goten auch noch die Baetica zu erobern. Hermerich kann sich nicht mehr mit ihnen anlegen, geschwächt wie er ist – nun werden sie uns noch schneller im Nacken sitzen. Das hätte ich verhindern können und habe es nicht getan – nur um meiner Rache willen. Ich wollte im Blut der feigen Sueben waten.“
Betreten sah Arwid zu Boden, wobei sein Blick das Schuhwerk des Königs streifte und ihn von der Authentizität dieser Worte überzeugte. Nein, sein Vater war sein Mitgefühl nicht wert, der Schachspieler mit dem Leben von Tausenden auf dem Gewissen verdiente Verachtung – und dennoch konnte er ihn nicht als bodenlos böse abtun. Wie hätte er sich verhalten, wenn ihm die Entscheidung in dieser Stunde aufgezwungen worden wäre? Einen jungen Prinzen aus Edelmut laufen zu lassen war denn doch etwas anderes, als ein Heer, obzwar geschlagen, in unmittelbarer Nähe des Trosses, abziehen zu lassen.
„Ich schwöre euch, wenn ich je wieder im Spiel der Mächte so spielen werde, ist mein Kopf verwettet, denn dann steht fest, dass ich ein Narr bin.“
Arwid schwieg, abweisenden Gesichts, was Truchthari für sich mit: Ich hab es dir ja gleich gesagt übersetzte. „Mein König, so sei es“, überbrückte er das beredte Schweigen, das nun zwischen Vater und Sohn herrschte. „Wir hätten jetzt auch gar keine Zeit, um mühsam Verhandlungen in die Wege zu leiten. Hermerich hat seines Geschlechtes Grab eigenhändig mit Falschheit und Trug geschaufelt – mach dir keine Vorwürfe wegen der Sueben …“
„Truchthari, du redest, als ob du noch nie weiter als bis zur Nasenspitze gedacht hättest. Was schert mich das Wohlergehen der Sueben? Wir sind es, die einen Puffer hinter uns verlieren! Das ist der Grund, weshalb ich mich als Narren bezeichne …“
Arwid dachte noch immer darüber nach, wie er sich verhalten hätte, wäre die Verantwortung bei ihm gelegen, und immer deutlicher wuchs in ihm die Erkenntnis, dass sein eingeschlagener Weg außerhalb der königlichen Erblinie der Rechte war. Nur mit Hilfe der Geiserich eigenen Gefühllosigkeit konnten richtige Entscheidungen gefällt werden, nur in diesem kalten Klima gediehen Eigenschaften, die einen Menschen zum Staatsmann machten.
Und doch, er hatte von Eudaimon damals verlangt, Menschen aus ihnen zu machen. Bei ihm, Arwid, hatte der Pädagoge wohl das gesetzte Ziel erreicht – jedoch machte das aus ihm nicht automatisch einen Staatsmann. Heute beklagte sich der König, er habe sich von Gefühlen hinreißen lassen und eine nicht mehr gutzumachende Scharte, die auszuwetzen andere Generationen beschäftigen würde, geschlagen. Wie ihn, seinem Temperament gemäß, Wut, Zorn und Gewalttätigkeit überwältigen konnten, so würde Arwid dem Mitleid nachgeben, sich erweichen lassen und dadurch nicht Herr seiner Entscheidungen sein. Jene abgeklärte Gefühllosigkeit, die er am König noch über Jahrzehnte hinweg beobachten würde, deren Beurteilung ihm immer Schwierigkeiten bereiten würde, ihn hin- und herriss, zwischen Bewunderung und Abscheu, gerade diese Eigenschaft sollte er an sich selbst sein Leben lang nicht finden. Doch anscheinend war dies der Schlüssel zu politischem Erfolg und Weltruhm, den er in den Händen seines Vaters, trotz allem, gut aufgehoben wusste.