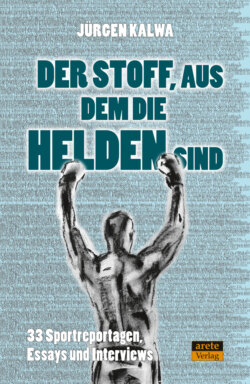Читать книгу Der Stoff, aus dem die Helden sind - Jürgen Kalwa - Страница 10
MIRACLE ON ICE
ОглавлениеDer Sieg der amerikanischen Eishockey-Amateure bei den Winterspielen von Lake Placid über die sowjetischen Favoriten gilt als der spektakulärste Außenseiter-Sieg aller Zeiten. Buzz Schneider war nicht nur dabei, sondern mittendrin.
22. Februar 1980. Ein Freitagabend in Lake Placid, einem kleinen Wintersportort auf halber Strecke zwischen New York und der kanadischen Grenze.
Das erste Eishockey-Spiel des Tages im ausverkauften Olympic Field House ist gerade zu Ende gegangen. Und die 8000 Zuschauer strömen aus der ausverkauften Halle in die Straßen des Dorfs.
Viele schreien begeistert, stakkatohaft immer nur dieselben drei Buchstaben: „USA! USA! USA!“.
In vorbeifahrenden Autos liegen die Fahrer auf der Hupe. Und von irgendwo schießt außerplanmäßig ein Feuerwerk in den Himmel, in dem dicke Wolken einen Tanz aus kleinen Schneeflocken entfacht haben.
Was macht man mit einem angebrochenen Abend wie diesem?
Buzz Schneider, Ken Morrow und Bobby Suter haben eine Idee: Sie wollen die ausgelassene Stimmung so intensiv wie möglich einatmen. Eine Atmosphäre, die kurz davor ist, eine ganze Nation zu elektrisieren.
Sie entscheiden sich für das Holiday Inn, aber drehen vorher ihre Trainingsjacken um, damit man sie nicht als Nationalspieler erkennt, und tauchen ein in die Menge im Hotel, die das Match, das soeben zu Ende gegangen ist, nun im Fernsehen sehen will.
Es ist keine Wiederholung. Zu den wunderlichen Dingen rund um diesen Abend zwei Tage vor dem Ende der dreizehnten Olympischen Winterspiele gehört, dass dieses Spiel in den Vereinigten Staaten nicht live, sondern zeitversetzt mit sage und schreibe drei Stunden Verspätung übertragen wird.
„Wir haben ein Bier getrunken und mitgejubelt. So wie jeder andere auch“, erinnert sich Schneider 40 Jahre später. Er hat im ersten Drittel das Tor zum 1:1-Ausgleich geschossen und kann nun diesen Augenblick quasi live noch einmal nacherleben. Die Entwicklung. Seinen Sturmlauf auf der linken Seite entlang der Bande. Die kurze, schnelle Ausholbewegung mit dem linken Arm. Und den gewaltigen Schuss aus fast 20 Metern in die linke, obere Ecke des sowjetischen Tores.
So atemlos klang das damals im amerikanischen Fernsehen: „Pavelich holt sich den Puck für die USA. Pavelich. Vorne ist Schneider. Schlagschuss. Er geht rein. Buzz Schneider. Die Vereinigten Staaten gleichen das Spiel nach 14 Minuten und drei Sekunden aus. Buzz Schneider, der einzige von ihnen, der ‚76 in Innsbruck dabei war. Was für ein Turnier für ihn. Das ist Buzz‘ fünftes Tor.“
Seitdem hat er die Szene zigmal gesehen. Aber für denjenigen, der sie nicht kennt, ruft er sie gern noch mal aus dem Gedächtnis ab: „Das hat mein Center Mark Pavelich eingefädelt. Er hatte den Puck und stürmte los, aber hat dabei alle nach rechts gezogen. Und dann hat er die Scheibe nach links gepasst.“
Schneider braucht nach so vielen Jahren für die Nacherzählung deutlich länger als die vier Sekunden, die damals zwischen dem Beginn des Angriffs und seinem wuchtigen Schuss vergehen. In seiner Rückbesinnung spielen auch Kleinigkeiten eine Rolle. Zum Beispiel, wie er Wladislaw Tretjak bezwang, den 1,85 Meter großen Major der Roten Armee, damals der beste Torwart der Welt.
„Ich war auf dem linken Flügel und habe ziemlich schnell abgezogen. Das hat Tretjak überrascht, der sich von einer Seite auf die andere bewegte. Ich wusste, dass ich den Puck gut getroffen hatte. Ich habe bewusst auf den oberen Teil des Tores gezielt. In die Ecke. Und so habe ich ihn kalt erwischt.“
Die drei Spieler bleiben allerdings nicht bis zum Schluss der Übertragung. Sie wissen, was passieren wird, sobald die Menge im Hotel nicht mehr gebannt auf den Fernsehschirm starrt, sondern auf sie. „Keiner von uns wollte, dass man herausfindet, wer wir sind.“
Es gibt für die drei keinen Grund, sich von der Stimmung mitreißen und womöglich einlullen zu lassen. Amerikas Eishockeynationalmannschaft hat zwar an diesem Abend Großartiges vollbracht, aber eigentlich noch nichts gewonnen. Erst zwei Tage später gegen Finnland geht es um den großen Preis: die Goldmedaille. Herb Brooks hämmert ihnen dies einen Tag nach dem Triumph noch einmal ein, wie Buzz Schneider sich erinnert.
„Nachdem wir die Russen geschlagen hatten, trafen am nächsten Tag Telegramme von überall her ein, und es wurden in der Umkleidekabine Schläger unterschrieben. Herb kam herein und fegte die Schläger vom Tisch. Er sagte: ‚Ihr Jungs habt noch nichts gewonnen.‘ Dann sind wir rausgegangen und haben trainiert. Wir hatten – einen Tag vor dem Spiel um die Goldmedaille – eine der härtesten Trainingseinheiten des Jahres. Er hat dafür gesorgt, dass unsere Köpfe nicht zu sehr anschwellen. Dafür, dass wir bei der Sache waren.“
Die Begegnung und die Goldmedaille gewinnen sie. Und das vor allem deshalb, weil sie einmal mehr, wenn auch relativ spät im Match, ihre überragende Kondition ausspielen und so den 4:2-Sieg sicherstellen.
Dass man vorher in mehreren Spielen immer wieder am Rand zu einer Niederlage steht, ist eine der nachdrücklichen Erfahrungen des Teams während des ganzen Turniers. Zum Beispiel zwei Tage vorher in der letzten Partie der Vorrunde unmittelbar vor der Auseinandersetzung mit den haushohen Favoriten aus der UdSSR. Gegen einen ziemlich eckigen Gegner namens West Germany liegt man nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück, weil Torwart Jim Craig gleich bei zwei Distanzschüssen zu spät reagiert. Derselbe Craig, der gegen die Sowjetunion wie eine Wand so gut wie alles abwehrt, was auf ihn zukommt. Was bitternötig ist. Denn die Angreifer der UdSSR dominieren. In der Statistik der Torschüsse sieht die Übermacht geradezu überwältigend aus: Die Sowjetunion verbucht 39. Die USA gerade mal 16.
Die Amerikaner kontern jedoch in den beiden restlichen Dritteln gegen die Bundesrepublik und gewinnen mit 4:2. Nicht genug für manche US-Experten, die auf einen höheren Erfolg gesetzt haben, mit dem sich das Team in der Vorrundentabelle vor die Schweden geschoben hätte und einen sofortigen Showdown mit den Sowjets vermieden.
Die amerikanischen Spieler finden solche Überlegungen unsinnig. „Worin besteht denn da der Unterschied?“ sagt Torwart Craig. „Wir müssen doch so oder so gegen sie spielen.“
Warum müssen sie das? Der internationale Eishockeyverband hat die Regeln über die Medaillenvergabe nach dem kuriosen Ausgang der Spiele von Innsbruck vier Jahre vorher verändert, bei denen die Bundesrepublik den USA die Bronzemedaille aufgrund der Berechnung eines ominösen Torquotienten weggeschnappt hat. So gibt es diesmal für die besten vier eine neuerliche Punkte-Runde mit zwei Spielen gegen die beiden Top-Teams der anderen Vorrundengruppe. Die Resultate aus den Vergleichen in der eigenen Gruppe – das Unentschieden zwischen den USA und Schweden und die 2:4-Niederlage der Finnen gegen die UdSSR – werden übernommen.
Aber zurück zu dem triumphalen Abend, bei dem das Fernsehen dem Spiel gleich auf zweierlei Weise einen besonderen Stellenwert verleiht. Es gehört zu dessen eigenwilligen Begleitumständen, wie der amerikanische Fernsehsender ABC mit dem Ereignis umgeht, dessen Kommentator Al Michaels das Spiel nach der Schlusssirene spontan zu einem Wunder hochstilisiert. Zum Miracle on Ice. Die Programmverantwortlichen haben vor dem Spiel den internationalen Eishockeyverband gedrängt, das Match in die zuschauerträchtigere Prime Time zu verschieben, aber sind auf taube Ohren gestoßen. So entscheiden sie sich kurzfristig für den Verzicht auf eine Live-Übertragung und verlegen die Ausstrahlung einfach nach hinten.
In anderen Ländern würde es als Affront eingestuft, einer ganzen Nation eine derartige künstliche Spannung aufzubürden. Doch im Kampf um Einschaltquoten scheint jedes Mittel recht. Chef-Ansager Jim McKay tut vor Beginn der Übertragung so, als sei es das Normalste von der Welt, dass der Sender den Menschen im Austragungsland der Olympischen Spiele eine solche Partie vorenthalten hat.
Es ist die Geburtsstunde dessen, was das amerikanische Sportfernsehen Jahre später im Rahmen der Berichterstattung von Olympischen Spielen immer wieder praktiziert und wird mit dem Begriff plausibly live belegt.48 „Die Ereignisse, die Sie heute Abend sehen werden, sind bereits vorbei. Möglicherweise kennen bereits mehrere Millionen das Resultat. Aber wir wollen es nicht verraten.“
Das Resultat ist das eine. Etwas ganz anderes ist die Art und Weise, wie es zustande kommt, als eine ziemlich unerfahrene Truppe mit jungen Collegespielern und lupenreinen Amateuren eine der besten Eishockeymannschaften aller Zeiten mit ihren eingespielten Berufsoffizieren bezwingt. Der Endstand: 4:3, ein knapper Sieg. Aber niemand wird nachher bestreiten, dass die Amerikaner verdient gewonnen haben. Nicht mal die Verlierer, die die Schmach, ihren Zorn und ihre Verwirrung herunterschlucken, als sie aus der Halle hinaus in die Winternacht treten.
Das Prickeln von damals ist verflogen. Dafür ist die Wertschätzung für die Akteure mit jedem Jahr ein Stückchen mehr gewachsen. Dieses eine Spiel gilt noch heute als Miracle on Ice, eine Bezeichnung, die auf den denkwürdigen Satz zurückgeht, den der Fernsehkommentator Al Michaels kurz vor der Schlusssirene in den Äther brüllt:
„Do you believe in miracles? Yes.“
„Glaubt ihr an Wunder? Ja.“
Michaels erinnert sich Jahre später in einem Video-Interview an diesen Moment, in dem er das Außerordentliche am Sieg der amerikanischen Außenseiter in einen Gedanken gießt, der das Spiel auf ewig im öffentlichen Bewusstsein verankert: „Die Zeile ‚Glaubst du an Wunder? Ja‘, ist einfach Teil meines Kommentars während der Übertragung. Ich habe deshalb Glück gehabt, dass die Leute bis heute darüber reden. Als der Film mit dem Titel Miracle gedreht wurde, haben mir die Leute gesagt, die ihn produziert haben: ‚Hey, wenn du nicht das sagst, was du damals gesagt hast, dann haben wir wahrscheinlich gar keinen Film.‘“
Diese auf den wenigen spontanen Worten eines Fernsehreporters basierende Wahrnehmung entspricht dem Platz, den das Ereignis seitdem im kollektiven Gedächtnis der Vereinigten Staaten einnimmt: Dies war nicht irgendein Eishockeyspiel. Es war das Äquivalent zu einer Schlacht in einem Krieg in einer Zeit des ständigen Säbelrasselns der beiden Atommächte. Wenn auch mit stumpfen Waffen auf einem ideologisch geprägtem Fundament. Eine Schlacht mit Eishockeyschlägern und Hartgummischeiben.
Von den beiden Gegnern hatte der eine – die Sowjetunion – kurz zuvor mit dem Einmarsch in Afghanistan gezeigt, wie man gegebenenfalls mit der Armee in einem Nachbarland einmarschiert. Während der andere – die Vereinigten Staaten – moralisch angeschlagen von einer anhaltenden Wirtschaftskrise, dem langen Echo auf das Fiasko des Vietnam-Kriegs und von der langen Geiselnahme amerikanischer Diplomaten im Iran dringend ein Anti-Depressivum mit durchschlagender Wirkung braucht.
Das Spiel wird so zum Symbol eines Wettstreits voller nationalistischer Gefühle, das die Menschen in Amerika dazu inspiriert, die jüngste Eishockey-Auswahl, die das Land je zu Olympischen Spielen geschickt hat, mit ungeheurer Ekstase und Schwärmerei aufzuladen. Ein Phänomen, das die Lake Placid News Jahre später so beschreibt: „Wir können gar nicht deutlich genug unterstreichen, wie dieses Miracle on Ice die Stimmung in Amerika veränderte. Das Wunder gab uns Hoffnung für die Zukunft. Es sorgte dafür, dass wir uns wieder besser fühlen – nach einem politisch und wirtschaftlich tristen Jahrzehnt.“
Nach dem Turnier lädt Präsident Jimmy Carter die Mannschaft nach Washington ein. Bis dahin hat keiner von ihnen eine Vorstellung davon, welche Bedeutung dieser Sieg für ihre Landsleute hat. Aber als sie im Bus auf der Fahrt vom Flughafen ins Weiße Haus erleben, wie die Menschen an den Straßen Spalier stehen und ihre Namen brüllen, sickert es allmählich ein.
„Ja“, sagt Buzz, damals einer der Leistungsträger und mit 25 der älteste im Kader. „Man hat uns immer wieder gesagt, was für ein positives Gefühl das für die Menschen war.“ Er macht eine Pause und fügt hinzu: „Aber wir haben das ebenfalls sehr genossen.“
Verständlich: Es ist ja zu allererst auch ihr ganz persönlicher Triumph. Zum Beispiel für David Christian, dessen Vater Bill und dessen Onkel Roger bei den Spielen 1960 in Squaw Valley ebenso überraschend die Goldmedaille gewonnen hatten und der 1980 seinen Teil zu einer erstaunlichen Eishockey-Dynastie beiträgt: insgesamt acht Assists verteilt über das gesamte Turnier von Lake Placid.
Ihr Trainer hatte den Erfolg von 1960 übrigens nur knapp verpasst. Er war als Stürmer Teil des Kaders. Bis er einen Tag vor dem Turnier als letzter aus dem Team gestrichen wurde. Erst bei Olympia in Innsbruck 1964 und in Grenoble 1968 kommt er zum Einsatz. In einem Dokumentarfilm des Fernsehsenders ESPN erinnert er sich später: „Als wir gewonnen hatten, schaute mein Vater rüber und sagte: ‚Sieht so aus, als hätte Coach Riley den richtigen Mann ausgewählt, oder?‘ Wahre Geschichte. Das hat mich genau zwischen den Augen getroffen.“ Die Medaille, die ihm so entgeht, sichert er sich 20 Jahre später auf eine andere Weise: in dem er die nächste Generation junger Spieler dazu bringt, ihr Bestes zu geben. Er ist genau der richtige Mann für diesen Job, den ihm der Eishockeyverband anvertraut.
Allerdings für den Rest des Landes bedeutet der Erfolg dann doch noch etwas mehr: Es ist „der großartigste Augenblick in der Geschichte des Sports des zwanzigsten Jahrhunderts“ – wie die amerikanische Zeitschrift Sports Illustrated ihn später nennt.
*
Ortstermin in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, im Herbst 2019. William Conrad Schneider, Spitzname Buzz, ist zum Interview gekommen und hat nicht nur ein paar alte Trikots und die Goldmedaille von Lake Placid mitgebracht, sondern auch seinen Sohn Billy. Der Senior, inzwischen 65 und im Rentenalter, stammt aus der Gegend und wurde nach dem Ende seiner Laufbahn Immobilienmakler. Billy, mittlerweile Ende 30, arbeitet für eine Biervertriebsfirma und ist ebenfalls in Minnesota geblieben, dem eishockeyverrücktesten Bundesstaat in den Vereinigten Staaten.
Dass sie beide erschienen sind, hat einen Grund: Sie verbindet nämlich mehr als nur eine klassische Ereigniskette aus der Biologie. Der Junior wollte einst sportlich in die Fußstapfen seines Vaters treten und hatte „den Traum, für die amerikanische Olympia-Auswahl zu spielen und eine Goldmedaille zu gewinnen“.
Daraus wurde nichts, weil er irgendwann verletzungsbedingt die Karriere beenden musste. Dafür gelang ihm etwas, was nur wenige Söhne hinbekommen: Billy Schneider schlüpfte vor etwas mehr als 15 Jahren in das Trikot seines Vaters mit der Nummer 25 und spielte in einem teuren Hollywood-Film, der den Triumph noch einmal leinwandgerecht und schön melodramatisch nacherzählt, niemand anderen als ihn.
Es gab auch eine deutsche Fassung, Miracle – Das Wunder von Lake Placid, die mit einem Trailer in die Kinos kam, der vor keinem Superlativ zurückschreckte: „Wenn man Unmögliches wagt, können Wunder geschehen.“
„Das war großartig. Es war wild“, sagt Billy, der diese Rolle erst am Ende eines langwierigen Casting-Verfahrens zugesprochen bekam. „Ich hatte viel Text, war oft zu sehen. Mein Vater hat bei den Olympischen Spielen viele Tore geschossen. Also musste ich auch viele Tore schießen.“
Klassische Schauspieler kamen für die Rolle der Aktiven nicht in Frage. Um glaubwürdig rüber zu kommen, werden gute Eishockey-Spieler benötigt, wie Billy sagt, der den Regisseur überzeugen konnte. Und zwar ganz ohne Einfluss seines Vaters: „Ja, es gab sogar Hockey-Probetraining. Dreimal. Ganz so, als ob man sich für eine reguläre Mannschaft bewerben würde. Und dann haben sie die Besten ausgewählt. Am Anfang ging es also einfach nur darum, ob du spielen kannst. Wer spielen kann und gut genug ist, der wird akzeptiert.“49
Für Buzz ist an dieser Geschichte noch heute eines besonders bemerkenswert: „Dass etwas, was wir 1980 getan haben, einen Einfluss darauf hatte, dass mein Sohn in einem Film viele Jahre später mitspielt. Ich konnte gar nicht glauben, dass etwas, an dem ich beteiligt war, ihm in seinem Leben geholfen hat.“
Im Reisepass von Billy findet sich übrigens eine weitere Kuriosität. Denn Buzz Schneider wurde nach den Olympischen Spielen Profi-Eishockeyspieler, unterschrieb beim SC Bern in der Schweiz und zog zusammen mit seiner Frau Gail nach Europa. Und so erblickte Billy im Dezember 1980 auf neutralem helvetischen Boden das Licht der Welt.
Die Schneiders waren nicht die einzigen, die damals nach Europa umzogen. Auch Mark Pavelich, Nebenmann im Sturm von Lake Placid, landete in einer neuen Umgebung. Er unterschrieb beim HC Lugano, aber schaffte es nach nur einem Jahr zurück in die USA, wo er in der National Hockey League unter anderem bei den New York Rangers und den Minnesota North Stars spielt.50
Schneider, der damals vom deutschen Meistertrainer Xaver Unsinn in die Schweiz geholt wird, hat seine Zeit in Bern sehr genossen und erinnert sich noch heute gern daran. Vor allem auch an Mitspieler, die hier zu neuen wichtigen Bezugspersonen wurden. Wie zum Beispiel Roland Dellsperger, sein bester Freund im Team, mit dem er sich unterwegs die Hotelzimmer teilte. Die beiden halten bis zum frühen Tod des Eidgenossen 2013 ständig Kontakt. Auch die Freundschaft zu Renzo Holzer reißt nie ab. Nicht mal nachdem Schneider 1983 mit 28 Jahren in seine Heimat zurückkehrte und das Eishockeyspiel aufgibt. Der Mann, der mit seinen Schlagschüssen ganze Spiele entscheiden konnte, leidet an den Folgen eines irreparablen Bandscheibenvorfalls.
Auch das hervorragende Verhältnis zu den anderen Teamgefährten von Lake Placid bleibt erhalten. Die Gruppe trifft sich immer wieder zu medienwirksamen Ereignissen, mit deren Hilfe die Erinnerung an das Wunder weiter gepflegt wird. So wie im Februar 2015, als man in Lake Placid mal wieder zusammenkommt.
Immer dabei: Fernsehreporter Al Michaels: „Sie haben mich bei ihren Zusammenkünften immer wieder eingeladen und niemand sonst von außen. Die Erinnerung an dieses Ereignis hätte allerdings auch so überlebt, egal, was ich am Ende gesagt habe. Es wäre eindeutig eines der Ereignisse gewesen, an die sich Menschen für den Rest ihres Lebens erinnern. Aber die Spieler sind so dankbar, dass ich in der Lage war, das in Worte zu fassen. Und ich bin nicht nur dankbar dafür, dass ich das tun konnte, sondern auch für sie. Denn dies war ein so einzigartiges Ereignis. Etwas, was es noch nie zuvor gegeben hatte.“
Einer, der in solchen Momenten schmerzlich vermisst wird, ist der Mann, dem man vor der Eishockeyhalle in St. Paul ein Bronzedenkmal in Lebensgröße errichtet hat: Trainer Herb Brooks. Der war in den 1970er-Jahren Coach der Collegemannschaft der University of Minnesota und mit ihnen dreimal US-Meister geworden. Er hatte für die Olympischen Spiele eine Phalanx aus Repräsentanten seiner Heimatregion zusammengestellt: zwölf der 20 Spieler im Kader kamen so wie Buzz Schneider aus Minnesota. Sowie fast alle Mitglieder im Betreuerstab.
Ein Jahr nach dem Sieg von Lake Placid macht er ebenfalls einen Abstecher in die Schweiz, als er beim HC Davos einen Vertrag bekommt. Später arbeitet er in der National Hockey League und betreut die New York Rangers, dann die Minnesota North Stars, die New Jersey Devils und schließlich die Pittsburgh Penguins. Seine Rückkehr an die Bande bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City ist der Grundstein für eine Silbermedaille der amerikanischen Mannschaft. Brooks verliert am 11. August 2003 bei einer Fahrt außerhalb von Minneapolis die Kontrolle über seinen Wagen, wird herausgeschleudert und stirbt an Ort und Stelle.
„Er war der richtige Mann, der uns zur richtigen Zeit trainiert hat“, hat Ken Morrow mal gesagt, der später mit den New York Islanders viermal den Stanley Cup gewann. „Ich glaube mit jemand anderem hätten wir nicht gewonnen.“
Ein Trainer mit vielen taktischen Einfällen. Buzz Schneider: „Herb Brooks selbst hat an Olympischen Spielen teilgenommen und oft in der Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß nicht mehr genau wie oft. Er wusste, wie die Russen und die Tschechen spielen, wie sie den Puck kontrollieren und flexibel sind, wenn es um die Positionen geht. Er hat sie lange studiert. Ich weiß, dass er einige dieser Lektionen an der Universität von Minnesota in den 70er-Jahren angewandt hat. Puckkontrolle und Positionswechsel – das war nicht das alte, traditionelle nordamerikanische Eishockey, bei dem die Flügel hoch und runter an der Bande entlang unterwegs sind. Er glaubte nicht an dump and chase. Wir wussten also, dass wir einen Vorteil hatten. Wir hatten 20 Spieler, die alle schnell waren und mit dem Puck umgehen konnten. Wir waren in sehr guter körperlicher Verfassung. Und wir konnte andere Teams mürbe machen.“
Aber Brooks ist jemand, der mit seinen eigenen Spielern sehr distanziert umgeht. „Ich glaube, er wäre sicher gerne Teil unserer Gruppe gewesen, aber irgendwie konnte er das nicht“, weiß Mike Eruzione, der Kapitän der Goldjungs von Lake Placid. Dafür befeuert er sie mit seinen Sprüchen, die die Spieler antreiben sollen. Und die Eruzione und zwei Mannschaftschaftskollegen in einem Booklet sammeln, das sie Brooksisms nennen. Es enthält jene Sätze, die nach seinem Tod im Miracle-Film genutzt werden, um seinen Umgang mit den Spielern zu illustrieren:
„Gentlemen, ihr besitzt nicht genug Talent, um ausschließlich auf der Basis von Talent gewinnen zu können.“
„Lasst uns idealistisch sein, aber gleichzeitig auch praktisch.“
„Ihr könnt nicht normal sein. Denn der normale Mensch schafft es nirgendwo hin. Ihr müsst unkonventionell sein.“
Vor dem Spiel, im engen Umkleideraum Nummer 5 vom Olympic Field House, gibt er ihnen diese Botschaft mit auf den Weg, die dem Projekt eine messianische Note gibt: „Ihr seid als Sieger geboren worden. Ihr wart dazu bestimmt, hier zu sein. Das ist euer Augenblick.“
„Ich habe mit Herb nie ein Problem gehabt“, sagt Buzz Schneider. „Er war ein Mann, der zu seinem Wort stand. Solche Leute gibt es heute gar nicht mehr.“
*
Übrigens wird in der Erinnerung an die Leistung der amerikanischen Spieler und an ihren emotionalen Erfolg meistens gerne unterschlagen, was aus dem Gegner wurde, der an diesem Freitag 1980 zur eigenen Verblüffung die vermutlich härteste Niederlage in der stolzen Geschichte des sowjetischen Eishockeys erleidet.
Es dauert Jahre, ehe man sich in Amerika dafür interessiert, das Schicksal der Geschlagenen filmisch aufzuarbeiten. Gabe Polsky, Sohn russischer Einwanderer und ein ehemaliger College-Eishockeyspieler, dreht die Dokumentation Red Army und bringt sie 2015 in die Kinos. Im selben Jahr wird die Fernsehproduktion Of Miracles and Men ausgestrahlt. Beide zeigen eindrücklich die andere Seite der Medaille: die nachhaltige Enttäuschung.
Was war damals in den zwei Stunden im Olympic Field House von Lake Placid passiert? Wie konnte eine derart glanzvolle Truppe in einem solchen Moment versagen?
Für die Spieler ist die Sache heute klar: Trainer Wiktor Tichonow, ein erfolgsverwöhnter Autokrat und genialer Kopf, hatte nach dem ersten Drittel unmittelbar nach dem Ausgleich der Amerikaner zum 2:2 völlig überraschend seinen legendären Torwart Wladislaw Tretjak vom Eis geholt und den Ersatzmann Wladimir Myschkin rausgeschickt. „Keiner im Team war glücklich über die Entscheidung“, verrät Sergej Makarow Jahre danach. „Tichonow war in Panik geraten. Er hatte sich nicht mehr im Griff.“
Zwar gehen die Sowjets danach im zweiten Drittel mit 3:2 erneut in Führung und fühlen sich zunächst scheinbar sicher. Doch die Amerikaner geben sich nicht geschlagen.
Tichonow gibt hinterher seinen Spielern die Schuld. Sie hätten sich selbst über- und den Gegner unterschätzt, giftet er seine Stars an: „Das ist eure Niederlage. Das ist eure Niederlage.“
Dass die Mannschaft beim Turnier immerhin Silber gewinnt, ist für die Verlierer kein Trost. „Ich habe meine Medaille nicht mehr“, gibt Makarow Jahre danach gegenüber dem amerikanischen Sportjournalisten Wayne Coffey während der Recherchen zu dessen Buch The Boys of Winter zu.51 „Ich glaube, sie ist in einem Mülleimer in Lake Placid gelandet.“
Anders ergeht es der Goldmedaille, die Buzz Schneider mit nach Hause bringt. Er holt sie in den vier Jahrzehnten danach ziemlich oft aus der Vitrine. Und so geht das Verbindungsstück zur Schleife kaputt, mit dem man sich die Memorabilie um den Hals hängen kann.
Kein Problem. Das Wunder ist ja vollbracht. Und das Echo darauf scheint nie wieder abzuebben.
(2021)
48 Ein Begriff, der, wie die New York Times herausfand, bei NBC Sports 1992 während der Sommerspiele von Barcelona von Chefproduzent Terry O’Neil geprägt wurde, um die Praxis zu beschönigen, aufgezeichnete Übertragungen kosmetisch so aufzuwerten und sie so zu präsentieren, als würden sie in dem Augenblick stattfinden.
49 Es war nicht die erste Verfilmung des Jahrhundert-Triumphs. Bereits ein Jahr nach dem Erfolg kam ein Dokudrama mit dem Titel Miracle on Ice ins amerikanische Fernsehen. In der Hauptrolle: der damals bereits 69 Jahre alte Hollywood-Schauspieler Karl Malden (Endstation Sehnsucht, Die Straßen von San Francisco). Ein deutlicher Kontrast zum echten Herb Brooks, der in Lake Placid gerade mal 42 gewesen war. Er wurde in der Neuauflage 2004 fürs Kino von Kurt Russell (Elvis, Die Klapperschlange), der bei den Dreharbeiten im selben Alter war wie Brooks in Lake Placid, sehr viel plausibler als komplexer Charakter auf die Leinwand gebracht. Weshalb die Produktion (Drehbuch: Eric Guggenheim und Mike Rich, Regie: Gavin O’Connor) als einer der 50 besten amerikanischen Sportfilme gilt. Das Werk von 1981 hingegen hinterließ keinen bleibenden Eindruck. Unter anderem auch deshalb nicht, weil er nach Meinung von Kritikern nicht verstanden hatte, die Essenz der Sportart Eishockey einzufangen und die zentralen Figuren erstaunlich hilflos in Karikaturen ihrer selbst verwandelt hatte.
50 In der letzten Phase seines Lebens sorgte Mark Pavelich für neue Schlagzeilen, die so gar nicht in das Image des Eishockey-Helden passten. Im Sommer 2019 wurde er verhaftet, weil er einen Nachbarn körperlich angegriffen hatte, mit dem er auf einem gemeinsamen Angelausflug gewesen war. Er wurde jedoch für nicht verhandlungsfähig erklärt und in eine geschlossene Therapieeinrichtung überstellt. Familienangehörige äußerten die Vermutung, dass er schon länger unter der Gehirnerkrankung Chronische Traumatische Enzephalopathie (CTE) litt, die zu Verhaltensveränderungen führen kann. Er nahm sich im März 2021 das Leben (siehe auch Wie viele kleine Autounfälle über die in den letzten Jahren gereiften Erkenntnisse über die Langzeitrisiken von Sportarten wie Fußball, Football und Eishockey auf Seite 297ff.
51 Wayne Coffey: The Boys of Winter – The Untold Story of a Coach, a Dream, and the 1980 U.S. Olympic Hockey Team, New York, 2005