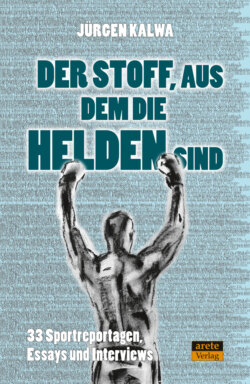Читать книгу Der Stoff, aus dem die Helden sind - Jürgen Kalwa - Страница 7
THE SPIRIT
ОглавлениеDas Koordinatensystem einer Sportwelt, die Helden produziert, weil sie Helden braucht
Es gibt Menschen, die jede Zurückhaltung ablegen, wenn sie ihn entdecken. Sie betasten seine Arme und Beine. Reden auf ihn ein. Und versuchen auf eine hypnotische Art, mit ihm zu kommunizieren.
Den Annäherungsversuchen ist er wehrlos ausgeliefert. Denn der Sockel, auf den ihn der Bildhauer gestellt hat, damit er mit ausgestrecktem Arm und einem Ball in der Hand für immer und ewig zu einem imaginären Korb fliegt, ist nur etwas mehr als 1,50 Meter hoch. Michael Jordan in Bronze – ein Denkmal des amerikanischen Sports mit dem Titel The Spirit – hat auf diese Weise sehr menschliche Dimensionen behalten.
Er ist zum Greifen nah.
Der Platz, an dem er aufgestellt wurde, ist gut gewählt. Es ist der Bereich vor Tor 4 des United Center in Chicago, einer der Kathedralen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Jordan, der in dieser Sporthalle mit den Chicago Bulls manchen Meisterschaftserfolg errungen und einen Klub zurückgelassen hat, der seitdem nie wieder auch nur in die Nähe der alten Erfolge kam, wird auch in Zukunft ihre bedeutendste Ikone bleiben. Die Stimmung des Jahres 1995, als er nach einem Baseball-Intermezzo in Alabama32 nach Chicago zurückkehrte, hat diesen Status gleichsam zementiert. Die Szenen von damals blieben unvergessen. „Es war verrückt“, sagte Bulls-Center Will Perdue. „Es gab Leute, die vor seiner Statue gebetet haben. Sie haben gebetet, dass er zurückkommt.“
Der beste Basketballer der Welt hat in jenen Tagen nicht nur seine Fans in eine ungewöhnliche Begeisterung versetzt. An der New Yorker Börse stiegen die Aktien der Firma Nike, des Herstellers der Air-Jordan-Schuhe.
Gerade weil seine Popularität so enorm war, ist sein Stellenwert nur schwer zu messen. Keine Statistik vermag zu erfassen, was der Mann aus North Carolina auslöste, als er zum Aushängeschild einer Stadt wurde, deren bekanntester Einwohner einst ein Gangster namens Al Capone war. Aber sein Einfluss auf die Umwälzungen in der Beziehung zwischen kommerziellem Sport und der modernen westlichen Gesellschaft lässt sich durchaus beschreiben. Michael Jordan, ein leichtfüßiger Spieler mit fast balletthaften Bewegungen und einem unbändigen Willen zum Sieg, war Symbol und Wegbereiter für eine Entwicklung, in deren Rahmen Athleten immer stärker Einfluss auf das Denken und Handeln von Millionen von Menschen nehmen. Von Menschen, die Sport wie eine Droge inhalieren.
Der Entwicklung haftet etwas Zwangsläufiges an – nicht nur in den USA. Dort zeigen sich manche Phänomene allenfalls deutlicher und ausgeprägter als in anderen Ländern – etwa beim Nachruhm eines Baseballspielers wie Babe Ruth, dessen Leben mehrfach verfilmt wurde. Oder wie im Fall von Joe DiMaggio, dessen Name in dem Pop-Song Mrs. Robinson von Simon & Garfunkel verewigt wurde (Zitat: „Where have you gone, Joe DiMaggio?“). Ihr Symbolcharakter wirkt stärker – bis an den Rand zur Groteske, wie im Fall des Boxers Muhammad Ali, dem einstigen Großmaul, der später krankheitsbedingt nur noch schweigend die Sympathien der Welt genießen konnte. Sie wirken gelegentlich wie morality plays33, etwa dann, wenn jemand wie Mike Tyson, im Ring ein gnadenloser Faustkämpfer, als verurteilter Gewalttäter im Gefängnis landet. Wenn ein Ausnahmegolfer mit einem Vermögen von mehreren hundert Millionen Dollar wie Tiger Woods aufgrund eines Sexskandals beinahe aus der Bahn geworfen wird. Oder wenn Steuerbehörden mit der Macht des Gesetzbuchs etwa in Deutschland Tennisprofis wie Boris Becker und Steffi Graf oder Fußballmanager wie Uli Hoeneß in heikle Situationen bringen.
Sie alle und ihre verschlungenen Biographien gehören zu der Stoffsammlung, die eine neue Art von Identifikationsfiguren geschaffen hat. Spitzensportler von Weltrang, die einerseits zwar durch ihr Können das Unterhaltungsbedürfnis der Massen über kulturelle und Sprachgrenzen hinweg bedienen, die zu unkritisch verehrten Ikonen stilisiert werden, aber nur selten den Anspruch der Gesellschaft erfüllen, die sie gerne allzu naiv zu Vorbildern machen würde.
Mit diesem Spannungsverhältnis hat Michael Jordan schon früh umzugehen versucht. Deshalb präsentierte er sich zwischendurch als angelernter Sportphilosoph und ließ seine Gedankenkrümel über die neurotische Wechselbeziehung zwischen Ehrgeiz, Sport und Öffentlichkeit zwischen die Buchdeckel der Motivationsfibel I Can‘t Accept Not Trying pressen. Das Werk offenbarte, dass Jordans Antriebskräfte offensichtlich einem manischen inneren Monolog entspringen: aus der ständigen Auseinandersetzung mit der Möglichkeit des Scheiterns. „Es ist hart“, beschrieb er das Gefühl, „wenn man jedes Mal auf dem Spielfeld alles bringt, was man hat, und trotzdem verliert.“
Der real existierende Jordan ist das Produkt einer faszinierenden Sportkultur. Einer vielschrötigen Maschinerie ohne Vereinsmeierei und staatliche Lenkung, die mit den Widersprüchen der amerikanischen Gesellschaft lebt und durch sie gedeiht. So ist sie auf der einen Seite bis zum letzten T-Shirt mit aufgedrucktem Club-Emblem konsequent durchkommerzialisiert und verlangt den Profis im Laufe ihrer Karriere alles ab, was sie haben: ihre Gesundheit und eine Söldnermentalität vom Zuschnitt der Angehörigen der französischen Fremdenlegion.
Aber Amerikas Stars kommen nicht aus dem Nichts. Die meisten besuchen Universitäten, die aus Tradition das Fundament und das Rückgrat des organisierten Leistungssports in den USA bilden. Das erklärt, weshalb die große amerikanische Sport-Show von heute in einem philosophischen Rahmen existiert, der in Elite-Universitäten wie Harvard und Yale gegen Ende des 19. Jahrhunderts formuliert wurde: Damals galt Sport als Inbegriff der Charakterschulung für junge Männer, die es zu etwas bringen wollen.
Der Anspruch mag übertrieben klingen. Denn die Idee hat, seitdem die Universitäten selbst das Sportgeschehen kommerziell ausschlachten, ihre naive Unschuld verloren. Dennoch produziert der College-Sport auch heute noch mit Hilfe des Fernsehens ein spezifisch amerikanisches Irresein. Bierselig feuern Ex-Studenten in Sportbars und auf Partys den sportlichen Nachwuchs ihrer Alma Mater an. Ganze Bundesstaaten wie Indiana und Kentucky im Basketball oder Alabama und Texas im Football identifizieren sich mit College-Athleten.
Die unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt von ihren Kollegen in den Profiligen: Amerikas Studenten waren bis vor kurzem echte Amateure.34 Egal ob sie gewannen oder verloren – solange sie die Farben der Hochschule trugen, bekamen sie nichts außer einem Stipendium. Sie wurden streng abgeschirmt von Schuh-Deals, Prämien, Sachgeschenken, Vorverträgen und sogar von Essenseinladungen. Selbst jemand wie Tiger Woods hatte als Student keinen Spielraum. Als er mit seinem namhaften Golferkollegen Arnold Palmer eines Tages ein Restaurant besuchte, bezahlte der zwar die Rechnung. Woods jedoch musste ihm hinterher einen Scheck schicken. Hätte er Palmer nicht seinen Anteil erstattet, hätte er sein Stipendium einbüßen können und wäre gezwungen gewesen, die teuren Studiengebühren der Stanford University selbst zu bezahlen. Und dieses Geld hatte der Mann damals nicht, der später als allererster Sportler die Milliardengrenze an Bruttoeinnahmen überschreiten sollte.
Das vermeintliche Idyll produziert nicht nur Absurditäten. Es fabriziert Risse. Denn der Universitätssport kommt nicht mehr mit seiner selbstgewählten Rolle als Ausbildungslager für den Profibereich zurecht. Die Verzahnung mit den Medien hat an den Hochschulen zu einem Starsystem eigener Prägung geführt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Mythos vom erfolgreichen Amateurathleten und dem unbefleckten Helden- und Leistungskult endgültig seinen Glanz verliert.
Nicht alle Nachwuchstalente drängen in den Profibereich. Es gibt jene, die das, was sie an der Universität und auf dem Spielfeld erreicht haben, in andere Karrieren ummünzen. Einige fühlen sich sogar berufen, in die Politik zu gehen. Wie der Princeton-Absolvent und Basketball-Olympiasieger Bill Bradley, der nach einer Karriere bei den New York Knicks Senator in Washington wurde. Oder wie der Football-Quarterback Jack Kemp, der in den achtziger-Jahren unter den Präsidenten Ronald Reagan und George Bush das Wohnungsbauministerium leitete.
Sport und Politik stehen sich in den USA nicht weltfremd gegenüber. Die Morgenjogger Bill Clinton und George W. Bush waren nicht die letzten Golfer in einer Reihe sportaktiver Präsidenten, die mit Dwight D. Eisenhower begann. Nach dem Golfer (und College-Basketballer) Barack Obama demonstrierte Donald Trump, dass sich so etwas noch steigern lässt. Er spielte fast nur auf Golfplätzen, die ihm selbst gehören und die er penetrant mit seinem Namen plakatiert hat.
Auch amerikanische Intellektuelle und Schriftsteller haben sich mit Sport beschäftigt. Von Scott F. Fitzgerald (Football) und William Faulkner (Kentucky Derby) bis Norman Mailer (Boxen), Stephen King (Baseball) und John Irving (Ringen) spannt sich ein beeindruckender Bogen von literarischen oder essayistischen Annäherungen, die bemerkenswerten Lesestoff hervorgebracht haben. Wie etwa den Roman Der Sportreporter von Richard Ford, der eine vielschichtige, nachdenkliche Kunstfigur aus dem Typenspektrum der gleichnamigen journalistischen Subspezies herausgeschnitzte und in drei weiteren Romanen weiterentwickelte35.
Hollywood spielte mit einer Handvoll guter Filme ebenfalls einen Part. Und das auch, weil Schauspieler wie Robert Redford (The Natural) oder Paul Newman (Slapshot) keine Berührungsängste hatten, obwohl ihnen sicher die Schwierigkeit bewusst war, Sport fürs Kino zu inszenieren. Manche Filme sind so gut, dass sie einem das Milieu auf eine erotische und zugleich humorvolle Weise nahebringen. Unübertroffen: Susan Sarandon und Kevin Costner in dem Südstaaten-Baseball-Film Bull Durham.
Wenn man der Frage, worin die Dynamik der amerikanischen Sportkultur besteht, noch ein wenig weiter nachgeht, stößt man auf zusätzliche Elemente. Eines ist der Kalender mit einer beachtlichen Palette von Sportarten, die das ganze Jahr über für Höhepunkte und Abwechslung sorgen. Ein anderes ist ein spürbarer Eskapismus unter Männern, die mehrere Jahrzehnte nach dem Aufbruch der Frauenbewegung den Sport als Reservat für Männerkult und Sexismus pflegen. Hier können sie sich von der Emanzipationsrealität in eine Vorstellungswelt zurückziehen, die woanders in der Gesellschaft nicht mehr existiert, wie Mariah Burton Nelson schon vor einiger Zeit in ihrem provokativen Buch The Stronger Women Get, the More Men Love Football36 herausgearbeitet hat.
Es passt in die Landschaft, dass sich die USA seit der Bürgerrechtsbewegung und dem Krieg in Vietnam in einer anhaltenden gesellschaftspolitischen Sinnkrise befinden. Mögen Politiker, Professoren und Pastoren so viel reden wie sie wollen, immer weniger Amerikaner hören ihnen zu. Die konsumverwöhnte Mittelklasse hängt lieber den Siegertypen aus den Riesen-Arenen an den Lippen. Neue Helden und geheime Verführer, die mit Hip-Hop-Musik und über Social-Media-Kanäle Schuhe, Kappen, Trikots und Bälle verkaufen. Immer mit dabei: die prickelnde uramerikanische Ideologie des „Gewinnen ist alles“. Den Siegern gehört die Welt.
Viele dieser Sieger sind schwarz – nicht nur im Basketball, wo 80 Prozent der NBA-Profis eine dunkle Hautfarbe haben, oder im Football, wo mehr als 60 Prozent der NFL-Spieler Afro-Amerikaner sind. Eine erstaunliche Entwicklung nur ein halbes Jahrhundert nach der Abschaffung der Rassentrennung im Süden der USA. Schwarze Athleten haben einen Anteil daran, die Phobien von Weißen gegenüber großen und starken dunkelhäutigen Männern zu beschwichtigen. Aber das reicht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sobald afro-amerikanische Athleten Probleme mit der Polizei bekommen oder auf dem Platz ausflippen, hagelt es von Vorurteilen geprägte Kritik.
Mit anderen Worten: Selbst durch den Sport als Erfolgsmenschen ausgewiesene und bestens bezahlte Schwarze müssen im weißen Amerika mit seinen Mikroaggressionen und Herabsetzungen unablässig um Anerkennung und Respekt kämpfen. Dieser Kampf, der ihre Persönlichkeit formt und sich als unverstellte, authentische Erfahrung vermittelt, ist der Hauptgrund dafür, weshalb die erfolgreichen schwarzen Sportler in den USA mehr sind als Sprechpuppen der Sportartikelindustrie.
Wenn man tiefer schaut ins feine Gewebe eines Spieles wie Basketball, sieht man übrigens, wie schwarze Spielkultur die Wechselbeziehung von Mitspielern und Gegnern beim Kampf um Spielfläche und Dribbel-Wege modifiziert hat. Was früher ein Mannschaftsspiel war, in das sich der einzelne einordnet, ist heute ein Varieté von One-Man-Shows, ruppigen Rivalitäten, bei dem das Bedürfnis nach dem Übertrumpfen, nach sogenannter One-upmanship stärker ist als das Gefühl für Kameradschaft.
Obwohl der Bedarf an Stars angesichts der unübersehbaren Medienlandschaft mit ihren Live-Übertragungen, der angeflanschten Bierreklame und den wachsenden Erwartungen der Zuschauer groß ist, produziert die Heldenfabrik keine Fließbandfabrikate. Wer allzu früh hochgelobt wird und zu viel verdient, dem droht, frühzeitig zu scheitern. Schon besser, einer fängt ganz unten an. Erst dann entsteht der Stoff, aus dem der Glamour ist.
Als Michael Jordan 1984 nach dem Studium und nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen Profi wurde und zu den Chicago Bulls kam, waren sie eine der schlechtesten Mannschaften in der NBA. Er fand schnell heraus, was das heißt: „In den ersten paar Minuten des ersten Spiels wurde ich umgehauen und landete auf dem Boden.“ Es dauerte dreieinhalb Jahre, in denen er ackerte und artistischer und unberechenbarer wurde, bis die Bulls zum ersten Mal die Playoffs der besten 16 NBA-Mannschaften erreichten. In jener Saison spürte man, dass Jordan vielleicht eines Tages seine Sportart dominieren könnte. Er war bester Defensivspieler, erfolgreichster Korbschütze, Slam-Dunk-Champion und wurde als Most Valuable Player ausgezeichnet.
In den Jahren danach zeigte er, dass man als Sportler noch weiter gehen kann, als Titel und Meisterschaftsringe zu sammeln und Millionen von Dollar aufeinanderzuschichten. Kein anderer Athlet hat die Grenzen zwischen Privatheit und öffentlicher Person derartig subtil aufgelöst und aus der eigenen Person ein Mediengesamtkunstwerk à la Joseph Beuys oder Andy Warhol geschaffen. Nicht mal Muhammad Ali, der nach seinem Übertritt zum Islam den Wehrdienst verweigerte und dafür vom Boxverband gesperrt wurde. Das jüngste Resultat für diesen gesellschaftlichen Prozess: Der im Frühjahr 2021 veröffentlichte zehnteilige Dokumentarfilm, Titel The Last Dance, den der Fernsehsender ESPN produzierte und der den Kunstgriff benutzt, auf Jordans allerletzte Saison in Chicago 1997–98 zurückzublenden, während er gleichzeitig das Panorama der Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale des Basketballers und seinen Einfluss auf seine Mitspieler beleuchtet. Die Wirkung ließ sich an den Einschaltquoten ablesen: Die zehn Episoden erreichten im Schnitt live mehr als fünf Millionen Zuschauer und fast 13 Millionen pro Folge, die sie sich die Doku nachträglich on demand anschauten.
Der dramaturgische Faden des Films hat etwas. Besonders wenn man weiß, dass der Erfolg der Mannschaft damals mehr war als ein lockerer, glorreicher Spaziergang. Die Widrigkeiten und Eitelkeiten, die sich im Laufe der Jahre in der Umkleidekabine der Bulls aufgestaut hatten, waren nicht unerheblich und Teil der Geschichte. Regisseur Jason Hehir konnte dafür auf bis dahin nie gezeigte Aufnahmen aus dem Archiv zurückgreifen. Rund 500 Stunden an Rohmaterial, das eine Crew im Auftrag der NBA im Laufe jener Saison gedreht hatte, das aber nie das Licht der Welt erblickt hätte, wenn Jordan, dem die Liga Veto-Recht eingeräumt hatte, seine Zustimmung verweigert hätte.
Auf diese Weise erfährt die interessierte Welt nicht nur zum wiederholten Mal, was für ein genialer, sportlich überragender und extrem ehrgeiziger Typ dieser Michael Jordan war. Sondern sie erhält zusätzlich Einblick in das Sammelsurium aus neurotischen Charakteren, ohne die es die Nummer 23 nie zum ganz großen Erfolg gebracht hätte.
Die meisten von ihnen haben sich mit ihrer Rolle als Nebendarsteller abgefunden. Selbst der damalige Bulls-Center Luc Longley, der wenig später in seine Heimat Australien zurückkehrte und aus der Rückblende fast völlig herausradiert wurde. Angeblich wurde er für das Projekt nicht interviewt, weil die Kosten für eine Reise des Drehteams zu hoch waren und die COVID-Pandemie alles verkomplizierte. Longley war deshalb bereit, sich erstmals vom australischen Fernsehen ausführlich porträtieren zu lassen. Die Produzentin Caitlin Shea von der Australian Broadcasting Corporation (ABC) sagte dem amerikanischen Sender Fox Sports: „Er wollte, dass junge Australier erfahren, dass auch ein Aussie in dieser Mannschaft war.“37
Scottie Pippen ging noch weiter und beschwerte sich hinlänglich in seiner 2021 erschienenen Autobiographie über The Last Dance: Nicht nur war Pippen sauer, dass darin der damalige Kampf des gesamten Teams um den sechsten NBA-Titel zu einer Glorifizierung von Jordan umgedeutet wurde. Was ihn noch mehr genervt hatte, war dessen Einfluss im Hintergrund als Produzent mit Vetorecht über das eingesetzte Bildmaterial. „Michael erhielt 10 Millionen Dollar für seine Rolle in der Doku“, schrieb er. „Meine Mannschaftskollegen und ich erhielten keinen Cent.“38
Abgesehen davon, dass Jordan seine Erfolge auf dem Platz nicht alleine geschafft hat: Was seine Ausstrahlung außerhalb der Arenen betrifft, geht viel auf das Konto einer der kreativsten Werbeagenturen der Welt, Wieden & Kennedy in Portland im Bundesstaat Oregon. Dort entwirft man seit Jahrzehnten jene Nike-Werbespots, mit denen aus profanen Sportlern wahre Aktionskünstler werden. In dem eindrücklichsten Jordan-Clip steht er allein in einer leeren, halbdunklen Turnhalle und spielt den einsamen, nachdenklichen Helden, der so gern von dem Sockel herabsteigen möchte, auf den ihn die amerikanische Öffentlichkeit gestellt hat. „Was wäre, wenn mein Name nicht in Neonbuchstaben geschrieben würde?“, fragt er mit dieser tiefen Stimme aus dem Off, während er einen Ball nach dem anderen in den Korb wirft. „Was, wenn mein Gesicht nicht in jeder zweiten Minute im Fernsehen gezeigt würde?“
Die Kamera hängt weit oben unter der Decke und fängt ihn in ästhetisierenden Schwarzweißkontrasten ein.
„Was, wenn nicht hinter jeder Ecke ein Menschenauflauf entstünde?“
Das Tippen des Balles. Das Geräusch des Netzes.
„Was, wenn ich einfach nur ein Basketballspieler wäre? Kannst du dir das vorstellen?“
Es herrscht sekundenlang Stille. Und jeder darf rätseln, was er dem berühmtesten und reichsten Sportler der Welt auf eine solche Frage antworten würde. Aber bevor wir ihm etwas Gescheites zurufen können, nimmt er uns das Nachdenken ab.
„Ich kann.“
(2021)
Skulpturen von Sportlern wachsen seit den neunziger-Jahren allerorts aus dem Boden. Omri Amrany, der Maler und Bildhauer, der das Jordan-Denkmal, genannt The Spirit gestaltet hat, bekam seither ständig ähnliche Aufträge und entwarf Statuen von Basketballern wie Magic Johnson, Wilt Chamberlain und Jerry West, von Eishockeyspielern wie Gordie Howe und Bobby Hull und den bei einem Militäreinsatz von seinen eigenen Kameraden getöteten, ehemaligen Football-Profi Pat Tillman.
Den Auftrag von 1993 bekam er auf Initiative von Bulls-Eigentümer Jerry Reinsdorf, nachdem der für das Projekt Entwürfe von mehreren Künstlern eingeholt hatte. Die fertige Statue wurde am 1. November 1994 in einer Feierstunde enthüllt.
Im Umgang mit den Skulpturen ist man in Nordamerika durchaus flexibel. Als das NHL-Team der Edmonton Oilers innerhalb der Stadt in eine neue Halle umzog, musste der in Bronze gegossene Wayne Gretzky, der in dieser Darstellung den Stanley Cup in die Luft stemmt, natürlich mit und wurde umgepflanzt. Die Universität Penn State wiederum ließ kurzerhand die Statue des Football-Trainers Joe Paterno entfernen. Die hatte sie nur wenige Jahre zuvor als Würdigung für seine erfolgreiche Arbeit errichtet. Bauarbeiter rückten kurzerhand an und warfen eine blaue Plastikplane über den grinsenden, alten Mann mit der dicken Brille, der ein paar Jahre lang mit erhobenem Zeigefinger vor dem Stadion gestanden hatte. Ein Ruck mit einem Kran – und die 400 Kilogramm schwere Bronze in Lebensgröße war entwurzelt, abtransportiert und verschwunden. Zusammen mit der Inschrift „Joseph Vincent Paterno. Erzieher, Coach, Humanist“.
Der Grund: Während Paternos jahrzehntelangem Regime hatte einer seiner ehemaligen Assistenztrainer in den Umkleidekabinen des Football-Zentrums der Universität immer wieder Jungen sexuell missbrauchen können, unter anderem deshalb, weil Paterno es vermieden hatte, die Polizei einzuschalten.
Es gibt aber auch den Fall, der nur auf einer abgehobenen Ebene etwas mit dem organisierten Sport zu tun hat. Es ist das überlebensgroße Denkmal des fiktiven Boxers Rocky Balboa, gespielt vom Schauspieler Sylvester Stallone. Der hatte diese Figur erfunden und in einer Serie von mittlerweile neun Filmen auf die Leinwand gebracht. Mit ihr wollte er einem besonderen Typ von Athleten aus der Stadt Philadelphia einen Lorbeerkranz winden: dem heroischen Philly Fighter, der bis zum Schluss kämpft, egal ob er gewinnt oder verliert, und der niemals aufgibt.
Die Skulptur, eine bloße Requisite in der dritten Rocky-Folge und künstlerisch alles andere als bemerkenswert, schenkte Stallone nach den Dreharbeiten der Stadt. Die stellte sie zunächst vor einer Sporthalle auf, aber konnte irgendwann den Widerstand von kunstsinnigen Verantwortlichen aus dem Philadelphia Art Museum und der Philadelphia Art Commission überwinden. Und so landete die Figurine mit den hochgerissen Armen am unteren Ende der riesigen Freitreppe des Museums. Ein Ort, der zu den szenisch wichtigen Schauplätzen in den Filmen gehört.
Was dieser Rocky symbolisiert, ist die Fähigkeit vieler Amerikaner, Realität und Fiktion in eine Melange auflösen zu lassen, die neue Realitäten schafft. Wie sagte James Binns, ein ehemaliger Box-Funktionär und Freund von Stallone? „Kunst soll die Menschen inspirieren. Und genau das passiert hier. Rocky war ein Sieger. Und jetzt steht er als Sieger an der passenden Stelle. Neben den Treppenstufen, die er berühmt gemacht hat.“
Beim Phänomen der wachsenden Zahl an Sportlerskulpturen in allen Teilen der Welt kommen nach Ansicht des Darmstädter Sportsoziologen Professor Dr. Karl-Heinrich Bette einige Aspekte zum Vorschein. Er sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Sommer 2020: „Der erste Punkt ist, dass der Sport im Moment mit Themen wie Doping, Korruption, Überkommerzialisierung, Hooliganismus durchaus kritisch in der öffentlichen Diskussion steht. Der Sport versucht sozusagen, das Negative so durch eine positiv gestimmte Erinnerungskultur und Gedächtnis- und Verehrungsindustrie zu kompensieren. Und der zweite Gesichtspunkt ist: Sportler sind nicht nur für sich selbst erfolgreich, sondern immer auch für ein Milieu, das sie entsendet hat. Das sind Vereine, das sind in Amerika die Universitäten, das sind die Nationalstaaten. Die Athleten sind im Grunde dann Stellvertreterfiguren. Das Aufbauen von Skulpturen, das Aufhängen von Büsten, das gehört mit zur Inszenierung des Sports.“39
Auf der Atlantik-Insel, auf der der Fußballer Cristiano Ronaldo aufwuchs, geht diese Inszenierung inzwischen so weit wie nirgendwo auf der Welt. Die Enthüllung einer Büste auf dem Inselflughafen mit dem offiziellen Namen Madeira Cristiano Ronaldo war nur das erste Ereignis in einer Kette, die demonstriert, welche Ausmaße die Heldenverehrung inzwischen annehmen kann. Denn die kleine Skulptur zeigte ein ziemlich verzerrt grinsendes Gesicht des Kapitäns der portugiesischen Nationalmannschaft und stieß auf großes Missfallen. Nicht zuletzt beim Abgebildeten selbst. Die Arbeit von Emanuel Santos wurde ausgewechselt und mit der Darstellung eines namenlosen spanischen Künstlers ersetzt, die neutraler, aber auch ziemlich ausdruckslos wirkt.
Wen das nicht beeindruckt, der kann alternativ allerdings ein ganzes Museum besichtigen, das sich ausschließlich mit dem Fußballer beschäftigt: das Museu CR7. In ihm steht unter anderen eine Skulptur von ihm in Lebensgröße, die aus Schokolade angefertigt wurde. Vielleicht genügt aber auch bereits ein Blick auf die drei Meter hohe Ronaldo-Bronze draußen vor der Tür. Die zeigt ihn nicht nur in seiner weltberühmten breitbeinigen Pose.
Das kurioseste Element ist das Gemächt, das der Bildhauer aus der Hose herausbeulen lässt. Das Perverse daran ist nicht mal, dass Besucher ganz offensichtlich diese Zone mit Wonne betatschen, weshalb sie besonders stark in der Sonne glänzt. Sie wurde zu einem Kommentar aus dem Leben des Fußball-Stars. Denn seit Jahren läuft ihm die Beschuldigung hinterher, er habe 2009 in Las Vegas eine Frau vergewaltigt. Ronaldo bestreitet die Tat. Die Ermittlungsbehörden sahen keine hinreichenden Belege für eine Anklage. Was allerdings unbestritten ist und aus Gerichtsdokumenten hervorgeht: Ronaldo zahlte 2010 insgesamt 375.000 Dollar an die Amerikanerin, die die Zahlung später als eine Art von Schweigegeld einstufte.
32 Siehe auch Magier aus einer fernen Welt auf Seite 357ff.
33 Wörtlich: Moralitätenspiel. Ein im amerikanischen Sportjournalismus gerne benutzter Begriff, wenn es um Themen aus dem Bereich Recht, Moral und Ethik geht. Dieselbe Vokabel kennt man in Deutschland nur in ihrem ursprünglichen Kontext aus dem Bereich des Theaters, wo vor mehr als hundert Jahren Stücke populär waren, die Moralitäten genannt wurden. Sie kamen mit einer simplen Botschaft daher: Dass die Welt eigentlich in Ordnung ist. Eine Welt, in der am Ende, wenn der Vorhang fällt, die tugendhaften Akteure das Übel jedes Mal besiegt haben.
34 Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Washington und ein neues Gesetz in Kalifornien, das College-Sportlern erstmals gestattete, ihren Namen und ihren Ruhm auf eigene Rechnung zu vermarkten, brach im Laufe des Jahres 2021 das alte System komplett auf. Andere Bundesstaaten zogen nach, weil sie befürchteten, dass sie im Wettbewerb mit jungen Talenten den Kürzeren ziehen, wenn sie ihnen nicht ermöglichen, nebenbei Geld zu verdienen. Eine bundeseinheitliche Regelung wird im Kongress in Washington diskutiert, steht allerdings noch aus.
35 Ford verfolgt in der über eine Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten ausgelegten Roman-Serie das Leben seines Protagonisten Richard Bascombe und verwebt im zweiten Titel Unabhängigkeitstag (Berlin 1995) den Besuch von gleich zwei Halls of Fame in den Handlungsstrang – die Basketball Hall of Fame in Springfield im Bundesstaat Massachusetts und die Baseball Hall of Fame in Cooperstown im Bundesstaat New York (siehe auch Denkmalpflege ab Seite 40ff.
36 Mariah Burton Nelson: „The Stronger Women Get, the More Men Love Football”, New York, 1994
37 Martin Rogers: The Story behind former Chicago Bulls Center Luc Longley’s Absence in the The Last Dance, 23. August 2021, https://www.foxsports.com/stories/nba/luc-longley-michael-jordan-chicago-bulls-last-dance-documentry-one-giant-leap zuletzt aufgerufen im Dezember 2021
38 Scottie Pippen mit Michael Arkush: Unguarded, New York, 2021
39 Jürgen Kalwa: Ehrung von Spielern – Nummer für die Ewigkeit, Deutschlandfunk, 15. August 2020