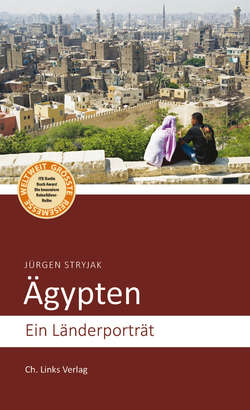Читать книгу Ägypten - Juergen Stryjak - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gestohlene Revolutionen Ägyptischer Frühling
ОглавлениеDer 8. Februar 2011 ist ein ungewöhnlich warmer Wintertag in Kairo. Mubarak-Gegner halten seit elf Tagen den Tahrir-Platz im Stadtzentrum besetzt und haben ihn in eine faszinierende Oase des zivilen Widerstands verwandelt. Manchmal sind es Zehntausende, die hier laut, bunt und entschlossen protestieren, an vielen anderen Tagen sind es Hunderttausende. Wie so oft seit dem 25. Januar, dem Beginn des Volksaufstandes gegen Präsident Hosni Mubarak, laufe ich kreuz und quer über den Platz. Auf der Suche nach einer Toilette betrete ich schließlich die Omar-Makram-Moschee. Ich muss eine Viertelstunde lang anstehen. In der Schlange vor der Toilette warten junge und alte Ägypter, sie sind bärtig oder glattrasiert, tragen Jeans oder die Gallabiyya, das traditionelle weite Kleid der Männer. Die Stimmung begeistert mich, ich schnappe die Wörter Zivilgesellschaft, Rechtsstaat und Demokratie auf, fast alle in der Schlange debattieren über Politik. Am Eingang zum Toilettentrakt sitzt ein Junge von schätzungsweise zwölf Jahren. Er trägt schmutzige, teilweise zerrissene Kleidung, vielleicht ein Straßenkind. Auch heimatlosen Straßenkindern bot der Tahrir-Platz in jenen Tagen ein Zuhause, das sie sonst nicht hatten. Als der Junge mich, den Ausländer, sieht, strahlt er übers ganze Gesicht und sagt stolz auf Englisch zu mir: »Now we are free!« – Jetzt sind wir frei!
Bis zum Rücktritt von Hosni Mubarak sollte es zwar noch drei Tage dauern, aber der Junge ist sich sicher – wie eigentlich alle auf dem Platz –, dass sie das Unvorstellbare schaffen werden. Die Erinnerung an diese Begegnung wühlt mich noch heute auf. Sie kommt mir noch immer so vor, als hätte sie gestern erst stattgefunden, ich kann das Gesicht des Jungen nicht vergessen. Nichts macht deutlicher, was den Ägypterinnen und Ägyptern in jenen Tagen die Revolution bedeutete – und warum fast alles, was danach kam, an Tragik kaum zu überbieten ist.
An jenem 8. Februar steht auf dem Tahrir-Platz auch ein älterer Mann mit grauem Bart, der ein seltsames Schild hochhält. Der Mann sieht nicht so aus, als gehöre das Internet zu seinem Alltag, aber auf der Pappe steht nur ein einziges Wort: Facebook. Auf die Frage, was er damit sagen möchte, antwortet er: »Das ist eine Facebook-Revolution, eine Revolution der Jugend, sie hat’s geschafft! Mein Dank an die Jugend Ägyptens!«
Das mit der Facebook-Revolution ist richtig und falsch zugleich. Fast alle Aktivisten, die der Revolution zu jenem Schwung verhalfen, der Mubarak am Ende aus dem Amt fegen sollte, gehören zu irgendwelchen Facebook-Gruppen. Die sozialen Netzwerke boten den Leuten eine virtuelle Zivilgesellschaft, die sie unter Mubarak im wirklichen Leben nicht hatten. Wo immer sich vor der Revolution auf der Straße ein paar Dutzend Menschen zu Protesten versammelten, wurden sie von Hunderten, manchmal Tausenden Polizisten eingekesselt und isoliert. Manche der Facebook-Gruppen haben mehrere Hunderttausend Mitglieder. »Die ägyptische Gesellschaft war in zwei Welten gespalten«, sagte mir damals die Wissenschaftlerin Ghada al-Ahdar, die seit 2001 an der Cairo University auf dem Gebiet der Cyberkultur forschte. »Es gab so viele Zwänge, dass die Menschen an politischen Prozessen gar nicht teilnehmen konnten. Außerhalb der systemtreuen Eliten existierte keine politische Kultur. Facebook hat die Kultur verändert.« Im Internet diskutierten säkulare Ägypter plötzlich mit jungen Muslimbrüdern, Liberale mit Linken, Männer mit Frauen, Universitätsprofessoren mit Handwerkern – und sie erlebten nicht selten, dass sie mehr verbindet als trennt. Jetzt mussten sie die Wut über die Verhältnisse, ihre Energie und die Sehnsucht nach Veränderung nur noch irgendwie auf die Straße tragen, ins wirkliche Leben.
Dass dies gelang, ist dem Mubarak-Regime zu verdanken. In der Nacht vom 27. zum 28. Januar 2011 stellte es landesweit das Internet fast komplett ab. Der Volksaufstand gegen Mubarak hatte am 25. Januar begonnen, mit einer ersten Demonstration von mehreren Zehntausend Leuten. Deshalb nennen Ägypter die Revolution auch, obwohl sie 18 Tage lang dauerte, Thauret 25. Janair, die Revolution vom 25. Januar. Für den 28. Januar war zu einem Tag des Zorns aufgerufen worden. Der Aufruf ging gerade noch so wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netzwerke, dann war das Internet plötzlich weg. Wer jetzt wissen wollte, was an jenem Tag passierte, musste rausgehen. Und es waren tatsächlich Hunderttausende, die im ganzen Land auf die Straße gingen, nicht nur in Kairo, sondern auch in Alexandria, Port Said, Ismailia und vielen anderen Städten. »Die User hatten im Internet einen bestimmten Umgang miteinander gelernt«, erzählt Ghada al-Ahdar, »nun dachten sie: Genau so verhalten wir uns auch in der Realität, jetzt erst recht.«
Der 28. Januar, ein Freitag, wird zu dem Tag, an dem die Menschen ihre Angst besiegen. Am Morgen schaltet das Regime auch die Handynetze ab. Kurz zuvor empfing ich noch eine jener Kurzmitteilungen, die Aktivistengruppen massenhaft verschickten: »Versammelt Euch vor den Moscheen und Kirchen! Bildet Demonstrationszüge! Verzichtet auf religiöse Symbole!« Als ich kurz nach Mittag am Talaat-Harb-Platz im Stadtzentrum unterwegs bin, biegen aus den Seitenstraßen Demonstranten auf die Hauptstraße ein, erst in kleinen Gruppen, die aber schnell anwachsen. Viele singen die Nationalhymne. Wenn Demonstrationszüge aufeinandertreffen und sich vereinen, jubeln die Massen. Die Sicherheitskräfte zünden Tränengasgranaten. Auf der Flucht vor dem Tränengas frage ich einen jungen Demonstranten im Laufschritt, ob er denn keine Angst habe. »Ich habe mehr Angst um mein Land als um mich«, ruft er ohne zu zögern. »Wir leben wie zu Pharaonenzeiten«, sagt ein anderer zornig, »aber heute jagen die Sklaven die Pharaonen weg.« Als ich Stunden später zurück ins ARD-Studio komme, sehe ich auf allen Brücken über den Nil machtvolle Demonstrationszüge, die sich Richtung Tahrir-Platz bewegen. Nach Einbruch der Dunkelheit brennt ein paar Häuser weiter das Hochhaus von Mubaraks Regierungspartei. Niemand löscht das Feuer.
Die Ziele der Proteste waren vor Beginn der ersten Demonstration im Internet veröffentlicht worden, von den Aktivisten der Protestbewegung 6. April zum Beispiel. Sie forderten die Einführung eines Mindestlohns, die Aufhebung der Notstandsgesetze sowie die Absetzung von Innenminister Habib al-Adly, den viele Menschen für die Polizeigewalt der vergangenen Jahre verantwortlich machten. Doch innerhalb weniger Tage, ja Stunden, nachdem es losging, schmolzen alle diese Ziele zu einem einzigen Sprechchor zusammen: »Ash-shaab yurid isqat an-nizam.« – Das Volk will den Sturz des Regimes. Auf dem Tahrir-Platz erzählen mir die Leute, welche Veränderungen sie vom Sturz des Regimes erhoffen. »Wir wollen ein System wie in Deutschland oder Schweden, mit Krankenversicherung und Kinderbetreuung«, fordert eine Ägypterin, »ich muss ein ganzes Jahr arbeiten, um die Schule meiner Kinder bezahlen zu können. Wenn einer bei uns seine Meinung sagt, wird er geschlagen. Wir wollen, dass Ägypten endlich ein ganz normales Land wird.« Die Revolution hat zwar eine Vielzahl von Aktivisten, aber nicht wirklich einen Anführer. Es gibt auf dem Tahrir-Platz noch niemanden, der die politische Gesinnung der Leute für seine Zwecke missbraucht. »Das ist ein Volksaufstand«, erklärt mir ein älterer Mann auf dem Platz, »Mubarak hat uns gespalten, hier die Muslime, dort die Christen, hier diese politische Strömung, dort eine andere – damit sich am Ende die Leute gegenseitig auffressen und Mubarak die Macht behalten kann.«
Bei den Protesten auf dem Tahrir-Platz, aber auch an anderen Orten in der Stadt taucht auf Plakaten und Flugblättern eine Graphik auf, die eine drahtige, kraftvolle Faust zeigt, mal weiß auf schwarzem Untergrund, mal umgekehrt, seltener auch schwarz auf blutrotem Grund. Es ist das Logo der serbischen Aktivistengruppe Otpor!, auf Deutsch Widerstand, die im Jahr 2000 maßgeblich am Sturz von Slobodan Milošević beteiligt war. Die jungen Ägypter der Bewegung 6. April ließen sich von der Taktik der Serben nicht nur inspirieren, sie hatten auch Kontakt zu ihnen. 2009 besuchte der Blogger Muhammed Adel, damals Anfang 20, in Belgrad das Zentrum für Angewandte Gewaltfreie Aktion und Strategie (CANVAS). »Bei dem Training bekam ich erklärt, wie man friedliche Demonstrationen organisiert, wie man Gewalt vermeidet und wie man der Gewalt der Sicherheitskräfte begegnet«, schilderte er in einer Dokumentation des Fernsehsenders Al Jazeera English. Gewaltfreiheit ist für die Wortführer unter den ägyptischen Aktivisten ein wichtiges Element. Einzelne gewalttätige Akte unter Hunderttausenden von Demonstranten, selbst wenn es sich nur um Steinwürfe handelt, würden nicht nur die Gegengewalt der Sicherheitskräfte provozieren. Sie würden auch der Propaganda des Regimes Argumente dafür liefern, die Demonstranten pauschal als Unruhestifter und Kriminelle zu verunglimpfen. Und sie würden die Berichterstattung beherrschen. Viele Demonstranten haben diese Idee verinnerlicht. Beim Beginn der sogenannten Schlacht der Kamele auf dem Tahrir-Platz am 2. Februar beobachte ich, wie sich Demonstranten dem Steinhagel eines Mubarak-treuen Mobs mit erhobenen Händen entgegenstellen, zumindest am Anfang. An einem anderen Tag löst sich vor dem Gebäude des Staatsfernsehens ein Demonstrationszug mit mehreren Tausend Teilnehmern innerhalb von Minuten auf, als plötzlich Steine fliegen.
Dieser Kontakt zu ausländischen Gruppen wie Otpor! kommt dem Mubarak-Regime gelegen. In den staatstreuen Medien wird zum ersten Mal jener Vorwurf erhoben, den man in den Jahren danach immer wieder hören sollte: Die Regimegegner seien vom Ausland bezahlte Agenten, die Ägypten ins Chaos stürzen sollen. Das ist Unsinn. Die Menschen gehen nicht auf die Straße, weil sie dafür 20 US-Dollar und kostenlose Lunchboxen der Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken erhalten, wie in den Medien behauptet wird. Sie bekommen weder das eine noch das andere, sie demonstrieren, weil sie die Verhältnisse satt haben und endlich nach Jahren der Stagnation einen Wandel wollen. Die Demonstranten reagieren dann auch mit Humor auf die absurdesten Anschuldigungen. An jenem 8. Februar begegnet mir auf dem Tahrir-Platz ein junger Demonstrant mit langen, zotteligen, schwarzen Locken. Auf der Spruchtafel in seiner rechten Hand steht: »Ich habe heute noch kein Kentucky Fried Chicken bekommen.« Seine linke Hand hält eine Tafel mit dem Satz: »Bringt es endlich zu Ende, damit ich zum Friseur gehen kann.«
Junge gebildete Aktivisten aus der Mittel- und der Oberschicht sind die treibende Kraft bei den Protesten, aber ohne die Arbeiter, Handwerker und Tagelöhner aus den Armenvierteln, aus Imbaba, Boulaq ad-Dakrour und anderen Stadtteilen, hätte der Volksaufstand nie eine kritische Masse erreicht. Allerdings auch nicht ohne die Mitglieder der Muslimbruderschaft, der seit Jahrzehnten stärksten Oppositionsgruppierung im Land. Sie ist eine soziale, religiöse Bewegung und sollte mindestens bis zum Militärputsch 2013 auch eine straff hierarchisch geführte Kaderorganisation mit ergebenen Anhängern bleiben. Die Bruderschaft schließt sich den Protesten in den ersten Tagen nur zögerlich an. Über Jahrzehnte engagierte sie sich politisch zumeist nur innerhalb der Grenzen, die das Mubarak-Regime zog, um keine Massenverhaftungen oder andere Repressalien zu riskieren. In seinem Buch »Arab Fall: How the Muslim Brotherhood Won and Lost Egypt in 891 Days« beschreibt Eric Trager, wie am Abend des 25. Januar 2011, dem ersten Tag der Proteste, drei junge Muslimbrüder ins Führungsbüro der Bruderschaft eilen und den obersten Funktionären vom Ausmaß der Proteste auf dem Tahrir-Platz berichten, unter ihnen Islam Lotfy. Mohammed Mursi, der anderthalb Jahre später zum Präsidenten Ägyptens gewählt werden sollte, reagiert zornig: »Wie könnt ihr es wagen, auf den Platz zu gehen, ohne die Führung zu informieren.« Auch am zweiten Tag der Demonstrationen ruft die Führungsriege noch nicht zur Teilnahme auf. Erst am dritten Tag weist die Bruderschaft ihre Mitglieder an, sich den Protesten am darauffolgenden Tag anzuschließen. Wie mir Islam Lotfy und etliche andere junge Muslimbrüder später erzählen, ist das Zögern der Bruderschaftsführer angesichts der gerade entstehenden Volksbewegung, die auch viele junge Muslimbrüder faszinierte, die erste von vielen Enttäuschungen. Auf dem Tahrir-Platz schließen sie sich den säkularen, linken, liberalen und anderen Aktivistinnen und Aktivisten an. Die Bedeutung dieses Schulterschlusses mit Andersdenkenden kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Viele junge Muslimbrüder machen auf dem Tahrir-Platz in Kairo und in anderen Städten die Erfahrung ihres Lebens. In jenen Tagen, aber auch in den Monaten danach bekommt man eine Ahnung davon, dass die Aussicht auf Freiheit und eine moderne Zivilgesellschaft auch einer islamistischen Organisation wie der Muslimbruderschaft mit ihrer starren Ideologie zum Verhängnis werden könnte.
Am 2. Februar 2011, dem neunten Tag der Revolution, bäumt sich das Mubarak-Regime zum letzten Mal auf. Als Tausende Mubarak-Anhänger zum Tahrir-Platz strömen, schickt das Regime auch Schlägertrupps, unter anderem auf Kamelen und Pferden. Was dann beginnt, wird fortan Mawqat al-gamal, Schlacht der Kamele, genannt, obwohl die Reiter mit ihren Tieren schnell wieder verschwinden. Einen ganzen Tag lang versuchen die Schlägertrupps, die Regimegegner vom Platz zu vertreiben, vor allem abends, in der Nacht und am darauffolgenden Morgen. Sie bewerfen die Demonstranten mit Steinen und schleudern von Hausdächern Brandbomben mitten in die Menge. Hinter dem Ägyptischen Museum reihen sich Schlägertrupps in der Dunkelheit mit Fackeln in den Händen in Marschordnung auf. Die Demonstranten holen große Bleche von einer nahen Baustelle, mit denen sie sich vor den Steinen schützen und die Schlägertrupps daran hindern, auf den Platz vorzudringen. Im Rhythmus klopfen sie auf die Bleche und bewerfen die Angreifer ebenfalls mit Pflastersteinen. Bäume geraten in Brand, kurz vor Mitternacht sehe ich, wie ein Mensch brennend über die Straße läuft. Vom Hilton Ramsis Hotel aus kann ich das Geschehen aus nächster Nähe beobachten. Wir hatten am Nachmittag aus dem nahen ARD-Studio dorthin fliehen müssen, weil ein Mubarak-treuer Mob unser Gebäude stürmen wollte. Im Hotelrestaurant blubbert am Abend ein Schokoladenbrunnen, Gäste sitzen beim Abendessen, während sich draußen vor dem Hotel apokalyptische Szenen abspielen.
Die Schlägertrupps, die damals auch die Tahrir-Demonstranten angriffen, nennen Ägypter Baltagiyya. Es sind rohe, skrupellose Männer, die bereit sind, für ein paar ägyptische Pfund politische oder andere Gegner zu attackieren. Ein Baltagi stammt oft aus einem Armenviertel. Rekrutiert wird er von Günstlingen des Regimes, zum Beispiel von wohlhabenden Geschäftsleuten, von Parlamentsabgeordneten oder sogar von der Polizei. Bei der Schlacht der Kamele wurde ihr Einsatz gegen die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz offenbar auf höchster Ebene beschlossen. Am Nachmittag ruft mich ein ägyptischer Freund an, um mir zu berichten, was er kurz zuvor erlebte. Aus seinem Fahrzeug heraus sah er, wie Polizisten in Uniform Autos anhielten und die Fahrer zwangen, Baltagiyya zum Tahrir-Platz zu bringen. Mein Freund konnte gerade noch rechtzeitig in eine Seitenstraße entweichen. Am nächsten Morgen beobachte ich vom Hotelfenster aus, wie Baltagiyya-Schlägertrupps mit Bussen angekarrt werden. Jedes Mal, wenn ein Bus auf der Brücke am Platz hält, salutiert auf der Straße ein Mann in Zivil in Richtung Fahrer. Der öffnet die Türen, die Baltagiyya steigen aus, laufen geschlossen runter zum Platz – und beginnen dort ihr brutales Geschäft. Das ägyptische Nachrichtenportal Ahram Online berichtet später, dass jeder der Schläger Lebensmittel, Tramadol-Schmerztabletten und zwischen 50 und 500 Ägyptische Pfund erhielt. Das entsprach damals zwischen 6 und 60 Euro. Für den Fall, dass es ihnen tatsächlich gelingen würde, die Demonstranten vom Platz zu vertreiben, hatte man jedem Baltagi eine Erfolgsprämie von umgerechnet 600 Euro versprochen. Aber die Schlägerbanden scheitern. Die Demonstranten können den Tahrir-Platz erfolgreich verteidigen. Polizei und Sicherheitskräfte ziehen sich zurück, nicht nur in Kairo, sondern im ganzen Land. Was danach auf dem Tahrir-Platz beginnt, ist ein Art Volksfest, das mehr als eine Woche lang andauert, bis zum Rücktritt Mubaraks. Der Platz wird zum Schauplatz einer riesigen Werbeaktion für die Freiheit.
Am 8. Februar laufe ich von der Qasr-al-Nil-Brücke hinüber. Am Zugang zum Platz muss ich einen Checkpoint der Sicherheitskräfte passieren, dann kommen Drahtzäune, ein paar Spanische Reiter und ein schmaler Streifen Niemandsland. Dahinter kontrollieren Demonstranten die Ausweise und die Taschen von jedem, der auf den Platz möchte, andere begrüßen die Neuankömmlinge mit Beifall und Musik. Ein Mann spielt die Oud, die arabische Laute. Eine kleine Aktivistengruppe singt dazu: »Gebt uns die Ehre, leistet uns Gesellschaft. Das ist unsere und eure Freiheit.« Der Platz wird gefegt und geschmückt. Er ist alles zugleich, Protestcamp und Politkirmes, Kulturfestival und Sozialstation. An einer Ecke sind Plakate, Bilder und Revolutionskunst zu sehen, an der nächsten Standup-Comedians. Ärzte behandeln Bedürftige kostenlos, auf einer Bühne treten Musiker auf – und Redner, denn jeder, der möchte, darf zu den Menschen sprechen. Sie sollten abends heimkehren und schwärmen: »Ihr müsst euch das unbedingt angucken, der blanke Wahnsinn.«
Sherif Mekkawi gehört zu jenen Aktivisten, die den Platz besetzt halten. Er organisiert die Infrastruktur und führt mich durch die Behelfstoiletten, die in einem Untergeschoss des Platzes installiert wurden. Gerade sei man dabei, Duschen einzubauen. Niemand weiß, wie lange die Besetzer auf dem Platz noch ausharren müssen. Das Regime führt bereits Gespräche mit handverlesenen Oppositionellen, unter anderem von der Muslimbruderschaft, aber diese Oppositionellen haben nicht wirklich etwas mit den Protesten auf dem Platz zu tun. Das Regime versucht zu retten, was zu retten ist, ein allerletzter Versuch, diesmal mit pseudodiplomatischen Mitteln statt mit Gewalt. Sherif Mekkawi hat dafür nur Spott übrig: »Das ist doch nur die Karikatur einer ›Opposition‹. Von uns ist keiner dabei. Die echte Opposition ist hier auf dem Platz. Wer mit uns reden will, muss herkommen.« Dann sagt er etwas, an das ich in den Jahren danach immer wieder denken sollte: »Das Militär hat bereits damit begonnen, die Macht zu übernehmen und seine Leute in hohe Ämter zu bringen. Aber wir werden nicht aufgeben, wir sind bereit, hier zu sterben.«
In der Erinnerung wirken jene Revolutionstage auf dem Tahrir-Platz wie ein romantischer Traum, wie eine Illusion so grell, dass sie blind macht und später immer mehr verklärt wird. Aber diese Tage sind real. Sie zeigen einen kurzen Moment lang, was möglich ist, sobald die Leute das Gefühl haben, dass sie sich ihr Land endlich zurückholen können. Wenn ägyptische Christen auf dem Platz Messen zelebrieren, dann bilden Muslime zum Schutz eine Menschenkette um die Betenden. Und umgekehrt genauso. Freundschaften werden geschlossen zwischen Leuten, die sich sonst nie begegnet wären. Freiwillige räumen den Müll weg. Apotheker versorgen Menschen kostenlos mit Medikamenten.
Der junge Lyriker Mostafa Ibrahim, damals Mitte 20, erzählt mir später, wie er während der Revolution in den Räumen des kleinen, unabhängigen Merit-Verlags unweit des Tahrir-Platzes übernachtete, zusammen mit Dutzenden anderen. »Wir schliefen auf Matratzen. Da drüben steht noch der Schrank, in dem wir alle unsere Sachen hatten«, er zeigt in eine Ecke des Raumes und lacht, »der Revolutionsschrank gewissermaßen. Mohamed Hashem, mein Verleger, hat Unmengen an Lebensmitteln und Decken herbeigeschafft. Wir halfen ihm, das alles zum Platz zu bringen. Wahrscheinlich hat er fast sein gesamtes Geld dafür ausgegeben.«
Mostafa Ibrahim schrieb damals ein Gedicht, das mehr als hunderttausend Mal im Internet angeklickt wurde. Es heißt »Safinet Noh«, auf Deutsch »Arche Noah«. Damit ist der Tahrir-Platz während der Revolution gemeint, der damals 2011 gewissermaßen all jene aufnahm, die nach dem Untergang des Mubarak-Regimes ein neues Leben und ein neues Land aufbauen wollten:
»O Volk das nicht länger verharrte / Nimmst das Recht in Deine Hände / O Heimat die uns keinen Platz bot / Wir sind es, die Dich nun aufnehmen / Das Blut ist von einer einzigen Farbe / kennt weder Knecht noch Herrn / Verratet Ihr das Blut des Märtyrers / Habt Ihr Euch morgen selber verraten.«
Das klingt pathetisch, spiegelt aber genau das wider, was viele empfanden. Damals begegneten mir ständig Ägypterinnen und Ägypter, die sich zum ersten Mal im Leben nicht mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt und fremd im eigenen Land fühlten.
Drei Tage später, am 11. Februar 2011, treffe ich abends kurz nach 17 Uhr am Präsidentenpalast im Stadtteil Heliopolis ein, wo sich rund 20 000 Demonstranten versammelt haben. Ich spreche mit Leuten, schaue mir das Treiben an, als plötzlich um 18.02 Uhr die Menschen unruhig werden. Langsam braust Jubel auf, der immer lauter wird. Eine junge Frau neben mir greift zum Handy und ruft eine Freundin an. »Was? Er ist zurückgetreten?«, schreit sie ins Telefon. »Mubarak ist nicht mehr Präsident? Ägypten, endlich ist Ägypten frei – nachdem uns dieser Verbrecher 30 Jahre lang fast erstickt hat!«
Die rund zehn Kilometer zurück ins ARD-Studio unweit des Tahrir-Platzes muss ich laufen. Der Verkehr ist zusammengebrochen, auf allen Straßen feiern Leute. Aus einem Hotel bringen Kellner Tabletts voller Gläser mit Zitronensaft raus auf die Straße und verschenken ihn. Alle paar Meter klopft mir einer auf die Schulter oder umarmt mich. »Ich bin so froh, dass Mubarak endlich weg ist«, schwärmt eine Ägypterin, »ich erwarte, dass jetzt erstmal die Armee übernimmt und für etwas Ordnung sorgt.« Als ich gegen 23 Uhr im Studio eintreffe, schickt mir mein ägyptischer Freund ein Selfie. Es zeigt ihn auf einer Nil-Brücke, die zum Tahrir-Platz führt. Im Hintergrund ist mein Bürogebäude zu sehen, auf dem Dach die riesige Leuchtreklame einer Immobilienfirma mit dem Slogan: »Better home«. Unter das Foto schreibt er: »Jetzt ist Ägypten wirklich ein besseres Zuhause.«
Viele Ägypter sind stolz. Die Tahrir-Revolution wird überall auf der Welt bewundert und findet später Nachahmer. In Barcelona zum Beispiel oder in Tel Aviv wird bei Massenprotesten der Geist des Tahrir-Platzes beschworen. Walk like an Egyptian, so heißt es plötzlich bei Demonstrationen auf anderen Kontinenten. Kurz nach dem Sturz Mubaraks, als die Euphorie noch frisch ist, wirbt der ägyptische Mobilfunknetzbetreiber Mobinil mit einem Zitat von US-Präsident Barack Obama: »Wir müssen unsere Kinder so erziehen, dass sie wie die jungen Ägypter werden.«
Das Obama-Zitat stimmt nicht. Es findet sich nirgends ein Hinweis darauf, dass Obama tatsächlich gesagt hat, die US-Amerikaner sollten ihre Kinder so erziehen, dass aus ihnen Menschen würden, die so sind wie die jungen Ägypter – die sich gerade erfolgreich gegen ihren Autokraten erhoben hatten. Dalia Mogahed, die in Kairo geboren wurde und im Alter von vier Jahren in die USA kam, gehörte ein Jahr lang zu einem Beraterteam Obamas im Weißen Haus. In einem Interview sagte sie: »Ich glaube nicht, dass der Präsident dies wirklich gesagt hat. Der entscheidende Punkt ist, dass die Ägypter dachten, er hätte das gesagt. Es hat sie mit Stolz erfüllt.«
Anderthalb Tage nach dem Sturz Mubaraks putzen Freiwillige den Tahrir-Platz und räumen den letzten Müll weg, Plastikflaschen, alte Decken, Pappen und Papier. Andere streichen die Bordsteine, jetzt ist es endlich ihr Land, um das sie sich kümmern wollen. Der Platz ist längst wieder für den Verkehr geöffnet. Die Demonstranten sind verschwunden, bis auf eine kleine Gruppe, die auf einer übriggebliebenen Bühne vor dem Hardees-Fastfood-Restaurant steht und Sprechchöre skandiert. Einer der letzten Demonstranten ist Aly Bilal, schätzungsweise Mitte 20. Ich frage ihn, warum er den Platz nicht verlässt. »Ich habe Angst«, erwidert er mit Tränen in den Augen. »Ich werde nicht eher zu meiner Arbeit zurückkehren, bevor ich nicht überzeugt davon bin, dass mein Land in sicheren Händen ist. Es ist noch nicht in sicheren Händen.« Den meisten Ägyptern würden Aly Bilals Ängste wohl völlig absurd vorkommen. Zu großartig erscheint ihnen der Erfolg der friedlichen Revolution. Aber dieses Gefühl basiert auf Selbsttäuschung.