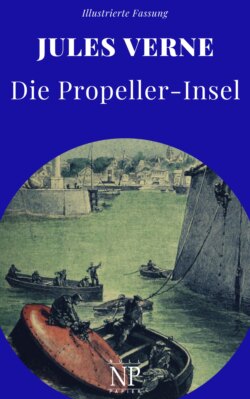Читать книгу Die Propeller-Insel - Jules Verne, Jules Verne - Страница 10
Zweites Kapitel – Die Wirkung einer kakophonischen Sonate
ОглавлениеIm Finstern und zu Fuß auf unbekannter Straße hinzuziehen, obendrein inmitten einer fast öden Gegend, wo Übeltäter im Allgemeinen weniger selten sind als Reisende, hat immer etwas Beunruhigendes an sich. In dieser Lage befand sich nun unser Quartett. Franzosen sind ja am Ende mutig, und die hier sind es in besonderem Maße. Doch zwischen dem Mute und der Furchtsamkeit verläuft noch eine Scheidelinie, die von der gesunden Vernunft nicht übersehen werden darf. Wäre die Eisenbahn nicht durch eine von plötzlichem Hochwasser überflutete Gegend verlaufen und wäre die Kutsche fünf Meilen vor Freschal nicht umgestürzt, so hätte sich unsere kleine Künstlerschar nicht in die Zwangslage versetzt gesehen, des Nachts auf dieser verdächtigen Straße hinzuwandern. Hoffen wir indes, dass ihnen dabei kein Unheil zustößt.
Es ist etwa um acht Uhr, als Sébastien Zorn und seine Kameraden, den Weisungen des Wagenführers entsprechend, die Richtung nach der Küste zu einschlagen. Da die Violinen nur in leichten, wenig umfänglichen Lederetuis stecken, haben die Geiger keine besondere Ursache, sich zu beklagen. Sie tun das auch nicht, weder der weise Frascolin, noch der lustige Pinchinat oder der idealistisch angehauchte Yvernes. Der Violoncellist aber mit seinem umfänglichen Instrumentenkasten, der hat etwas wie einen Schrank auf dem Rücken. Bei seinem uns bekannten Charakter ist es nicht zu verwundern, dass er darüber weidlich wettert und schimpft. Daneben ächzt und stöhnt der Mann, was sich unter der onomatopoetischen Form von Ahs! Ohs! und Uffs! hörbar macht.
Schon herrscht eine tiefe Finsternis. Dicke Wolken jagen über das Himmelsgewölbe, die manchmal da und dort etwas zerreißen und dann eine spöttische Mondsichel kaum im ersten Viertel hindurchscheinen lassen. Man weiß nicht, warum – wenn nicht deswegen, weil er einmal in bissiger, reizbarer Stimmung ist – die blonde Phöbe nicht das Glück hat, unserem Sébastien Zorn zu gefallen. Er streckt ihr aber die geballte Faust entgegen und ruft:
»Na, was hast denn du mit deinem einfältigen Gesichte vor?… Nein, wirklich, ich kenne nichts Alberneres, als diese Schnitte einer unreifen Melone, die da oben hinspaziert!«
»Es wäre freilich besser, wenn der Mond uns das volle Gesicht zukehrte«, meinte Frascolin.
»Und warum das?« fragte Pinchinat.
»Weil wir da besser sehen könnten.«
»O, du keusche Diana, du friedliche Nachtwandlerin, du bleicher Satellit der Erde, o du angebetetes Ideal des anbetungswürdigen Endymion1 …«
»Bist du fertig mit deiner Verhimmelung?« ruft der Violoncellist. »Wenn diese ersten Geigen erst anfangen, weit auf der Quinte herunterzurutschen …«
»Etwas schneller vorwärts«, fiel Frascolin ein, »sonst haben wir das Vergnügen, noch unter freiem Himmel zu übernachten …«
»Wenn freier Himmel wäre … und dazu noch unser Konzert in San Diego zu versäumen!« bemerkt Pinchinat.
»Wahrhaftig, ein hübscher Gedanke!« ruft Sébastien Zorn, der seinen Kasten schüttelt, dass er einen kläglichen Ton von sich gibt.
»Doch dieser Gedanke, mein alter Kamerad«, sagt Pinchinat, »rührt ursprünglich von dir her …«
»Von mir …?«
»Gewiss! Warum sind wir nicht in San Franzisko geblieben, wo wir Gelegenheit hatten, eine ganze Sammlung kalifornischer Ohren zu ergötzen!«
»Nun«, fragt der Violoncellist, »warum sind wir dann fortgegangen?«
»Weil du es so wolltest.«
»Dann muss ich gestehen, eine beklagenswerte Eingebung gehabt zu haben, und wenn …«
»Ah, seht einmal da!« fällt Yvernes ein, der mit der Hand nach einem bestimmten Punkte des Himmels weist, wo ein dünner Mondstrahl die Ränder einer Wolke mit weißlicher Einfassung säumt.
»Was gibt es denn, Yvernes?«
»Zeigt jene Wolke nicht ganz die Gestalt eines Drachens mit ausgebreiteten Flügeln und einem Pfauenschwanze mit hundert Argusaugen darauf?«
Jedenfalls ist Sébastien Zorn nicht mit der Fähigkeit, hundertfältig zu sehen, ausgerüstet, die den Hüter der Tochter des Inachos auszeichnete, denn er bemerkt nicht ein tief ausgefahrenes Gleise, worin er unglücklicherweise mit dem Fuße hängenbleibt. Dadurch fällt er platt auf den Leib, sodass er mit seinem Kasten auf dem Rücken einer großen Coleoptere gleicht, die auf der Erde hinkröche.
Natürlich kommt der Instrumentalist wieder in Wut – er hat ja auch alle Ursache dazu – und schimpft auf die erste Violine wegen deren Bewunderung ihres in der Luft schwebenden Ungeheuers.
»Da ist nur der Yvernes dran schuld!« fährt Sébastien Zorn auf. »Hätte ich nicht nach seinem verwünschten Drachen gesehen …«
»Es ist gar kein Drache mehr, liebe Freunde, sondern jetzt nur noch eine Amphora! Mit einigermaßen entwickelter Fantasie bemerkt man sie in der Hand der Nektar einschenkenden Hebe …«
»Doch denken wir daran, dass in jenem Nektar verteufelt viel Wasser ist«, ruft Pinchinat, »und hüten wir uns, dass deine reizende Göttin der Jugend nicht ein Sturzbad über uns ausgießt!«
Das hätte die Lage der Wanderer freilich noch verschlimmert, und tatsächlich fängt das Wetter an, mit Regen zu drohen. Die Vorsicht treibt also zur Eile, um in Freschal rechtzeitig Schutz zu finden.
Man hebt den zornschnaubenden Violoncellisten auf und stellt den Brummbär wieder auf die Füße. Der freundliche Frascolin erbietet sich, ihm seinen Kasten abzunehmen. Sébastien Zorn will das zuerst nicht zugeben … er, sich von seinem Instrumente trennen … einem Violoncell von Gaud und Bernardel … das heißt ja, von einer Hälfte seines Selbst … Er muss sich aber fügen, und somit geht diese kostbare Hälfte auf den Rücken des dienstwilligen Frascolin über, der dafür sein leichtes Etui genanntem Zorn anvertraut. Nun geht es weiter und raschen Schrittes zwei Meilen vorwärts, ohne dass sich etwas Besonderes ereignet. Die mit Regen drohende Nacht wird immer finsterer. Schon fallen einige große Tropfen, der Beweis, dass sie aus hochziehenden, gewitterhaften Wolken stammen. Die Amphora der hübschen Hebe unseres Yvernes entleert sich jedoch nicht weiter, und die vier Nachtwandler dürfen hoffen, Freschal im Zustande vollständiger Trockenheit zu erreichen.
Immerhin bedarf es noch peinlichster Aufmerksamkeit, um auf dieser finsteren Straße nicht zu Fall zu kommen, denn abgesehen von den tiefen Wagenspuren verläuft sie oft in scharfen Krümmungen um vorspringende Felsmassen oder führt neben düsteren Schluchten hin, aus denen der Trompetenton der Berggewässer heraufschallt. Wenn Yvernes das bei seiner Sinnesveranlagung poetisch findet, so nennt es Frascolin bei der seinigen mindestens beunruhigend.
Daneben waren noch unliebsame Begegnungen zu fürchten, die die Sicherheit aller Reisenden auf den Landstraßen Niederkaliforniens sehr zweifelhaft machen. Das Quartett besaß an Waffen aber nur die drei Violin- und den einen Violoncellbogen, die in einem Lande, wo der Colt’sche Revolver erfunden und damals noch erheblich verbessert worden war, doch als etwas unzureichend erscheinen dürften. Wären Sébastien Zorn und seine Kameraden Amerikaner gewesen, so würden sie sich jedenfalls mit dieser handlichen Schutzwaffe versehen haben, die man dortzulande immer in einer besonderen kleinen Hosentasche bei sich trägt. Um auch nur auf der Bahn von San Franzisko nach San Diego zu fahren, würde sich kein waschechter Yankee ohne diesen sechsschüssigen Begleiter auf die Reise begeben haben. Unsere Franzosen hatten das freilich nicht für nötig erachtet. Fügen wir hinzu, dass sie daran gar nicht gedacht und es doch vielleicht zu bereuen haben dürften.
Pinchinat marschiert an der Spitze und behält die Böschungen der Straße scharf im Auge. Wo diese von rechts und links her sehr eingeengt erscheint, ist ein unerwarteter Überfall weniger zu fürchten. Als Bruder Lustig wandelt ihn immer einmal das Verlangen an, seinen Kameraden »einen gelinden Schrecken einzujagen«, z.B. dadurch, dass er plötzlich stehenbleibt und mit vor Schreck bebender Stimme murmelt:
»Halt! … Da unten … was seh ich da?… Halten wir uns fertig, Feuer zu geben!«
Wenn der Weg sich aber durch einen dichten Wald hinzieht, inmitten der Mammutbäume, der hundertfünfzig Fuß hohen Sequoias, jener Pflanzenriesen des kalifornischen Landes … dann vergeht ihm selbst die Lust zum Scherzen. Hinter jedem dieser ungeheuren Stämme können sich bequem zehn Mann verbergen. Sollten sie hier nicht das Aufblitzen eines hellen Scheines, dem ein trockner Knall folgt, zu sehen, nicht das schnelle Pfeifen einer Kugel zu hören bekommen? An solchen, für einen nächtlichen Überfall wie geschaffenen Stellen heißt es die Augen offen halten. Und wenn man zum Glück nicht mit Banditen zusammenstößt, so rührt das daher, dass diese ehrsame Zunft aus dem Westen Amerikas ganz verschwunden ist oder sich jetzt nur noch Finanzoperationen an den Märkten der Alten und der Neuen Welt widmet. Welches Ende für die Nachkommen eines Karl Moor,2 eines Johann Sbogar! Und wem sollten derlei Gedanken kommen, wenn nicht unserem Yvernes? Entschieden – meint er – ist das Stück der Dekoration nicht wert!
Plötzlich bleibt Pinchinat wie angewurzelt stehen.
Frascolin tut desgleichen.
Sébastien Zorn und Yvernes gesellen sich sofort zu beiden.
»Was gibt es?« fragt die zweite Violine.
»Ich glaubte, etwas zu sehen …«, antwortete die Bratsche.
Diesmal handelt es sich nicht um einen Scherz seinerseits. Offenbar bewegt sich eine Gestalt zwischen den Bäumen hin.
»Eine menschliche oder tierische?« erkundigt sich Frascolin.
»Das weiß ich selbst nicht.«
Was jetzt am besten zu tun sei, das unterfing sich niemand zu sagen. Dicht aneinandergedrängt starren alle laut- und bewegungslos vor sich hin.
Dicht aneinandergedrängt
Durch einen Wolkenspalt fließen die Strahlen des Mondes auf den Dom des dunkeln Waldes herab, dringen durch die Äste der Sequoias und erreichen noch den Erdboden. Im Umkreis von hundert Schritten ist dieser etwas sichtbar.
Pinchinat hat sich nicht getäuscht. Zu groß für einen Menschen, kann diese Masse nur einem gewaltigen Vierfüßler angehören. Doch welchem Vierfüßler?… Einem Raubtiere?… Jedenfalls einem solchen … doch welchem Raubtiere?
»Ein Plantigrade!«3 sagt Yvernes.
»Zum Teufel mit dem Vieh«, murmelt Sébastien Zorn mit verhaltener, aber grimmiger Stimme, »und mit dem Vieh meine ich mehr dich, Yvernes! … Kannst du nicht wie andere vernünftige Menschen reden! Was ist denn das, ein Plantigrade?«
»Ein Tier, das auf vier Tatzen, und zwar auf den ganzen Sohlen läuft«, erklärt Pinchinat.
»Ein Bär!« setzt Frascolin hinzu.
Es war in der Tat ein Bär, und zwar ein ganz mächtiges Exemplar. Löwen, Tigern oder Panthern begegnet man in den Wäldern Nieder-Kaliforniens nicht. Deren gewöhnliche Bewohner sind nur die Bären, mit denen, wie man zu sagen pflegt, nicht gut Kirschen essen ist.
Man wird sich nicht verwundern, dass unsere Pariser in voller Übereinstimmung den Gedanken hatten, diesem Plantigraden den Platz zu überlassen, der ja eigentlich »bei sich zu Hause« war. So drängt sich unsere Gruppe denn noch dichter zusammen und marschiert langsam, doch in strammer Haltung und das Aussehen von Fliehenden vermeidend, mit dem Gesicht nach dem Raubtiere gewendet rückwärts.
Der Bär trottet kurzen Schrittes den Männern nach, wobei er die Vordertatzen gleich Telegrafenarmen bewegt und in den Pranken schwerfällig hin- und herschwankt. Allmählich kommt er näher heran und sein Verhalten wird etwas feindseliger … sein heiseres Brummen und das Klappen der Kinnladen sind ziemlich beunruhigend.
»Wenn wir nun alle nach verschiedenen Seiten Fersengeld gäben?« schlägt Seine Hoheit vor.
»Nein, das lassen wir bleiben«, antwortet Frascolin. »Einer von uns würde doch von dem Burschen gehascht und müsste allein für die anderen zahlen.«
Diese Unklugheit wurde nicht begangen, und es liegt auch auf der Hand, dass sie hätte schlimme Folgen haben können.
Das Quartett gelangt so als »Bündel« an die Grenze einer minder dunkeln Waldparzelle. Der Bär hat sich jetzt bis auf zehn Schritte genähert. Sollte er den Ort für günstig zu einem Angriff halten?… Fast scheint es so, denn er verdoppelt sein Brummen und beschleunigt seinen Schritt noch mehr.
Die kleine Gruppe weicht deshalb noch schneller zurück, und die zweite Violine mahnt dringend:
»Kaltes Blut!… Den Kopf nicht verlieren!«
Die Lichtung ist überschritten und der Schutz der Bäume wieder erreicht. Vermindert ist die Gefahr hierdurch doch eigentlich nicht. Von einem Stamme zum anderen schleichend, kann das Tier die Verfolgten plötzlich anspringen, ohne dass diese seinem Angriffe zuvorzukommen vermögen, und das mochte der Bär wohl auch vorhaben, als er sein Brummen einstellte und sich etwas zusammenkrümmend fast still hielt …
Da ertönt eine laute Musik in der dicken Finsternis, ein ausdrucksvolles Largo, in dem die ganze Seele des Künstlers aufzugehen scheint.
Yvernes ist es, der die Violine aus dem Etui gezogen hat und sie unter mächtigem Bogenstriche erklingen lässt. Wahrlich, ein Geniestreich! Warum sollten auch Musiker ihr Heil nicht bei der Musik gesucht haben? Sammelten sich die von den Akkorden Amphions bewegten Steine nicht freiwillig um Theben an? Legten sich nicht die mit lyrischem Sinne begabten wilden Tiere besänftigt zu Orpheus Füßen nieder? Nun, hier kam man zu dem Glauben, dass dieser kalifornische Bär unter atavistischer Beeinflussung ebenso künstlerisch veranlagt gewesen sei, wie seine Kameraden aus der Sage, denn seine Wildheit erlischt unter der hervortretenden Neigung für Melodien, und ganz entsprechend dem Zurückweichen des Quartetts folgt er diesem in gleichem Tempo nach und lässt wiederholt ein leises Zeichen dilettantischer Befriedigung hören. Es fehlte gar nicht viel, dass er »Bravo!« gerufen hätte.
Eine Viertelstunde später befindet sich Sébastien Zorn mit seinen Gefährten am Saume der Waldung. Sie überschreiten ihn, während Yvernes immer flott drauflosgeigt.
Das Tier hat haltgemacht. Es scheint keine Lust zu haben, noch weiter mitzutrotten; dagegen schlägt es die plumpen Vordertatzen aneinander.
Da ergreift auch Pinchinat sein Instrument und ruft:
»Den Bärentanz! Und in flottem Tempo!«
Während nun die erste Violine die weitbekannte Melodie in Dur mit vollen Bogenstrichen heruntergeigt, begleitet sie die Bratsche scharf und falsch in Moll …
Da fängt das Tier zu tanzen an, hebt einmal die rechte, einmal die linke Tatze hoch auf, dreht und schwenkt sich hin und her und lässt die kleine Gesellschaft unbehelligt sich weiter auf der Straße entfernen.
»Bah!« stößt Pinchinat hervor, »das war nur ein Zirkusbär!«
»Tut nichts«, antwortet Frascolin, »der Teufelskerl, der Yvernes, hat doch eine famose Idee gehabt.«
»Nun trabt aber davon … allegretto«, mahnt der Violoncellist, »und ohne euch umzusehen.«
Es ist gegen neun Uhr abends, als die vier Jünger Apolls heil und gesund in Freschal eintreffen. Sie haben die letzte Wegstrecke in stark beschleunigtem Schritte zurückgelegt, obgleich der Bär ihnen nicht mehr folgte.
Etwa vierzig Häuschen oder richtiger Hütten aus Holz rund um einen mit Buchen bestandenem Platz … das ist Freschal, ein vereinsamtes Dorf, das gegen zwei Meilen von der Küste liegt.
Unsere Künstler schlüpfen zwischen zwei von großen Bäumen beschatteten Wohnstätten hindurch, gelangen damit nach einem freien Platze, in dessen Hintergrunde sich der bescheidene Glockenturm eines Kirchleins erhebt, sie treten zusammen, als wollten sie ein Musikstück aus dem Stegreif vortragen, und bleiben an der Stelle stehen, um zu beratschlagen.
»Das … das soll ein Dorf sein?« fragte Pinchinat.
»Na, du hast doch nicht erwartet, hier eine Stadt von der Art New Yorks oder Philadelphias zu finden!« erwidert Frascolin.
»Unser Dorf liegt aber bereits im Bett!« bemerkt Sébastien Zorn wegwerfend.
»O, wir wollen ein schlummerndes Dorf ja nicht erwecken!« seufzt Yvernes melodisch.
»Im Gegenteil, lasst es uns munter machen!« ruft Pinchinat.
Freilich, wenn sie die Nacht nicht unter freiem Himmel zubringen wollten, blieb ihnen am Ende nichts anderes übrig.
Im Übrigen ist der Ort völlig verlassen und totenstill – kein Laden geöffnet, kein Licht hinter einem Fenster. Für das Schloss Dornröschens wären hier alle Vorbedingungen ungestörtester Ruhe gegeben gewesen.
»Wo ist denn nun das Gasthaus?« fragt Frascolin.
Ja, das Gasthaus, von dem der Kutscher sprach, wo seine verunglückten Fahrgäste freundliche Aufnahme und gutes Nachtlager finden sollten?…
Und der Gastwirt, der sich beeilen würde, dem noch schlimmer verunglückten Kutscher Hilfe zu senden?… Sollte der arme Kerl das alles nur geträumt haben?… Oder – eine andere Hypothese – sollten sich Sébastien Zorn und seine Gesellschaft verirrt haben?… Wäre das gar nicht die Dorfschaft Freschal?…
Diese verschiedenen Fragen verlangen schleunige Beantwortung. Es ergibt sich also die Notwendigkeit, einen der Landesbewohner zu befragen und, um das zu können, an die Tür eines der kleinen Häuser zu klopfen … womöglich an die des Gasthofs, wenn ein glücklicher Zufall diesen entdecken lässt.
Die vier Musiker beginnen also eine Untersuchung der finstern Ortschaft und streifen an den Häuserfronten hin, um vielleicht irgendwo ein heraushängendes Schankzeichen zu erspähen. Von einem Gasthofe findet sich aber keine Spur.
Gibt es auch keine Herberge, so ist doch gar nicht anzunehmen, dass sich nicht wenigstens eine gastfreundliche Hütte fände, und da man hier nicht in Schottland ist, kann man auf amerikanische Weise vorgehen. Welcher Eingeborene von Freschal würde es wohl abschlagen, ein oder auch zwei Dollar für die Person für ein Abendessen und ein Nachtlager anzunehmen?
»Also vorwärts, wir klopfen«, sagte Frascolin.
»Doch im Takte«, setzte Pinchinat hinzu, »und zwar im Sechsachteltakte!«
Hätten sie auch im Drei- oder Viervierteltakte gepocht, der Erfolg wäre doch derselbe gewesen. Keine Tür, kein Fenster öffnet sich, und das Konzert-Quartett hatte schon ein Dutzend Häuser in gleicher Weise um Antwort ersucht.
»Wir haben uns getäuscht«, erklärt Yvernes. »Das ist gar kein Dorf, sondern ein Friedhof, und was man hier schläft, ist der ewige Schlaf … Vox clamantis in deserto.«4
»Amen!« antwortete Seine Hoheit mit der tiefen Stimme eines Kirchenkantors.
Was war nun zu tun, da dieses Grabesschweigen beharrlich fortdauert? Etwa nach San Diego zu weiterzumarschieren? Die Musiker kommen vor Hunger und Erschöpfung bald um. Und dann, welchen Weg sollten sie, ohne Führer und in stockfinstrer Nacht, einschlagen?… Sollten sie vielleicht versuchen, ein anderes Dorf zu erreichen?… Ja, welches denn? Nach Aussage des Kutschers lag kein weiteres an der Küste. Voraussichtlich verirrten sie sich dabei nur noch mehr. Am ratsamsten erschien es, den Tag abzuwarten. Und doch, ein halbes Dutzend Stunden ohne Obdach hinzubringen, unter einem Himmel, der sich mit dicken Wolken überzieht, die früher oder später mit einer Sündflut drohen, das kann man doch niemandem, auch nicht Künstlern, zumuten.
Da kam Pinchinat auf einen Gedanken. Seine Gedanken sind zwar nicht immer die besten, sprudeln aber massenhaft in seinem Gehirn auf. Der jetzige hatte sich übrigens der Zustimmung des weisen Frascolin zu erfreuen.
»Kameraden«, sagte er, »warum sollte das Mittel, das gegen einen wilden Bären von Erfolg war, nicht auch gegenüber einem kalifornischen Dorfe erfolgreich sein? Wir haben jenen Plantigraden durch ein bisschen Musik gezähmt … erwecken wir nun das Landvolk hier durch ein lärmendes Konzert, wobei wir’s an einem Forte und einem Allegro nicht fehlen lassen …«
»Das wäre des Versuchs wert«, meinte Frascolin.
Sébastien Zorn hat Pinchinat nicht einmal seine Worte vollenden lassen, sondern bereits das Violoncell aus dem Kasten geholt, es auf der eisernen Spitze aufgerichtet vor sich hingestellt, und steht, da er keinen Sitz zur Verfügung hat, mit dem Bogen in der Hand schon bereit, dessen klingendem Bauche alle darin aufgespeicherten Töne zu entlocken.
Fast gleichzeitig sind seine Kameraden fertig, seinem Beispiele, wohin es sei, zu folgen.
»Das H-moll-Quartett von Onslow«, ruft er. »Anfangen! Ein paar Takte umsonst!«
Dieses Quartett von Onslow kannten sie auswendig, und geübte Streichmusikanten brauchten gewiss auch keine Beleuchtung dazu, ihre geschickten Finger über das Griffbrett eines Violoncells, zweier Violinen und einer Bratsche gleiten zu lassen.
So folgen sie denn alle ihrer künstlerischen Eingebung. Noch nie haben sie wohl in den Kasinos oder auf den Bühnen des amerikanischen Bundesstaates mit mehr Talent und Innigkeit gespielt. Da ertönt eine wahrhaft himmlische Harmonie, der menschliche Wesen, wenn sie nicht gerade mit Taubheit geschlagen sind, unmöglich widerstehen können. Ja, befanden sie sich auch, wie Yvernes vermutete, auf einem Kirchhof, so hätten sich die Gräber öffnen, die Toten aufrichten müssen, und die Skelette hätten gewiss die Hände zusammengeschlagen …
Und dennoch bleiben die Häuser geschlossen, die Schläfer erwachen auch jetzt nicht. Das Musikstück endigt mit den Prachtsätzen seines mächtigen Finale, ohne dass Freschal ein Lebenszeichen von sich gibt.
»Da sitzt doch der Teufel drin!« polterte Sébastien Zorn auf dem Gipfel der Wut hervor. »Bedarf es denn für die Ohren dieser Wilden eines Charivari, wie für den Bären?… Auch gut, wir fangen noch einmal von vorne an, doch du, Yvernes spielst in D-, du, Frascolin in E- und Pinchinat in G-dur. Ich selbst bleibe in H-moll, und nun aus Leibeskräften los!«
Das gab aber einen Missklang zum Trommelfellzersprengen! Es erinnerte an das improvisierte Orchester, das der Prinz von Joinville dereinst in einem unbekannten Dorfe des brasilianischen Gebietes dirigierte. Es klang, als ob man auf »Essigkannen« eine entsetzliche Symphonie mit verkehrtem Bogenstrich exekutiert hätte.
Pinchinats Gedanke erwies sich übrigens als vortrefflich. Was ein ganz ausgezeichneter musikalischer Vortrag nicht erzielte, das erzielt dieses gräuliche Durcheinander. Freschal fängt an aufzuwachen. Da und dort erhellen sich die Fenster. Die Bewohner des Dorfes sind also nicht tot, da sie jetzt Lebenszeichen verraten. Sie sind auch nicht taub, da sie hören und lauschen.
»Die Leute werden uns mit Äpfeln bombardieren«, sagt Pinchinat während einer Pause, denn trotz mangelndem Einklang des Tonstücks ist dessen Takt doch eingehalten worden.
»O, desto besser; dann essen wir sie«, antwortet der praktische Frascolin.
Und auf Kommando Sébastien Zorns beginnt das kakophonische Konzert von Neuem. Nach Beendigung desselben mit einem mächten »Dis«-Akkord in vier verschiedenen Tonlagen halten die Musiker ein.
Das kakophonische Konzert
Nein, mit Äpfeln wirft hier keiner aus den zwanzig oder dreißig geöffneten Fenstern, sondern laute Beifallsbezeugungen, kräftige Hurras und scharftönende Hips schallen daraus hervor. Die freschalischen Ohren haben sich jedenfalls noch niemals eines solchen musikalischen Hochgenusses erfreut, und es unterliegt keinem Zweifel, dass jetzt jedes Haus willig ist, so unvergleichliche Virtuosen gastlich aufzunehmen.
Doch während diese sich ihrer musikalischen Verzückung völlig hingaben, ist ein Zuschauer und Zuhörer, ohne dass sie seine Annäherung bemerkten, bis auf wenige Schritte herangetreten. Diese aus einer Art elektrischen Kremsers ausgestiegene Persönlichkeit wartet an einer Ecke des Platzes. Es ist ein hochgewachsener wohlbeleibter Mann, soweit das bei der Dunkelheit zu erkennen war.
Während sich dann unsere Pariser Kinder noch fragen, ob sich nach den Fenstern auch die Türen der Häuser öffnen werden, um sie aufzunehmen – was mindestens noch ungewiss ist –, nähert sich der neue Ankömmling noch weiter und spricht in liebenswürdigstem Tone und im reinsten Französisch:
»Ich bin Kunstliebhaber, meine Herren, und eben jetzt so glücklich gewesen, Ihnen Beifall zollen zu dürfen.«
»Während unseres letzten Musikstücks?« erwidert Pinchinat ironisch.
»Nein, meine Herren, während des ersten; ich habe das Quartett von Onslow selten in so vollendeter Weise spielen hören.«
Der Mann ist offenbar ein Kenner.
»Mein Herr«, antwortet ihm Pinchinat im Namen seiner Gefährten, »wir sind Ihnen für Ihre Anerkennung sehr verbunden. Hat unsere zweite Nummer Ihre Ohren zerrissen, so kommt das daher …«
»Mein Herr«, fällt ihm der Unbekannte ins Wort und schneidet damit einen Satz ab, der jedenfalls sehr lang geworden wäre, »ich habe niemals mit gleicher Vollendung so falsch spielen hören. Ich durchschaue es aber, weshalb Sie zu diesem Auswege griffen: Sie wollten die wackeren Bewohner von Freschal, die schon im tiefsten Schlafe liegen, aufwecken. Nun, meine Herren, gestatten Sie mir, Ihnen das anzubieten, was Sie mit jenem seltsamen Mittel erstrebten …«
»Gastliche Aufnahme?« fragt Frascolin.
»Gewiss, eine ultraschottische Gastfreundschaft. Irre ich mich nicht, so steht vor mir das Konzert-Quartett, das in unserem herrlichen Amerika überall berühmt ist, und gegen das letzteres mit seinem Enthusiasmus nicht gegeizt hat …«
»Verehrter Herr«, glaubt Frascolin hier einflechten zu müssen, »wir fühlen uns aufs höchste geschmeichelt. Doch … die gastliche Aufnahme … wo könnten wir die durch Ihre Güte finden?«
»Zwei Meilen von hier.«
»In einem anderen Dorfe?«
»Nein … Nein, in einer Stadt.«
»Einer bedeutenderen Stadt?…«
»Gewiss.«
»Erlauben Sie, man hat uns gesagt, dass hier und vor San Diego keine Stadt liege …«
»Ein Irrtum … wirklich ein Irrtum, den ich nicht zu erklären vermag.«
»Ein Irrtum?…« wiederholt Frascolin.
»Ja, meine Herren, und wenn Sie mir nur folgen wollen, verspreche ich Ihnen einen Empfang, wie er sich für solch hervorragende Künstler gebührt.«
»Ich denke, das erschiene annehmbar«, ließ sich Yvernes vernehmen.
»Ganz meine Ansicht«, bestätigt Pinchinat.
»Halt, halt … noch einen Augenblick«, ruft Pinchinat; »niemals schneller als der Leiter des Orchesters.«
»Das bedeutet?«… fragt der Amerikaner.
»Dass wir in San Diego erwartet werden«, antwortet Frascolin.
»In San Diego«, fügt der Violoncellist hinzu, »wo die Stadt uns zu einer Reihe von musikalischen Matinées engagiert hat, deren erste bereits übermorgen Sonntag stattfinden soll.«
»Ah so!« versetzt der Fremde mit dem Ausdruck der Enttäuschung.
Gleich darauf ergreift er jedoch wieder das Wort:
»Nun, das tut nichts, meine Herren«, setzt er hinzu. »Binnen eines Tages werden Sie Zeit genug haben, eine Stadt zu sehen, die des Besuches wert ist, und ich verpflichte mich, Sie bis zur nächsten Station zurückzubefördern, sodass Sie am Sonntag in San Diego sein können.«
In der Tat, das Anerbieten ist ebenso verführerisch, wie unter den gegebenen Umständen willkommen. Das Quartett kann sicher sein, in einem guten Hotel ein treffliches Zimmer zu finden, ohne von den weiteren Vorteilen zu reden, die sie von und durch diesen zuvorkommenden Herrn erwarten dürfen.
»Nehmen Sie meinen Vorschlag an, meine Herren?«
»Mit Vergnügen«, versichert jetzt Sébastien Zorn, den der Hunger und die Ermüdung bestimmen, eine derartige Einladung nicht abzuweisen.
»Also abgemacht!« erwidert der Amerikaner. »Wir brechen sofort auf, sind binnen zwanzig Minuten am Ziele, und ich weiß, dass Sie mir dafür Dank wissen werden.«
Selbstverständlich hatten sich nach den Hurras, die der exekutierten Katzenmusik folgten, die Fenster der Häuser sogleich wieder geschlossen. Die Lichter erloschen und Freschal verfiel aufs neue in tiefen Schlaf.
Von dem Amerikaner geführt, begeben sich die Musiker nach dem Kremser, bringen darauf ihre Instrumente unter und nehmen im hinteren Teile des Gefährtes Platz, während sich ihr freundliche Führer ganz vornhin neben den Mechaniker setzt. Dann wird ein Hebel umgelegt, die elektrischen Akkumulatoren treten in Wirkung, der Wagen rückt von der Stelle und kommt sehr bald in rasche Bewegung nach Westen hinaus.
Nach einer Viertelstunde leuchtet ein ausgebreiteter weißlicher Schein auf, ein die Augen blendendes Durcheinander von leuchtenden Strahlen. Da liegt also eine Stadt, von deren Vorhandensein unsere Pariser gar keine Ahnung hatten.
Der Kremser hält an und Frascolin sagt:
»Aha, da wären wir ja an der Küste.«
»An der Küste … nein«, entgegnet der Amerikaner. »Das ist ein Strom, den wir zu überschreiten haben.«
»Doch auf welche Weise?« fragt Pinchinat.
»Mittels der Fähre hier, die gleich unseren Wagen aufnimmt.«
In der Tat liegt vor ihnen eines der in den Vereinigten Staaten so häufigen Ferry-boats, auf das der Wagen samt Insassen hinüberrollt. Ohne Zweifel wird dieses Ferry-boat durch Elektrizität angetrieben, denn es stößt keinen Dampf aus, und schon zwei Minuten später legt es nach Überschreitung des Wassers an der Kaimauer eines Bassins im Hintergrunde eines Hafens an.
Der Kremser rollt nun durch über Land führende Alleen weiter und dringt in eine Parkanlage ein, über die hoch oben angebrachte elektrische Lampen helles Licht ausgießen.
Am Gitter dieses Parks öffnet sich ein Tor, der Zugang zu einer breiten und langen, mit tönenden Platten belegten Straße. Fünf Minuten später steigen unsere Künstler am Vorbau eines eleganten Hotels aus, wo sie auf ein Wort des Amerikaners hin mit vielversprechender Zuvorkommenheit empfangen werden. Man geleitet sie sofort nach einer luxuriös ausgestatteten Tafel, und sie nehmen – wie sich wohl voraussetzen lässt, mit bestem Appetit – ein reichliches Abendessen ein.
Nach Beendigung desselben führt sie der Oberkellner nach einem sehr geräumigen Zimmer mit mehreren Glühlampen, die durch niederzulassende Schirme in mild leuchtende Nachtlampen verwandelt werden können. Die Erklärung aller dieser Wunder von dem kommenden Morgen erwartend, schlummern sie endlich in den die vier Zimmerecken einnehmenden bequemen Betten ein und schnarchen mit der außergewöhnlichen Übereinstimmung, der das Konzert-Quartett seinen künstlerischen Ruhm verdankt.
1 Figur in der griechischen Mythologie, der schöne und ewig jugendliche Liebhaber der Mondgöttin Selene <<<
2 Gestalt aus Schillers „Räubern“ <<<
3 Sohlengänger, Landwirbeltiere, die bei der Fortbewegung die gesamte Fußsohle aufsetzen, Bsp: Bären oder Menschenaffen <<<
4 Das Motto des Dartmouth College ist „Vox Clamantis in Deserto" („Eine Stimme ruft in der Wüste") Sinngemäß: Ein (einsamer) Rufer in der Wüste. <<<