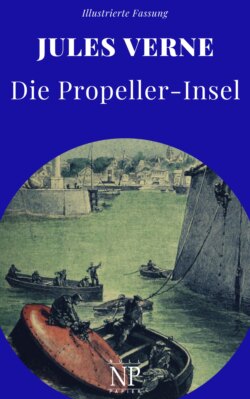Читать книгу Die Propeller-Insel - Jules Verne, Jules Verne - Страница 11
Drittes Kapitel – Ein redseliger Cicerone
ОглавлениеAm frühen Morgen, gegen sieben Uhr, erschallen nach täuschender Nachahmung des Tones einer Trompete – gleich dem ersten Signal bei der Reveille eines Regiments – im gemeinschaftlichen Zimmer folgende Worte oder richtiger Rufe:
»Allons! … Hopp! … Auf die Füße … und in zwei Tempos!« … womit Pinchinat den jungen Tag einleitet.
Yvernes, das bequemste Mitglied des Quartetts, hätte gewiss drei, oder noch lieber vier, Tempos vorgezogen, um sich aus den molligen Hüllen des Bettes zu schälen. Doch auch er muss dem Beispiele seiner Kameraden folgen und die horizontale Lage gegen die vertikale Haltung vertauschen.
»Wir haben keine einzige Minute zu verlieren!« bemerkt Seine Hoheit.
»Freilich«, schließt Sébastien Zorn sich ihm an, »denn morgen müssen wir unbedingt in San Diego sein.«
»Schon recht«, erwidert Yvernes, »ein halber Tag wird ja ausreichen, die Stadt unseres liebenswürdigen Amerikaners zu besuchen.«
»Was mich verwundert«, lässt sich Frascolin vernehmen, »ist, dass überhaupt eine so bedeutende Stadt in der Nähe von Freschal liegt! … Wie mochte es nur kommen, dass unser Kutscher davon kein Sterbenswörtchen gesagt hat?«
»Die Hauptsache bleibt doch, dass wir hier sind, alter G-Schlüssel«, bemerkt Pinchinat.
Durch zwei große Fenster dringt reichliches Licht ins Zimmer, das auf etwa eine Meile Länge Aussicht nach einer schönen, mit doppelter Baumreihe geschmückten Straße bietet.
Die vier Freunde beginnen nun in einem behaglichen Nebenraume ihre Toilette, übrigens eine kurze und leichte Arbeit, denn alles ist hier nach den neuesten Verbesserungen eingerichtet: Drehhähne für warmes und kaltes Wasser zur beliebigen Mischung, Waschgeschirre, die sich durch Achsendrehung selbsttätig entleeren, Fuß- und Handwärmer, Zerstäuber mit wohlriechenden Flüssigkeiten, die nach Belieben in Funktion treten, durch den elektrischen Strom bewegte Ventilatoren, mechanisch bewegte Bürsten, sodass man an die einen nur den Kopf, an die anderen die Kleidung oder die Stiefel zu halten braucht, um erstere gereinigt, letztere blankgewischt zu bekommen.
Des weiteren, ohne die elektrische Uhr und die elektrischen Ölfläschchen, die sich durch einen Fingerdruck nach Bedarf ergießen, zu rechnen, setzen Klingeltasten oder Telefone die verschiedenen Teile der ganzen Anlage mit dem Zimmer in sofortige Verbindung.
Und Sébastien Zorn nebst seinen Kameraden kann von hier aus nicht allein mit dem Hotel sprechen, sondern auch mit den verschiedenen Teilen der Stadt, ja vielleicht gar – das ist wenigstens Pinchinats Ansicht – mit jeder beliebigen Stadt der Vereinigten Staaten.
»Wenn nicht der beiden Welten«, setzt Yvernes hinzu.
In der Erwartung, sich hiervon noch später zu überzeugen, lässt sich zwei Minuten nach drei Viertel acht Uhr in englischer Sprache folgende telefonische Mitteilung vernehmen:
»Calistus Munbar entbietet seinen Guten Morgen allen verehrlichen Mitgliedern des Konzert-Quartetts und ersucht sie, sobald sie dazu fertig sind, herunter zu kommen, um im Dining-room des Exzelsior-Hotels das erste Frühstück einzunehmen.«
»Exzelsior-Hotel!« rief Yvernes. »Der Name dieser Karawanserei1 klingt vielversprechend!«
»Calistus Munbar, das ist unser so ungemein zuvorkommender Amerikaner«, bemerkt Pinchinat, »und der Name ist großartig!«
»Liebe Freunde«, ruft der Violoncellist, dessen Magen ebenso selbstwillig ist wie sein Eigentümer, »da der Morgenimbiss aufgetragen ist, wollen wir frühstücken, und nachher …«
»Nachher … spazieren wir durch die Stadt«, fällt Frascolin ein. »Doch welche Stdt in aller Welt kann das sein?«
Nachdem unsere Pariser ihre Morgentoilette so ziemlich vollendet haben, antwortet Pinchinat telefonisch, dass sie sich binnen fünf Minuten die Ehre geben werden, Herrn Calistus Munbars Einladung nachzukommen.
Bald darauf begeben sie sich nach dem Personenaufzug, der sich sofort in Bewegung setzt und sie in die monumentale Vorhalle des Hotels hinunterbefördert. An der Rückseite des Flurs liegt die Tür nach dem Diningroom, einem großen, in reichem Goldschmuck erglänzenden Saale.
»Ganz zu Ihren Diensten, meine Herren, ganz zu Ihrem Befehl!«
Der Herr vom vorigen Abend ist es, der diesen Satz von zehn Wörtern ausspricht. Er gehört dem Typus von Persönlichkeiten an, von denen man sagen kann, dass sie sich gleich selbst vorstellen. Erscheint es nicht, als ob man mit ihnen schon lange oder richtiger, schon »von jeher« bekannt wäre?
»Ganz zu Ihren Diensten, meine Herren!«
Calistus Munbar kann zwischen fünfzig und sechzig Jahre zählen, sieht aber höchstens wie ein mittlerer Vierziger aus. Er ist über mittelgroß, ziemlich beleibt und hat starke Gliedmaßen. Gesund und kräftig, zeigt er sichere Bewegungen – kurz, er »platzt« vor Gesundheit, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist.
Dem Sébastien Zorn und seinen Kollegen sind solche Leute – deren gibt es ja in den Vereinigten Staaten nicht so wenige – schon oft in den Weg gelaufen. Der gewaltige, kugelrunde Kopf Calistus Munbars strotzt von noch blondem, üppigem Haar, das auf- und abschwankt, wie Baumlaub unter dem Winde; sein Teint ist recht frisch; der ziemlich lange, rotgelbe Bart läuft in zwei Spitzen aus; den Schnurrbart hat er wegrasiert; der an den Lippenwinkeln etwas hinaufgezogene Mund erscheint lächelnd, sogar scherzhaft; die Zähne gleichen blendendweißem Elfenbein; die an der Spitze etwas verdickte Nase, mit leicht beweglichen Flügeln und mit zwei lotrechten Falten unter der Stirn solid befestigt, trägt einen Klemmer, der von einer feinen, gleich einem Seidenfaden schmiegsamen silbernen Schnur gehalten wird. Hinter den Gläsern des Klemmers blitzt ein bewegliches Auge mit grünlicher Iris auf, deren Pupille wie von Kohlenglut erleuchtet aussieht. Dieser Kopf ist mit den Schultern durch einen wirklichen Stiernacken verbunden und der Rumpf auf fleischigen Ober-, nebst tüchtigen Unterschenkeln über etwas großen Füßen aufgebaut.
Calistus Munbar trägt ein weites, katechufarbenes Jacket von Diagonalstoff. Aus der Tasche an der Seite lugt der Zipfel des Taschentuchs hervor. Die stark ausgeschnittene Weste wird von drei goldenen Knöpfen geschlossen gehalten. Von einer Tasche derselben zur anderen hängt bogenförmig eine schwere Kette, die an dem einen Ende einen Chronometer, am anderen einen Pedometer trägt, ohne die Breloques, die in ihrer Mitte klimpern und klirren. Dieser Goldschmuck wird noch vervollständigt durch einen wahren Rosenkranz von Ringen, womit die vollen, rosenroten Finger verziert sind. Das tadellos weiße, steife und glanzgeplättete Hemd lässt drei schöne Diamanten sehen und läuft in einen breit zurückgeschlagenen Kragen aus, unter dem eine nicht recht zu bezeichnende Krawatte, mehr nur ein braunroter Galon, herabhängt. Das Beinkleid aus streifigem Stoffe mit weiten Falten verengt sich nur über den mit Aluminiumagraffen geschlossenen Schuhen.
Die Physiognomie2 dieses Yankees ist im höchsten Maße ausdrucksvoll – die Physiognomie der Leute, die an nichts zweifeln und »die noch ganz andere Dinge gesehen haben«, wie man zu sagen pflegt. Der brave Mann weiß offenbar, was er will, und ist obendrein energisch, was man an der Spannkraft seiner Muskeln und an der sichtbaren Zusammenziehung seines Kaumuskels erkennt. Endlich lacht er gern, und das recht laut, doch mehr durch die Nase als durch den Mund, also in einer Art Kichern, einem hennitus, wie es die Physiologen nennen.
Das ist dieser Calistus Munbar. Beim Eintritt des Quartetts lüftet er den breitkrempigen Hut, dem eine Feder à la Ludwig XIII. nicht übel angestanden hätte. Er drückt den vier Künstlern die Hände und führt sie dann nach einer Tafel, worauf der Teekessel siedet und der landesübliche Braten dampft. Er spricht unausgesetzt und lässt überhaupt keine Frage aufkommen – vielleicht um einer Antwort auszuweichen – indem er die Vorzüge seiner Stadt hervorhebt, die wunderbare Gründung derselben rühmt, ohne Unterlass in seinem Monologe fortfährt und diesen nach Beendigung des Frühstücks mit den Worten schließt:
»Wollen Sie mir nun freundlichst folgen, meine Herren! Doch eine Warnung …«
»Und die wäre?« fragt Frascolin.
»Es ist hier strengstens verboten, auf den Straßen auszuspucken.«
»Das ist unsere Gewohnheit nie gewesen«, protestiert Yvernes.
»Desto besser, so werden Sie vor Geldstrafen gesichert sein.«
»In Amerika … und nicht ausspucken!« murmelt Pinchinat mit einem Tone, in dem sich Überraschung und Unglauben vermischen.
Es wäre schwierig gewesen, sich einen Führer zu verschaffen, der gleichzeitig ein Erklärer wie Calistus Munbar gewesen wäre. Er kennt diese Stadt gründlichst. Hier gibt es kein Hotel, das er nicht zu nennen, kein Haus, von dem er nicht zu sagen wüsste, wer es bewohnte, gibt es keinen Vorüberkommenden, der ihn nicht freundlich begrüßt hätte.
Die ganze Stadt ist sehr regelmäßig angelegt. Alleen und Straßen, letztere auch mit Schutzdach über den Trottoirs, schneiden sich, wie die Linien eines Schachbretts, in rechten Winkeln. Gleichmäßigkeit beherrscht den ganzen geometrischen Plan; doch auch an Abwechslung fehlt es nicht, denn die Häuser folgen, was Stil und äußeres Aussehen wie innere Einrichtung betrifft, keiner anderen Regel, als der Fantasie der Architekten. Mit Ausnahme einiger, mehr dem Handel dienenden Straßen, bilden die Häuser der übrigen mehr eine Art Paläste mit ihren von eleganten Nebengebäuden begrenzten Vorhöfen, dem architektonischen Reichtum ihrer Fassaden, mit der luxuriösen Ausstattung der Wohnräume und den Gärten oder richtiger den Parks, die zu jedem Grundstück gehören. Immerhin fällt es auf, dass die Bäume darin nirgends ihre volle Entwicklung erreicht haben. Dasselbe gilt für die an den Durchschnittsstellen der Hauptverkehrsadern ausgesparten Squares, auf denen man zwar Rasenflächen von entzückender Frische findet, während die Baumgruppen mit ihrem Gemisch von Arten aus der gemäßigten und der heißen Zone dem Erdboden noch nicht genug Nährstoffe abgesaugt zu haben scheinen. Gerade diese Eigentümlichkeit bildet einen scharfen Gegensatz zu dem Teile des westlichen Amerika, wo in der Nachbarschaft der großen kalifornischen Städte geradezu Riesenwälder die Regel sind.
Das Quartett schlenderte so für sich hin, wobei sie das betreffende Stadtviertel jeder nach seiner Neigung in Augenschein nahmen, Yvernes angezogen von dem, was Frascolin weniger interessierte, Sébastien Zorn von dem, was Pinchinat mehr gleichgültig ließ … alle jedoch höchst begierig, das Geheimnis zu durchdringen, das die ihnen unbekannte Stadt umhüllte. Die Verschiedenheit der Anschauungen musste gerade eine Menge recht bezeichnender Beobachtungen ergeben. Übrigens ist ja auch Calistus Munbar bei der Hand, der auf jede Frage eine Antwort weiß. Doch was sagen wir … eine Antwort?… Er wartet gar nicht ab, bis man ihn fragt, er spricht, plaudert, erklärt in einem fort. Seine Wörtermühle dreht sich schon beim leisesten Lufthauch. Eine Viertelstunde nach dem Weggange aus dem Exzelsior-Hotel sagt Calistus Munbar:
»Wir befinden uns jetzt in der Third Avenue, und deren hat die Stadt dreißig. Diese hier, die an Verkaufsläden reichste, bildet unseren Broadway, unsere Regent-Street, unsere Große Friedrichsstraße oder unseren Boulevard des Italiens. In ihren Magazinen und Bazaren findet man das Überflüssige neben dem Notwendigen, alles, was für verfeinertes Wohlleben und modernen Komfort nur irgend verlangt werden kann.«
»Wir befinden uns jetzt in der Third Avenue …«
»Die Magazine sehe ich wohl«, bemerkt Pinchinat, »doch keine Einkäufer …«
»Vielleicht ist es noch zu früh am Morgen …?« setzt Yvernes hinzu.
»Nein, das kommt daher«, antwortet Calistus Munbar, »dass die meisten Bestellungen telefonisch oder auch telautografisch erfolgen …«
»Telautografisch?… Was bedeutet das?« fragt Frascolin.
»Das bedeutet, dass wir vielfach den Telautografen benützen, einen sinnreichen Apparat, der die Handschrift ebenso überträgt, wie das Telefon die Sprache, ohne den Kinetografen zu vergessen, der alle Bewegungen nachbildet und für das Auge dasselbe ist, was der Phonograph für das Ohr ist – und endlich das Telefot, das jedes Bild wiedergibt. Der Telautograf bietet eine weit größere Sicherheit als die einfache Depesche, mit der jeder Beliebige Missbrauch treiben kann, deshalb können wir auf elektrischem Wege Bestellungen aufgeben und Rechnungen senden oder Verträge schließen …«
»Auch Eheverträge vielleicht …«, unterbricht ihn Pinchinat ironischen Tones.
»Gewiss, Herr Bratschist. Warum sollte man sich nicht mittels elektrischen Drahtes verheiraten können …«
»Und auch wieder scheiden?…«
»Auch wieder scheiden! Das kommt sogar noch häufiger vor!«
Der Cicerone lacht dazu so unbändig, dass alle Schmuckgegenstände an seiner Weste zittern und klirren.
»Sie sind recht lustiger Natur, Herr Munbar«, sagt Pinchinat, der von der Heiterkeit des Amerikaners angesteckt wird.
»Warum nicht? Wie ein Schwarm Buchfinken an einem sonnigen Tage!«
Jetzt zeigt sich eine größere Querstraße. Es ist die Neunzehnte Avenue, aus der jeder Handelsverkehr verbannt ist. Durch dieselbe verlaufen, wie durch die anderen, zwei Trambahngleise. Schnell rollen die Wagen darüber hin, ohne ein Körnchen Staub aufzuwirbeln, denn die mit einem unveränderlichen Belag von Karry oder australischem Jarraholz – warum nicht von brasilianischem Mahagoni? – versehene Straßenfläche ist so sauber, als hätte man sie mit Schmirgelpapier abgerieben. Frascolin, der alle physikalischen Erscheinungen scharf beobachtet, meint, dass sie unter den Füßen fast einen metallischen Klang hören lasse.
»Das sind offenbar großartige Eisenindustrielle!« sagt er für sich. »Nun stellen sie gar die Fahrwege aus Eisenguss her!«
Eben wollte er sich bei Calistus Munbar darüber näher unterrichten, als dieser ausrief:
»Sehen Sie sich dieses Hotel an, meine Herren!«
Er zeigt dabei nach einem umfänglichen und großartigen Bauwerk, dessen Seitenflügel, die einen Schmuckhof begrenzen, durch ein Gitter aus Aluminium verbunden sind.
»Dieses Hotel, man könnte sagen, dieser Palast wird von einer der ersten Familien der Stadt bewohnt. Ich erwähnte Ihnen bereits Jem Tankerdon. Der Mann ist Eigentümer unerschöpflicher Petroleumquellen in Illinois und der reichste und deshalb der ehrbarste und verehrteste unserer Mitbürger …«
»Mit einem Vermögen von Millionen?« fragt Sébastien Zorn.
»Pah!« stieß Calistus Munbar hervor. »Eine Million ist für uns so viel wie ein Dollar, und deren gibt’s hier Hunderte! In unserer Stadt wohnen manche überreiche Nabobs. Damit erklärt es sich, dass die Kaufleute in den Handelsvierteln bald ein Vermögen machen … ich meine die Detailhändler, denn von Großhändlern findet sich auf diesem, in der Welt einzig dastehenden Mikrokosmos kein einziger …«
»Aber Industrielle?« fragte Pinchinat weiter.
»Industrietreibende gibt es hier nicht!«
»So doch wohl Reeder!«3 ließ sich Frascolin vernehmen.
»Ebensowenig!«
»Also lauter Rentiers!« sagte darauf Sébastien Zorn.
»Nichts als Rentiers, neben Kaufleuten, die im besten Zuge sind, sich eine schöne Rente anzusammeln.«
»Nun, aber Handwerker doch auch?« bemerkte Yvernes.
»Wenn man Handwerker braucht, lässt man sie von auswärts kommen, und wenn die Leute fertig sind, kehren sie wieder zurück … natürlich mit einem hübschen Batzen Geld in der Tasche.«
»Doch selbstverständlich, Herr Munbar«, sagte Frascolin, »haben Sie auch einige Arme in Ihrer Stadt, und wäre es nur, um die Rasse nicht ganz aussterben zu lassen.«
»Arme, mein Herr zweiter Geiger?… Von solchen würden Sie keinen einzigen entdecken!«
»So ist das Betteln wohl strengstens verboten?…«
»Zu einem solchen Verbote fehlte jede Veranlassung, da die Stadt Bettlern gar nicht zugänglich ist. So etwas passt für die Städte der Union mit ihren Stiften, Asylen und Arbeitshäusern … und mit den Besserungsanstalten, die jene vervollständigen …«
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Gefängnisse hätten?«
»So wenig, wie wir Gefangene haben.«
»Doch mindestens Verbrecher oder Übeltäter?«
»Diese ersuchen wir, in der Alten oder der Neuen Welt zu bleiben, wo sie ihrem Berufe unter günstigeren Umständen obliegen können.«
»Wahrhaftig, Herr Munbar«, rief Sébastien Zorn, »Ihren Worten nach würde man kaum glauben, sich in Amerika zu befinden.«
»Da waren Sie noch gestern, Herr Violoncellist«, antwortet dieser merkwürdige Cicerone.
»Gestern?« versetzt Frascolin, bemüht, sich den Sinn dieser dunkeln Rede zu deuten.
»Gewiss! Heute befinden Sie sich in einer ganz unabhängigen, freien Stadt, auf die die Union gar kein recht hat, die nur sich selbst regiert …«
»Und deren Name lautet …?« fragt Sébastien Zorn, bei dem schon die angeborene Reizbarkeit durchzubrechen anfängt.
»Deren Name?« antwortet Calistus Munbar. »Gestatten Sie mir, ihn vorläufig noch zu verschweigen.«
»Und wann werden wir ihn erfahren?«
»Wenn Sie den Besuch der Stadt vollendet haben, worüber sie sich übrigens sehr geschmeichelt fühlen wird.«
Dieser so zurückhaltende Amerikaner ist mindestens ein eigenartiger Mann. Alles in allem kommt nicht so viel darauf an. Vor der Mittagsstunde wird das Quartett seinen merkwürdigen Spaziergang vollendet haben, und wenn es den Namen der Stadt auch erst im Augenblick der Abreise davon erfährt, kann es sich jawohl damit begnügen. Auffällig an der Sache ist nur eines: Wie kommt es, dass eine so bedeutende Stadt an der Küste Kaliforniens liegt, ohne der Föderation der Vereinigten Staaten anzugehören, und ferner, wie sollte man es erklären, dass der Führer der Kutsche nicht darauf gekommen war, ihrer Erwähnung zu tun? Das wichtigste bleibt es immerhin, dass die vier Künstler vor Ablauf von vierundzwanzig Stunden in San Diego eintreffen, wo ihnen dieses Rätsel schon gelöst werden wird, im Falle, dass Calistus Munbar sich nicht dazu herbeiließe.
Diese wunderliche Persönlichkeit hat sich aufs neue ihrer wortreichen Beschreibungslust hingegeben, nicht ohne durchblicken zu lassen, dass sie sich auf weitere Erklärungen nicht einzulassen wünscht.
»Meine Herren«, sagt der Amerikaner, »hier stehen wir nun am Eingange zur Siebenunddreißigsten Avenue. Betrachten Sie die bezaubernde Perspektive! Auch hier gibt es keine Magazine oder Bazare, so wenig wie den Straßentrubel, der sonst die Handelstätigkeit kennzeichnet. Nur große Privatwohungen; die Insassen derselben sind aber nicht so vermögend, wie die der Neunzehnten Avenue, es sind mehr kleine Rentiers mit zehn bis zwölf Millionen …«
»Arme Schlucker, nicht wahr?« spöttelt Pinchinat, dessen Lippen sich zu einem mitleidigen Lächeln verziehen.
»Oho, Herr Bratschist«, erwidert Calistus Munbar, »einem anderen gegenüber kann man immer ein halber Bettler sein. Ein Millionär ist ja schon reich gegen den, der nur hunderttausend Francs besitzt; er ist es aber nicht gegen den, der hundert Millionen sein eigen nennt!«
Wiederholt konnten unsere Künstler bemerken, dass von allen Wörtern, die ihr Cicerone gebrauchte, das Wort »Million« – ein Wort von wahrhaft zauberischer Wirkung – am häufigsten wiederkehrte. Beim Aussprechen desselben blies er die Backen so stark auf, dass es einen richtig metallischen Klang bekam. Es schien fast, als prägte er beim Sprechen schon Goldstücke aus. Sind es auch keine Diamanten, die seinen Lippen, wie dem Munde des Patenkindes der Feen Perlen und Smaragde, entquellen, so sind es mindestens vollwertige Goldstücke.
Noch immer spazieren Sébastien Zorn, Pinchinat, Frascolin und Yvernes durch die merkwürdige Stadt, deren geographische Bezeichnung ihnen noch unbekannt ist. Hier belebte Straßen mit einer Menge Menschen in höchst anständiger Kleidung, ohne dass das Auge jemals durch die Lumpen eines Verarmten verletzt wird. Überall Tramwagen, Karren und andere Gefährte, die alle mittels Elektrizität bewegt werden. Einzelne große Verkehrsadern sind mit beweglichen Trottoirs versehen, die mittels einer endlosen Kette im Kreise laufen und worauf die Leute so lustwandeln, als ob sie in einem fahrenden Bahnzuge hin und her gingen, an dessen Eigenbewegung sie natürlich teilnehmen.
Außerdem verkehren besondere elektrische Wagen, die auf der Straße so sanft wie die Bälle auf der Billardtafel dahinrollen. Equipagen im eigentlichen Sinne des Wortes, also Wagen für ausschließliche Personenbeförderung, die von Pferden gezogen werden, trifft man nur in den allerreichsten Stadtteilen.
»Ah, da ist auch eine Kirche!« ruft Frascolin.
Er zeigt dabei nach einem sehr massiven Bauwerke ohne hervortretenden architektonischen Stil, eine Art »Savoyischer Pastete«, die man in die Mitte eines Platzes mit üppigen Rasenflächen gesetzt hat.
»Das ist der protestantische Tempel«, erklärt Calistus Munbar, während er vor dem Gebäude haltmacht.
»Gibt es in Ihrer Stadt auch katholische Kirchen?« fragt Yvernes.
»O ja. Übrigens muss ich Ihnen bemerken, dass wir in unserer Stadt, obwohl es auf der Erde gegen tausend verschiedene Religionen gibt, nur dem Katholizismus oder dem Protestantismus huldigen. Es ist hier nicht so wie in den Vereinigten Staaten, die durch die Religion – wenn nicht schon durch die leidige Politik – veruneinigt werden und wo es ebenso viele Sekten wie Familien gibt, wie z.B. Methodisten, Anglikaner, Presbyterianer, Anabaptisten, Wesleyaner usw. – Hier leben nur Protestanten vom calvinistischen Bekenntnis oder römische Katholiken.«
»Und welcher Sprache bedient man sich meist?«
»Englisch und französisch werden gleich geläufig gesprochen.«
»Unseren Glückwunsch dazu!« sagt Pinchinat.
»Die Stadt ist deshalb«, fährt Calistus Munbar fort, »in zwei annähernd gleiche Hälften geteilt. Hier befinden wir uns …«
»In der westlichen Hälfte, glaub’ ich?« fällt Frascolin ein, der sich nach dem Stande der Sonne orientiert.
»In der westlichen?… Nun ja, wenn Sie wollen …«
»Wie?… Wenn ich will?« erwidert die zweite Geige, sehr erstaunt über eine solche Antwort. »Verändern sich denn die Himmelsrichtungen der Stadt nach dem Wunsche jedes Beliebigen?«
»Ja und nein …« antwortet Calistus Munbar. »Doch davon später. Ich komme also auf diese Stadthälfte zurück … auf die westliche, wenn es Ihnen so beliebt, ausschließlich bewohnt von Protestanten, die auch hier immer praktische Leute geblieben sind, während die raffinierteren, mehr der Fantasie nachgebenden Katholiken die andere Hälfte einnehmen. Ich sagte Ihnen schon, dass das Gebäude vor uns der protestantische Tempel ist.«
»So sieht er auch aus. Bei seinem schwerfälligen Baustile kann das Gebet darin keine Erhebung empor zum Himmel, sondern muss eine Herniederbeugung zur Erde sein …«
»Gut gebrüllt, Löwe!« ruft Pinchinat. »Doch in einer so modern ausgestatteten Stadt, Herr Munbar, kann man wohl auch die Predigt oder die Messe durch das Telefon anhören?«
»Ganz richtig.«
»Und kann auch telefonisch beichten?…«
»So wie man sich mittels Telautografen verheiraten kann, und Sie werden zugeben, dass das eine sehr praktische Einrichtung ist.«
»Das will ich meinen, Herr Munbar«, bestätigt Pinchinat, »praktisch aus dem ff!«
1 Rasthaus an einer Karawanenstraße <<<
2 Die äußere Erscheinung von Lebewesen, insbesondere des Menschen und hier speziell die für einen Menschen charakteristischen Gesichtszüge. <<<
3 Schiffseigner <<<