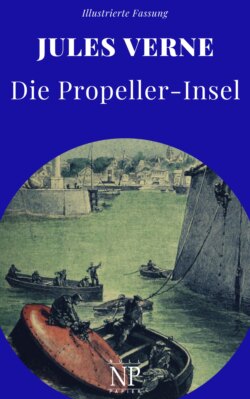Читать книгу Die Propeller-Insel - Jules Verne, Jules Verne - Страница 14
Sechstes Kapitel – Eingeladene … Inviti
ОглавлениеWenn man auch annehmen darf, dass Sébastien Zorn, Frascolin, Yvernes und Pinchinat Leute waren, die über nichts erstaunten, so wurde es diesen doch schwer, in gewiss begründetem Unwillen dem Calistus Munbar nicht an die Kehle zu springen. Es soll einer nur in dem Glauben leben, auf dem Boden des westlichen Amerika umherzuwandeln, und dann erkennen, dass man ihn aufs hohe Meer hinausbefördert! Man soll sich für einige zwanzig Meilen von San Diego entfernt halten, wo man am nächsten Tage zu einem Konzert erwartet wird, und dann ganz schlankweg hören, dass man auf einer schwimmenden Insel immer weiter davon hinwegtreibt! Wahrhaftig, ein Überfall wäre zu verzeihen gewesen.
Zu seinem Glücke hatte sich der Amerikaner einem solchen ersten Wutausbruche zu entziehen gewusst. Sich die Überraschung oder richtiger die Verblüffung des Konzert-Quartetts zunutze machend, verlässt er die Plattform des Turmes, betritt den Fahrstuhl und ist damit vorläufig vor den Vorwürfen und etwaigen Handgreiflichkeiten der vier Pariser geschützt.
»Solch ein Schurke!« ruft das Violoncell.
»Solch ein Untier!« fällt die Bratsche ein.
»Oho … wenn wir’s ihm zu verdanken haben, ein reines Wunder kennenzulernen …«, lässt sich die erste Violine vernehmen.
»Du willst ihn doch nicht gar noch entschuldigen?« meint die zweite Geige.
»Hier gibt’s keine Entschuldigung«, ruft Pinchinat, »und wenn sich auf Standard Island noch Gerechtigkeit findet, lassen wir ihn verdonnern, diesen Malefizkerl von Yankee!«
»Und wenn’s noch einen Henker gibt«, brüllt Sébastien Zorn, »dann lassen wir ihn aufknüpfen!«
Um so schöne Vorsätze auszuführen, gilt es freilich zuerst zum Niveau der Einwohner von Milliard City hinabzugelangen, da hundertfünfzig Fuß hoch in der Luft natürlich keine Polizei tätig ist. Das konnte ja in wenigen Augenblicken geschehen sein, wenn ein Abstieg möglich war. Der Fahrstuhl des Aufzugs ist aber nicht wieder heraufgekommen, und nirgends findet sich etwas wie eine Treppe. Das Quartett befindet sich also auf der Höhe des Turmes außer Verbindung mit der übrigen Menschheit.
Nach dem ersten Ausbruche der Enttäuschung und der Wut sind Sébastien Zorn, Pinchinat und Frascolin, die Yvernes seiner Bewunderung überlassen, endlich völlig still geworden und rühren sich nicht von der Stelle. Über ihnen flattert die Flagge an der langen Fahnenstange. Sébastien Zorn wandelt eine grimmige Lust an, die Hissleine zu durchschneiden und die Flagge wie die eines sich ergebenden Kriegsschiffes zu senken. Immerhin erscheint es besser, sich nicht in eine vielleicht schlimm auslaufende Geschichte einzulassen, und seine Kameraden halten ihn noch zurück, als er schon mit einem scharf geschliffenen Bowiemesser herumfuchtelt.
Seine Kameraden halten ihn zurück.
»Achtung, wir wollen vor allem nicht uns ins Unrecht versetzen«, mahnt der kluge Frascolin.
»Du ergibst dich also in unsere elende, lächerliche Lage?« fragt Pinchinat.
»Das nicht … doch wir wollen sie nicht noch mehr komplizieren.«
»Und unser Gepäck, das inzwischen nach San Diego unterwegs ist!« bemerkt der Bratschist, die Arme kreuzend.
»Und unser für morgen angesetztes Konzert!« ruft Sébastien Zorn.
»Das geben wir durchs Telefon!« antwortet der erste Geiger, dessen Scherz nicht geeignet ist, die Reizbarkeit des kochenden Violoncellisten abzustumpfen.
Das Observatorium nimmt, wie wir wissen, die Mitte eines großen Vierecks ein, an dem die First Avenue ausmündet. Am anderen Ende dieser drei Kilometer langen Hauptverkehrsader, die die beiden Hälften von Milliard City scheidet, erblicken die Künstler eine Art monumentalen Palast, der von einem leichten und sehr eleganten Wartturm überragt wird. Sie sagen sich, dass das der Sitz der Regierung, die Residenz der obersten Stadtbehörde sein werde, wenn Milliard City überhaupt einen Bürgermeister und andere Beamte hat. Sie täuschen sich hierin nicht. Eben jetzt beginnt die Uhr jenes Wartturms ein herrliches Glockenspiel, dessen Klänge auf den Wellen des Windes bis zum Turme hier herübergelangen.
»Hört! … Das geht aus D-dur«, sagt Yvernes.
»Und im Zweivierteltakt«, setzt Pinchinat hinzu.
Da schlägt der Wartturm fünf Uhr.
»Und wann essen wir«, ruft Sébastien Zorn, »wie wird’s mit dem Schlafen? Sollen wir etwa wegen des Spitzbuben von Munbar hier auf der Plattform des Turmes die Nacht in freier Luft zubringen?«
So scheint es allerdings, denn der Fahrstuhl kommt nicht wieder herauf, um die Gefangenen zu erlösen.
In jenen niedrigen Breiten dauert die Dämmerung nur kurze Zeit, und das Strahlengestirn stürzt wie ein Geschoss nach dem Horizonte hinab. Blickt das Quartett nach den äußersten Grenzen des Himmels hinaus, so schimmert ihm nur das unbegrenzte Meer, ohne ein Segel, ohne eine Rauchsäule entgegen. Über das Stück Land unter ihm rollen die Tramwagen an der Peripherie der Insel oder eilen von einem Hafen zum anderen hin. Zur Stunde ist der Park noch sehr belebt. Oben vom Turme aus würde man ihn für einen riesigen Blumenkorb ansehen, worin Azaleen, Klematis, Jasmin, Glycinen, Passionsblumen, Begonien, Hyazinthen, Dahlien, Kamelien und Hunderte von Rosensorten blühen. Da strömen Spaziergänger hinzu … gemachte Männer und junge Leute, nicht solche »Zierbengel«, wie sie leider in europäischen Großstädten so viele herumlaufen, sondern gesunde, kräftige Jünglinge. Frauen und junge Mädchen, meist in strohgelber Toilette – dem dafür unter den Tropen beliebtesten Farbentone – leiten schlanke, mit Seidendecken geschützte Windspiele mit goldigen Halsbändern an weicher Schnur. Da und dort folgt diese Gentry den feinsandigen Alleen, die sich durch den Park hinwinden. Hier sieht man die einen auf die Polster der elektrischen Straßenbahnwagen hingestreckt, dort ruhen andere auf den von dichtem Grün überdachten Bänken. Noch weiter draußen widmen sich junge Gentlemen dem Lawn-tennis, dem Krocket, Golf oder dem Fußballspiele, während andere auf munteren Ponies dem Polo obliegen. Ganze Scharen von Kindern – von jenen amerikanischen Kindern, die sich so schnell entwickeln und bei denen, vorzüglich bei den kleinen Mädchen, eine ausgesprochene Individualität so bezeichnend hervortritt – tummeln sich auf den Rasenplätzen. Dazwischen trotten Reiter auf eleganten Pferden oder sieht man hier und da übermütig lustige Gartengesellschaften.
Auch den Handelsvierteln fehlt es zur Stunde nicht an Besuch.
Die beweglichen Trottoirs gleiten mit ihrer Last längst der Hauptstraße dahin. Am Fuße des Turmes, in dem Viereck des Observatoriums, gehen viele Personen hin und her, deren Aufmerksamkeit die Gefangenen wohl erregen könnten. Pinchinat und Frascolin rufen auch wiederholt laut hinunter. Dass sie gehört wurden, erkennt man daraus, dass manche Arme sich emporstrecken, ja auch einzelne Worte dringen bis zu ihnen hinauf.
Niemand zeigt die geringste Überraschung oder scheint sich über die Gruppe auf der Plattform irgendwie zu verwundern. Die oben verständlichen Worte bestehen in einem »Good bye«, einem »How do You do!«, einem »Guten Tag« oder anderen landläufigen Höflichkeitsausdrücken. Es scheint, als ob die ganze Bevölkerung von dem Eintreffen der vier Pariser, die Calistus Munbar empfangen hatte, völlig unterrichtet sei.
»He … he … die machen sich über uns noch lustig!« sagt Pinchinat.
»Das scheint mir auch so!« stimmt ihm Yvernes bei.
So verrinnt eine Stunde – eine Stunde, aber alle Rufe nach unten bleiben nutzlos. Die dringlichen Bitten Frascolins haben ebensowenig Erfolg, wie das Schmähen und Schelten Sébastien Zorns. Die Zeit zum Essen rückt immer näher, der Park wird von Spaziergängern, die Straße von müßigen Flaneuren immer leerer. Es ist zum Tollwerden!
»Wir gleichen ohne Zweifel«, sagt Yvernes, romantischen Erinnerungen nachhängend, »jenen profanen Gästen, die ein böser Geist an einen geheiligten Ort verlockt hat, und die nun den Tod erleiden müssen, weil sie etwas gesehen hatten, was ihre Augen nicht sehen durften …«
»Und hier lässt man uns den Qualen des Hungers erliegen!« seufzt Pinchinat.
»Nicht ohne dass wir alles mögliche versucht haben werden, um unsere Existenz zu verlängern!« erklärt Sébastien Zorn.
»Und wenn wir gezwungen sind, einer den anderen aufzuzehren, dann kommt Yvernes zuerst an die Reihe!« sagt Pinchinat.
»Wie es euch beliebt!« stöhnt die erste Geige mit schwacher Stimme und senkt schon den Kopf, um den Todesstreich zu empfangen.
Da dringt vom Turme unten ein Geräusch herauf. Der Fahrstuhl gleitet nach oben und hält im Niveau der Plattform an. Bei dem Gedanken, Calistus Munbar wieder auftauchen zu sehen, bereiten sich die Gefangenen schon, ihn nach Gebühr zu empfangen …
Der Fahrstuhl ist leer.
Gut, so ist die Sache aufgeschoben; die Gefoppten werden den sauberen Herrn schon finden. Jetzt gilt’s nur, eiligst nach der Erde hinabzugelangen, und das einzige Mittel dazu ist, im Fahrstuhl Platz zu nehmen.
Das geschieht denn auch sofort. Sobald der Violoncellist nebst Genossen sich in dem Behälter befinden, setzt dieser sich in Bewegung und langt binnen kaum einer Minute unten im Turme an.
»Und nun«, ruft Pinchinat mit dem Fuße stampfend, »befinden wir uns nicht einmal auf natürlichem Boden!« (Im Original ein Wortspiel, da »sol« ebenso Boden, Erdboden heißt, wie es das »G« der Tonleiter bezeichnet.)
Für derartige Kalauer war der Zeitpunkt freilich schlecht gewählt. Es erfolgt auch keine Antwort darauf. Die Tür ist offen. Alle vier treten hinaus. Der innere Hof ist menschenleer. Sie schreiten darüber hin und folgen einer Avenue.
Einzelne Personen kommen an den Fremdlingen vorüber, ohne diesen irgendwelche Beachtung zu schenken. Auf eine Bemerkung Frascolins, der vor allem Klugheit empfahl, muss Sébastien Zorn auf alles Schimpfen und Wettern verzichten. Bei den Behörden nur wollen sie Gerechtigkeit suchen. Das läuft ihnen ja nicht davon. Man beschließt also, erst nach dem Exzelsior-Hotel zu gehen und da den nächsten Morgen abzuwarten, um dann in der Eigenschaft als freie Männer seine Rechte geltend zu machen. Das Quartett wandert also die First Avenue hinauf.
Haben unsere Pariser denn das Privilegium, die öffentliche Aufmerksamkeit zu erwecken? … Ja und nein. Man sieht sie wohl an, doch nicht in auffallender Weise, höchstens so, als gehörten sie zu den seltenen Touristen, die Milliard City zuweilen besuchen. Unter dem Drucke ganz außergewöhnlicher Verhältnisse sind sie selbst nicht gerade bei rosiger Laune und bilden sich ein, weit mehr angestarrt zu werden, als es wirklich der Fall ist. Andrerseits wird man es verzeihlich finden, dass ihnen diese »segelnden Insulaner« etwas närrisch erscheinen, diese Leute, die sich freiwillig von ihresgleichen trennten und nun auf dem größten Ozean der Erdkugel umherirren. Mit ein wenig Fantasie könnte man glauben, sie gehörten einem anderen Planeten unseres Sonnensystems an. Das ist wenigstens die Ansicht Yvernes, den sein überreiztes Hirn leicht nach nur erdachten Welten versetzt.
Pinchinat begnügt sich dagegen zu sagen:
»Alle diese Leute haben meiner Treu das richtige Millionäraussehen und scheinen mir unter den Nieren, ganz wie ihre Insel, einen kleinen Propeller mit herumzutragen.«
Inzwischen macht sich der Hunger immer mehr geltend. Seit dem Frühstück ist geraume Zeit verflossen und der Magen pocht auf sein Recht. Also schnellstens nach dem Exzelsior-Hotel! Morgen sollten die nötigen Schritte erfolgen, um mittels eines der Steamer von Standard Island nach San Diego zurückbefördert zu werden, nachdem Calistus Munbar von Rechts wegen eine reichlich bemessene Entschädigungssumme erlegt hätte.
Auf dem Wege durch die First Avenue bleibt Frascolin aber vor einem prächtigen Gebäude stehen, dessen Front in goldenen Lettern die Aufschrift »Casino« trägt. Rechts von der stolzen Säulenreihe, die den Haupteingang schmückt, erblickt man durch die mit Arabesken verzierten Spiegelscheiben eines Restaurants eine Menge Tische, von denen an verschiedenen gespeist wird, während ein zahlreiches Personal diensteifrig hin und her eilt.
»Hier gibt’s etwas zu essen!« ruft die zweite Violine mit einem Blicke auf die hungrigen Kameraden.
Darauf erfolgt von Pinchinat nur die lakonische Antwort:
»Hineintreten!«
Einer nach dem anderen betreten sie das Restaurant. Man scheint ihre Gegenwart in dem luxuriösen, von den Fremden meist aufgesuchten Etablissement nicht besonders zu bemerken. Fünf Minuten später vertilgen die Halbverhungerten schon mit Begierde die ersten Schüsseln einer vortrefflichen Mahlzeit, wozu Pinchinat – und der versteht sich darauf – die Speisenfolge aufgestellt hat. Glücklicherweise ist der Geldbeutel des Quartetts gut gespickt, und wenn er auf Standard Island auch abmagert, so werden die Einnahmen in San Diego ihn schon bald wieder aufschwellen lassen.
Die Küche ist ganz ausgezeichnet und der in den Hotels von New York und San Franzisko weit überlegen, und die Speisen werden hier in und auf elektrischen Öfen bereitet, die eine sehr genaue Regelung der Hitze ermöglichen. Auf die Suppe mit konservierten Austern, die Fricassés, den Sellerie und den hier stets aufgetischten Rhabarberkuchen folgen ganz frische Fische, Rumpsteaks von unvergleichlicher Zartheit, Wild, das jedenfalls den Prärien und Wäldern Kaliforniens entstammt, und Gemüse, die aus den intensiven Kulturen der Insel selbst herrühren. Als Getränk gibt es nicht das in Amerika allgemein gebräuchliche Eiswasser, sondern verschiedene Biere und Weine, die für die Kellereien von Milliard City aus den Geländen von Burgund, Bordeaux und des Rheins, natürlich mit hohen Kosten, bezogen waren.
Dieses Menü bringt unsere Pariser auf andere Gedanken. Vielleicht betrachten sie das Abenteuer, in das sie geraten sind, schon unter günstigerem Lichte. Bekanntlich haben ja alle Orchestermusiker einen guten Zug. Was aber bei denen natürlich erscheint, die bei der Handhabung von Blasinstrumenten ihre Lunge tüchtig anstrengen, ist weniger zu entschuldigen bei denen, die Streichinstrumente spielen. Doch gleichviel: Yvernes, Pinchinat, selbst Frascolin fangen an, das Leben rosenrot und in dieser Stadt der Milliardäre selbst goldfarbig zu sehen. Nur Sébastien Zorn allein widersteht der Versuchung und lässt seinen Ingrimm nicht durch die feurigen Gewächse Frankreichs ertränken.
Kurz, das Quartett ist bemerkbar »angehaucht«, wie man im alten Gallien sagt, als die Stunde kommt, die Rechnung zu verlangen. Von dem Oberkellner des Hotels, der in schwarzer Kleidung erscheint, wird sie Frascolin, als dem Kassierer, eingehändigt.
Die zweite Violine wirft einen Blick darauf, erhebt sich, sinkt zurück, erhebt sich wieder, reibt sich die Augen und starrt nach der Decke.
»Was fehlt dir denn?« fragt Yvernes verwundert.
»Es läuft mir ein Frostschauer durch Mark und Bein«, antwortet Frascolin.
»Es ist wohl teuer hier?«
»Mehr als teuer. Der Spaß kostet zweihundert Francs …«
»Für alle vier?«
»Nein, für jeden!«
In der Tat: Hundertsechzig Dollar, nicht mehr und nicht weniger, und im einzelnen beläuft sich die Nota für die Vorspeise auf fünfzehn Dollar, für den Fisch auf zwanzig, für die Rumpsteaks auf fünfundzwanzig Dollar, für den Medoc und den Burgunder auf dreißig Dollar für die Flasche, und für das übrige im Verhältnis hierzu.
»Donnerwetter!« platzt die Bratsche heraus.
»Diese Räuber!« schimpft Sébastien Zorn.
Die französisch hervorgestoßenen Worte versteht der Oberkellner zwar nicht, er bemerkt aber doch, dass hier etwas Besondres vorgehen müsse. Wenn sich indes ein Lächeln auf seine Lippen schleicht, so ist es nur das der Verwunderung, nicht das der Geringschätzung. Er findet es ganz natürlich, dass ein Diner für vier Personen hundertsechzig Dollar kostet. Das ist einmal der Preis auf Standard Island.
»Diese Räuber!«
»Kein Aufhebens machen!« sagt Pinchinat, »Frankreich blickt auf uns! Bezahlen …«
»Und sei es, wie es sei«, fällt Frascolin ein, »schnell fort nach San Diego. Übermorgen besäßen wir nicht einmal so viel, um ein Butterbrot bezahlen zu können.«
Darauf zieht er die Brieftasche, entnimmt dieser eine stattliche Anzahl Papierdollar, die zum Glück auch in Milliard City gelten, und will sie eben dem Oberkellner einhändigen, als eine Stimme ruft:
»Diese Herren sind gar nichts schuldig!«
Es war die Stimme Calistus Munbars.
Der Yankee war eben ruhig lächelnd, in gewohnter guter Laune, in den Saal getreten.
»Er!« fuhr Sébastien Zorn auf, den die Lust anwandelte, jenem an die Kehle zu springen und diese zu drücken, wie er den Hals seines Violoncells beim Forte drückt.
»Beruhigen Sie sich, lieber Zorn«, begann der Amerikaner. »Wollten Sie mir freundlichst alle in den Salon folgen, wo der Kaffee aufgetragen ist? Dort können wir in Ruhe plaudern, und nach Schluss unseres Gesprächs …«
»Erwürge ich Sie!« fiel ihm Sébastien Zorn ins Wort.
»Nein … Sie werden mir die Hände küssen …«
»Ich werde Ihnen gar nichts küssen!« polterte der Violoncellist, der vor Wut einmal blass und einmal blaurot wurde.
Kurze Zeit darauf haben sich’s die Gäste Calistus Munbars auf weichen Sofas bequem gemacht, während sich der Yankee auf einem Schaukelstuhle wiegt.
Hier stellt er sich nun seinen Gästen formgerecht in folgender Weise vor:
»Calistus Munbar, aus New York, fünfzig Jahre alt, Urenkel des berühmten Barnum,1 zurzeit Oberintendant der Künste auf Standard Island, verantwortlich für alles, was Malerei, Skulptur, Musik und im Allgemeinen alle Unterhaltungen in Milliard City angeht. Da Sie mich nun kennen, meine Herren …«
»Sind Sie«, fragt Sébastien Zorn, »nicht zufällig auch Polizeispitzel mit der Verpflichtung, fremde Leute in Fallen zu locken und sie darin wider ihren Willen zurückzuhalten?«
»Übereilen Sie sich mit meiner Beurteilung nicht, Sie reizbares Violoncell, und warten Sie erst das Ende ab.«
»Wir wollen warten«, erwidert Frascolin ernsten Tones, »warten und Sie anhören.«
»Meine Herren«, nimmt Calistus Munbar, sich eine graziöse Haltung gebend, wieder das Wort, »ich wünsche mit Ihnen bei dem jetzigen Gespräch nur die musikalische Frage zu erörtern, so wie diese zurzeit auf unserer Schraubeninsel liegt. Theater besitzt Milliard City allerdings noch nicht, doch wenn es das wollte, würden solche wie durch Zauberschlag aus ihrem Boden aufwachsen. Bisher haben unsere Mitbürger ihre musikalischen Bedürfnisse durch vervollkommnete Apparate befriedigt, wodurch sie über dramatische und lyrische Meisterschöpfungen auf dem laufenden erhalten wurden. Wir hören die alten und neuen Komponisten, die Tagesgrößen der Schauspielkunst, die beliebtesten Künstler mittels der Phonographen, wann und so oft es uns gefällt …«
»Eine Drehorgel, Ihr Phonograph!« warf Yvernes verächtlich ein.
»Doch nicht in der Weise, wie Sie das glauben mögen, mein Herr erster Violinist«, antwortet der Oberintendant. »Wir besitzen Apparate, die mehr als einmal die Indiskretion begangen haben, Ihnen zu lauschen, wenn Sie sich in Boston oder Philadelphia hören ließen. Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie sich hier mit eigenen Händen applaudieren.«
Jener Zeit haben die Erfindungen des berühmten Edison2 nämlich den höchsten Grad der Vollendung erreicht. Der Phonograph ist keineswegs mehr der Musikkasten oder die Spieldose, dem und der er ursprünglich gar zu sehr glich. Dank seinem geistvollen Erfinder bewahrt er jetzt das ephemere Talent der Schauspieler, Instrumentisten oder Sänger für die Bewunderung kommender Geschlechter mit der gleichen Treue auf, wie die Werke der Bildhauer und Maler aufbewahrt bleiben. Ein Echo etwa ist der Apparat geworden, doch ein Echo, treu wie eine Fotografie, das alle Nuancen, alle Feinheiten des Gesanges oder Spiels in unveränderter Reinheit wiedergibt.
Calistus Munbar ergeht sich hierüber mit solcher Wärme, dass es auf seine Zuhörer einen tiefen Eindruck macht.
Er spricht von Saint-Saëns, von Reyer, Ambroise Thomas, von Gounod, Massenet und Verdi, von den unvergänglichen Meisterwerken eines Berlioz, Meyerbeer, Halévy, Rossini, Beethoven und Mozart wie ein Mann, der alle aus dem Grunde kennt, sie zu schätzen weiß und der sich schon lange Zeit bemüht hat, ihren Ruhm noch zu verbreiten, sodass man ihm mit Vergnügen zuhört. Von der schon etwas ablaufenden Wagnerepidemie scheint er jedoch nicht besonders gelitten zu haben.
Als er einmal aussetzt, um Atem zu schöpfen, macht sich Pinchinat die Pause gleich zunutze.
»Das ist ja alles ganz schön und gut«, sagt er; »Ihr Milliard City hat aber nie etwas anderes gehört als Schachtelmusik, als konservierte Melodien, die man ihr wie konservierte Sardinen oder Salt-beef zusendet …«
»Verzeihen Sie, Herr Bratschist …«
»Ja, ja, ich verzeihe Ihnen, bleibe aber doch dabei, dass Ihre Phonographen immer nur Dagewesenes enthalten, dass in Milliard City niemals ein Künstler in dem Augenblick der Ausübung seiner Kunst gehört werden kann …«
»Da möchte ich noch einmal um Verzeihung bitten.«
»Unser Freund Pinchinat verzeiht Ihnen gewiss so oft, wie Sie es wünschen«, bemerkt Frascolin. »Sein Einwurf ist aber dennoch richtig. Ja, wenn Sie sich mit den Theatern Amerikas und Europas in unmittelbare Verbindung setzen können …«
»Halten Sie das für unmöglich, lieber Frascolin?« ruft der Oberintendant, der die Bewegungen seines Schaukelstuhles hemmt.
»Sie behaupten das wirklich?«
»Ich sage nur, dass das ausschließlich eine Geldfrage ist, und unsere Stadt ist reich genug, um sich alle Liebhabereien, jedes Verlangen bezüglich der lyrischen Kunst gewähren zu können. Das ist auch bereits geschehen …«
»Aber wie?«
»Mittels der Theatrophone, die im Konzertsaale des Kasinos aufgestellt sind. Die Gesellschaft besitzt ja zahlreiche unterseeische Kabel, die den Großen Ozean durchziehen und von denen das eine Ende an der Madeleinebai ausläuft und das andere durch unsere großen Bojen schwimmend erhalten wird. Wünscht nun einer unserer Mitbürger einen Sänger der Alten oder Neuen Welt zu hören, so fischt man eines jener Kabel auf und benachrichtigt telefonisch die Beamten an der Madeleinebai. Diese stellen dann die Verbindung mit Europa oder Amerika her. Man verbindet die Drähte oder Kabel mit dem oder jenem Theater, dem oder jenem Konzertsaale, und unsere, hier im Kasino weilenden Dilettanten wohnen den entferntesten Aufführungen bei und applaudieren …«
»Ja, da draußen hört man ihre Beifallsbezeugungen aber gar nicht!« ruft Yvernes.
»Da muss ich um Verzeihung bitten, lieber Herr Yvernes, gewiss hört man sie mittels einer vorhandenen Rückleitung.«
Hierauf verliert sich Calistus Munbar in transzendentale Erörterungen über die Musik nicht allein als Kunst, sondern auch als therapeutisches Agens. Nach dem Systeme J. Harfords, von der Westminster-Abtei, haben die hiesigen Milliardäre mit der Ausnützung der lyrischen Künste schon ganz erstaunliche Erfolge erzielt. Dieses System gewährleistet ihnen einen Zustand vollkommener Gesundheit. Die Musik übt eine Reflexwirkung auf die Nervenzentren aus, die harmonischen Vibrationen helfen zur Erweiterung der arteriellen Gefäße und beeinflussen den Blutumlauf, den sie nach Bedarf beschleunigen oder verlangsamen. Sie bewirkt eine Anregung der Herztätigkeit und der Atembewegungen je nach Klangfarbe und Intensität des Tones, wobei sie gleichzeitig die Ernährung der Gewebe unterstützt. Deshalb hat man in Millard-City auch Einrichtungen getroffen, durch die beliebige Mengen musikalischer Energie auf telefonischem Wege in die Einzelwohnungen geleitet werden können.
Das Quartett hört ihm mit offenem Munde zu. Noch nie hat es über seine Kunst von medizinischem Standpunkte aus reden gehört, und wahrscheinlich ist es darüber nicht gerade entzückt. Nichtsdestoweniger geht der fantastische Yvernes sofort auf diese Theorien ein, die übrigens – man denke an den berühmten Harfenisten David – bis zurzeit des Königs Saul zurückreichen.
»Jawohl, jawohl! …« ruft er nach der letzten Tirade des Oberintendanten, »das ist ganz richtig. Es gehört nur eine gute Diagnose dazu! Wagner und Berlioz z.B. sind indiziert für anämische Konstitutionen …«
»Gewiss, und Mendelssohn oder Mozart für sanguinische Temperamente, bei denen sie das Strontiumbromür vorteilhaft ersetzen!« fügt Calistus Munbar hinzu.
Da mischt sich Sébastien Zorn ein und schleudert einen rauen Missklang in diese hochfliegende Plauderei.
»Um alles das handelt es sich gar nicht«, ruft er barsch. »Warum haben Sie uns überhaupt hierhergeführt?«
»Weil die Saiteninstrumente es sind, die grade die mächtigste Wirkung ausüben.«
»Wirklich? Also um Ihre männlichen und weiblichen Nervenkranken zu beruhigen, haben Sie unsere Reise unterbrochen, uns verhindert, in San Diego einzutreffen, wo wir morgen ein Konzert geben sollen …«
»Ja, ja, deshalb, meine vortrefflichen Freunde!«
»Und Sie erblickten in uns nichts anderes, als musikalische Karabiner, als lyrische Apotheker?« ruft Pinchinat.
»O nein, meine Herren«, versichert Calistus Munbar sich erhebend. »Ich betrachtete Sie nur als Künstler von großem Talent und weitreichendem Renommee. Die Hurras, die dem Konzert-Quartett bei seinen Reisen durch Amerika entgegendröhnten, sind auch bis zu unserer Insel gedrungen. Da glaubte die Standard Island Company den Zeitpunkt gekommen, die Phonographen und Theatrophone einmal durch wirkliche Virtuosen mit Fleisch und Bein ersetzen und den Milliardesern den unbeschreiblichen Genuss einer unmittelbaren Vorführung der Meisterwerke der Kunst verschaffen zu sollen. Sie wollte dabei und vor der Errichtung eines Opernorchesters mit der Kammermusik den Anfang machen. Dabei dachte sie an Sie, die hervorragendsten Vertreter dieser Musikgattung, und mir gab sie den Auftrag, Sie um jeden Preis hierherzuschaffen, im Notfalle, Sie zu entführen. Sie sind also die ersten Künstler, die in Standard Island auftreten werden, und ich überlasse es Ihnen, sich auszudenken, welcher Empfang Ihnen bevorsteht!«
Yvernes und Pinchinat fühlen sich von den enthusiastischen Worten des Oberintendanten tief ergriffen. Dass die Geschichte auf eine Mystifikation3 hinauslaufen könnte, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Der mehr überlegende Frascolin fragt sich, ob dieses Abenteuer wirklich ernst zu nehmen sei. Doch warum sollte auf dieser ganz außergewöhnlichen Insel nicht auch alles andere ein außergewöhnliches Aussehen haben? Nur Sébastien Zorn beharrt dabei, sich nicht zu ergeben.
»Nein, mein Herr«, ruft er, »man bemächtigt sich fremder Leute nicht in dieser Weise ohne deren Einwilligung! … Wir werden gegen Sie Klage erheben …«
»Klage … wo Sie, Undankbare, mir tausendmal danken sollten?« erwidert der Oberintendant.
»Und es wird uns eine Entschädigung zugesprochen werden, mein Herr …«
»Eine Entschädigung … wo ich Ihnen hundertmal mehr zu bieten habe, als Sie erhoffen könnten …«
»Um was handelt es sich?« fragt der praktische Frascolin.
Calistus Munbar zieht sein Portefeuille hervor und entnimmt ihm ein Blatt Papier mit dem Stempel von Standard Island, das er den vier Künstlern vor Augen hält.
»Ihre vier Unterschriften unter diesen Kontrakt«, sagt er, »und die ganze Angelegenheit ist geregelt.«
»Etwas unterschreiben, ohne es gelesen zu haben?« antwortet die zweite Violine. »Das geschieht nie und nirgends!«
»Sie dürften aber keine Ursache haben, es zu bereuen«, fährt Calistus Munbar fort, der jetzt so heiter wird, dass er von oben bis unten wackelt. »Doch meinetwegen, gehen wir ordnungsmäßig zuwege. Hier habe ich einen Engagementsvertrag, den die Kompanie Ihnen anbietet, ein Engagement für ein Jahr von heute ab, das Sie verpflichtet zur Aufführung derselben Kammermusikstücke, die Ihre Programme in Amerika enthielten. Nach zwölf Monaten wird Standard Island an der Madeleinebai zurücksein, und Sie werden da zeitig genug eintreffen …«
»Für unser Konzert in San Diego, nicht wahr?« ruft Sébastien Zorn, »für San Diego, wo man uns mit Pfeifen empfangen wird …«
»Nein, meine Herren, mit Hips und Hurras! Künstler wie Sie zu hören, fühlen sich alle Leute gar zu geehrt und sind glücklich, wenn sich solche hören lassen … selbst mit einem Jahre Verspätung!«
Mit einem solchen Mann soll einer nun etwas anfangen!
Frascolin ergreift das Blatt und durchliest es aufmerksam.
»Ja, welche Garantie wird uns geboten?« fragte er.
»Die Garantie der Standard Island Company, bestätigt durch die Unterschrift unseres Gouverneurs, des Herrn Cyrus Bikerstaff.«
»Und die Bedingungen sind genau so, wie sie hier stehen?«
»Ganz genau, also eine Million Francs …«
»Für uns vier!« fällt Pinchinat ein.
»Für jeden einzelnen«, antwortet Calistus Munbar lächelnd, »und diese Summe steht noch außer Verhältnis zu Ihren Verdiensten, die doch niemand voll zu bezahlen vermöchte!«
Liebenswürdiger kann einer doch nicht wohl sein. Dennoch erhebt Sébastien Zorn Widerspruch. Er will um keinen Preis annehmen, sondern unbedingt nach San Diego abreisen, sodass Frascolin große Mühe hat, seine Entrüstung zu dämpfen.
Er will um keinen Preis annehmen.
Gegenüber dem Angebote des Oberintendanten erscheint indes etwas Misstrauen am Platze. Ein Engagement auf ein Jahr mit dem Honorar von einer Million Francs für jeden der Künstler … durften sie das ernst nehmen? Ja, ganz ernst, wie Frascolin versichern konnte, als er fragte: »Und das Honorar ist zahlbar? …«
»Vierteljährlich, und hier bringe ich es für die ersten drei Monate.«
Aus ganzen Stößen von Bankscheinen, die sein Portefeuille zum Platzen füllen, formt Calistus Munbar vier Pakete mit je fünfzigtausend Dollar oder zweihundertfünfzigtausend Francs, die er Frascolin und dessen Kameraden einhändigt.
Das ist so ein amerikanisches Geschäftsverfahren.
Nun geht die Sache dem Sébastien Zorn doch etwas näher. Da die schlechte Laune bei ihm aber niemals ihre Rechte aufgibt, bemerkt er weiter:
»Ganz schön; doch bei dem Preise, in dem auf Ihrer Insel alles steht und wo man fünfundzwanzig Francs für ein Rebhuhn bezahlt, da wird man jedenfalls hundert Francs für ein Paar Handschuhe und fünfhundert Francs für ein Paar Stiefel anlegen müssen?«
»O, Herr Zorn, die Kompanie legt auf solche Kleinigkeiten kein Gewicht«, erklärt Calistus Munbar, »und sie wünscht, dass die Künstler des Konzert-Quartetts während ihres hiesigen Aufenthalts von allen Nebenkosten frei bleiben.«
Womit konnte man auf ein so großmütiges Angebot anders antworten, als mit der Namensunterschrift unter den Kontrakt?
Frascolin, Pinchinat und Yvernes bequemen sich dazu ohne Zögern. Nur Sébastien Zorn brummt, dass das Ganze ein Unsinn sei, sich auf einer beweglichen Insel einzuschiffen, das habe keinen Verstand … man werde schon sehen, wie die Geschichte endigen würde usw. – Schließlich ließ er sich aber doch herbei, mit zu unterzeichnen.
Wenn Frascolin, Pinchinat und Yvernes nach Erfüllung dieser Formalität dem Calistus Munbar auch nicht die Hände küssten, so drückten sie sie ihm wenigstens herzlichst. Vier Händedrücke, jeder zu einer Million!
So ließ sich das Konzert-Quartett also auf ein Abenteuer sondergleichen ein, und unter genannten Umständen wurden die vier Künstler die Gäste – inviti – Standard Islands.
1 Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) war ein US-amerikanischer Zirkuspionier und Politiker. <<<
2 Nach Joseph Swan und Thomas Edison, die zunächst die Glühbirne unabhängig voneinander entwickelt und dann ab 1883 gemeinschaftlich arbeiteten. <<<
3 Verschleierung, Verdunkelung <<<