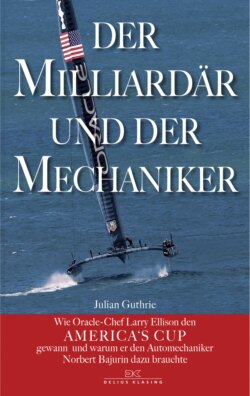Читать книгу Der Milliardär und der Mechaniker - Julian Guthrie - Страница 11
St. Francis Yacht Club
Sommer 2000
ОглавлениеLarry musterte die Männer in ihren Club-Blazern und Krawatten, die im Nordwest-Saal des St. Francis Yacht Clubs mit Blick auf die Bucht von St. Francisco beisammensaßen. An seiner Seite war Bill Erkelens, der im St. Francis aufgewachsen war und hier segeln gelernt hatte, wo sein Vater Mitglied war. Larry war etwa 1995 in den St. Francis eingetreten, als man ihm zu seinem Leidwesen – er war kein Vereinsmensch – erklärt hatte, dass er ohne Mitgliedschaft in einem Verein nicht an großen Regatten teilnehmen könnte. Nun, da er um den America’s Cup kämpfen wollte, brauchte er wieder einen Yacht-Club.
Nach den Cup-Regeln wetteifern Clubs und nicht Einzelpersonen um die älteste Sporttrophäe der Welt. Die meisten nahmen an, dass der St. Francis Larry in seinen Bemühungen unterstützen würde. Ein Modell seiner SAYONARA, die bis dahin fünf Maxi-Weltmeisterschaften gewonnen hatte, war dort ausgestellt. Larrys Tochter Megan besuchte die gleiche Schule wie die Tochter des künftigen Kommodore Charles Hart. Im America’s Cup 2000 hatte der St. Francis Yacht Club ein Team namens AmericaOne mit Skipper Paul Cayard unterstützt. Das Team war bis ins Louis-Vuitton-Cup-Finale vorgedrungen, unterlag dort aber der italienischen Prada Challenge. Im Sommer war der Nachlass von AmericaOne für rund sieben Millionen Euro an Larry verkauft worden. Darunter befanden sich Ausrüstung, Begleitboote, Werkstattcontainer und die beiden Yachten, die von Paul Cayard im letzten Cup gesegelt worden waren. Als Teil des Deals würde Paul Cayard Mitglied im Oracle Racing Team werden. Das Team würde die Yachten im Training einsetzen, während die neuen Yachten gebaut wurden. Mit dem Kauf der AmericaOne-Bestände und der Verpflichtung der Talente hatte Erkelens, der die Verhandlungen für Larry führte, dem St. Francis Yacht Club eine Art »Vorkaufsrecht« eingeräumt. Die Gespräche zwischen beiden Parteien waren weiter geglitten wie ein Boot an einem warmen Sommertag: reibungslos und ohne Zwischenfälle. Die optimistischen Prognosen hielten sich bis in den Herbst, als sich beide Seiten auf ein Treffen einigten.
Nach dem ersten Austausch von Höflichkeiten setzten sich die Männer an einen langen Tisch, wo Getränke gereicht wurden. Larry nahm ein Mineralwasser. Die Diskussion landete bei Larrys Namensgebung für die Yacht, einem Punkt, der schon in einer früheren Diskussion zwischen Kommodore Bruce Munro und Erkelens Thema gewesen war. Munro schlug den Namen »The Spirit of San Francisco« vor. Larry, der bislang wenig Gedanken an die Namensgebung verschwendet hatte, sagte, dass er das Boot wahrscheinlich »Oracle« nennen würde. Zu seiner Überraschung wurde ihm gesagt, dass dieser Name »zu kommerziell« sei. Er verfolgte die Diskussion, in deren Verlauf weitere Vorschläge wie »Gold Rush« und »Spirit of ’49« gemacht wurden. Er nickte und katzbuckelte hin und wieder vor Namen, die er als schrecklich empfand. Dann dachte er bei sich: »Ach du meine Güte, ich kann noch nicht einmal den Namen für mein Boot aussuchen.« Er war außerdem fassungslos über den Kommentar »zu kommerziell«. Er wusste von Vereinen und Yacht-Clubs, in denen Segeln auf den Amateurgedanken reduziert und kommerzielle Werbung verboten war. Doch der America’s Cup war kein solches Rennen. Zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten. In den ersten 100 Jahren waren die Kosten im America’s Cup von reichen Männern getragen worden, die man als sogenannte Corinthians bezeichnete – vermögende Hobby-Segler. Doch Mitte der 1970er-Jahre hatte sich das Bild durch einen neuen Typus verändert. Es war Dennis Conner selbst, der in den 1980er-Jahren das Amateurmodell verdrängte und ein neues System einführte. Nun wurde das ganze Jahr über trainiert. Profis absolvierten Testserien und führten kommerzielles Sponsoring ein. Das veranlasste Ted Turner zu der Beschwerde, dass er nicht dieses Maß an Zeit zum Training habe.
Schließlich sagte Larry in schwermütigem Ton: »Ich verstehe das nicht. Ich kann den Namen für mein Boot nicht selbst aussuchen?« Dabei gab es doch sogar ein America’s-Cup-Team, das nach einem Schuhhersteller-Team benannt worden war.
Larry wurde versichert, dass der St. Francis Yacht Club einen Namen finden würde.
Larry und Erkelens schauten sich an. Für einen Moment blendete Larry in die Tage seiner Kindheit zurück. Damals war er zu arm und zu jüdisch, um in den Chicago Yacht Club aufgenommen zu werden. Der einzige Weg in den Club hätte damals für ihn über einen Job als Kellner oder Tellerwäscher geführt.
Sie räusperten sich und fuhren fort. Erkelens und Larry wollten besprechen, was geschehen würde, falls sie den Cup gewinnen und nach Hause bringen könnten.*
Larry wollte eine Garantie, dass sein Team den Cup in der Bucht von San Francisco verteidigen würde. Nach den Cup-Regeln hat der verteidigende Yacht-Club das Recht, den Verteidiger auszusuchen. Larry hatte die Sorge, dass der St. Francis Yacht Club ein anderes Syndikat zur Verteidigung auswählen könnte. Eines, das vom »Lieblingssohn« Paul Cayard geführt werden könnte. Dieser gutaussehende charismatische Mann war der Stolz der Bucht und ein ausgezeichneter Segler. 1998 war Cayard der erste Amerikaner, der das Whitbread Round the World Race gewonnen hatte. Und Cayard hatte bereits in einer Handvoll America’s-Cup-Teams ge segelt: 1983, 1987, 1992, 1995 und für den St. Francis Yacht Club im Jahre 2000.
Larry hatte in seinen ersten Rennen auf SAYONARA mit Paul gesegelt. Er war kein Fan von ihm und beschied Erkelens irgendwann, dass er Cayard niemals wieder auf dem Boot haben wollte. Doch Cayard war Teil des Paket-Deals und eine der geplanten Führungsfiguren. Zumindest zu diesem Zeitpunkt.
»Larry, nicht du gewinnst den Cup«, sagte der Vizekommodore Steve Taft, der selbst zwei Cup-Kampagnen gesegelt hatte. »Der St. Francis Yacht Club gewinnt den Cup. Genau wie der New York Yacht Club vor uns, so werden auch wir entscheiden, wer den Cup verteidigt.« Taft und andere erklärten Larry, dass sie voraussichtlich eine Qualifikationsserie ausschreiben würden, wenn sie den Cup gewännen, um den künftigen Verteidiger zu ermitteln. Und dass es Larry freistünde, daran teilzunehmen. Larry wusste, dass die Art und Weise der Auswahl des Verteidigers seitens des New York Yacht Clubs eine persönliche und politische und keineswegs nur eine sportliche Entscheidung sein konnte, nach der das aussichtsreiche Boot ausgewählt würde. Der New York Yacht Club, der den Cup zwischen 1851 und 1983 innehielt und ihn 25-mal verteidigt hatte, behandelte die Regatta wie sein Eigentum.
Den Cup zu gewinnen war seit Jahrzehnten ein Traum des St. Francis Yacht Clubs. Für einige Mitglieder war er zur Obsession geworden. Der Club hatte in den Jahren 1987 und 2000 zwei Syndikate unterstützt. Die Begierde war so stark, dass Club-Mitglieder sogar schon einen provisorischen Regattakurs für den etwaigen Tag entworfen hatten, an dem der Club die Cup-Rennen in die Bucht bringen würde. Die Boote würden ein Dreieck segeln und vor Fisherman’s Wharf starten. Von dort ging es hoch zur Golden Gate Bridge, zu einer Marke nördlich von Alcatraz und dann zurück zum Fisherman’s Wharf.
Seit seiner Premiere war der America’s Cup von den elitärsten Clubs gewonnen worden, zu denen lange Zeit auch der St. Francis Yacht Club zählte. Er war das wahre Zentrum der feinen Gesellschaft San Franciscos. Der Eisenbahnbaron C. Templeton Crocker war einer seiner ersten Kommodores gewesen. Unter seinen heutigen VIP-Mitgliedern waren Persönlichkeiten wie Roy Disney, stellvertretender Vorsitzender des Unternehmens Walt Disney, George Gund, Besitzer des Eishockey-Teams der San José Sharks, Fritz und Lucy Jewett, Langzeit-Fans des America’s Cups, und Ray Dolby, milliardenschwerer Gründer der Dolby Laboratories. Hier waren auch die Weltklassesegler Jeff Madrigali, Paul Cayard und Bob Billingham zu Hause. Und ein Nachwuchsprogramm, das auf die Ausbildung künftiger Champions ausgerichtet war.
Erkelens, der einigen Männern gegenübersaß, mit denen er hier segelnd groß geworden war, wusste, dass sie Larry auch im Falle eines Cup-Sieges und des möglicherweise folgenden Sieges in einer Verteidigerserie immer noch beiseitedrängen konnten, falls sie nicht miteinander auskamen. Es gab da eine Redensart rund um den New York Yacht Club aus den frühen Cup-Zeiten: »Britain rules the waves; America waives the rules.« (Dt.: »England beherrscht die Wellen; Amerika lässt die Regeln außer acht.«). Eine der ersten Regeln, die der New York Yacht Club nach seinem Sieg im Jahre 1851 festlegte, war diese: Alle Wettstreiter mussten die Abmessungen und Design-Details ihrer Boote vorlegen. Das war so, als hätte man die anderen Teams aufgefordert, ihre sportlichen Pläne offen darzulegen. Der St. Francis Yacht Club hatte seine eigenen Regeln. Und was ein Ausschuss genehmigte, konnte der nächste ebenso gut wieder ändern. Der Club hatte zwei Spitznamen: »St. Frantic« (dt.: St. Hektik) aufgrund seiner berühmt-berüchtigten hektischen Mitglieder und – aus jüngerer Zeit – »St. Fancy« (dt.: St. Nobel). Erkelens war sicher, dass sein Boss keine 100 Millionen US-Dollar von seinem privaten Geld ausgeben würde, wenn er keine Garantien erhielte. Sie mussten sich Rechte erkämpfen. Larry erklärte, dass er den Club-Vorstand nicht kontrollieren wolle, dass er aber im Falle eines Sieges definitiv auch die Rolle des Verteidigers übernehmen wolle. Er und Erkelens schlugen vor, einen Vorstand innerhalb des St.-Francis-Vorstands zu installieren, der sich ausschließlich mit America’s-Cup-Angelegenheiten beschäftigen sollte. Sie schlugen vor, zwei ihrer eigenen Teammitglieder in diesem Club-Vorstand zu platzieren. Der St. Francis würde ebenfalls zwei seiner Mitglieder nominieren. Diese vier würden dann ein fünftes Mitglied wählen. So hätten beide Seiten das gleiche Maß an Kontrolle. Der Vorschlag wurde ebenso abgelehnt wie der Name »Oracle« für das Boot. Auch unter Druck war der St. Francis Yacht Club nicht bereit nachzugeben. Das wäre ja, als würde man in San Franciscos »Bohemian Club« für Herren plötzlich auch Frauen einlassen.
Larry, bekleidet mit einem braunen Anzug und einem schwarzen Rollkragenpullover, wurde im Verlauf des Gesprächs immer unbehaglicher zumute. Sein Anzug hatte keine Messingknöpfe, und er trug auch keine Krawatte mit Flaggen oder Schiffen darauf. Er trug überhaupt keine Krawatte. Und er hatte auch keinen Spaß daran, dort zu sitzen und sich sagen zu lassen, wie der America’s Cup funktionierte.
Die Vorstandsmitglieder im St. Francis Yacht Club waren höflich, aber hart wie seine Grammatiklehrer in der Schule. Wann immer Larry in eine Ecke gedrängt wurde, genoss er es, einen unerwarteten Ausweg zu finden. Als er zwölf Jahre alt war, erwarteten seine Eltern, die ihn regelmäßig mit in die Synagoge genommen hatten, dass er eine hebräische Schule besuchte, sodass er die Bar Mitzwa empfangen konnte. Sobald jedoch die »Little League«, eine Softball- und Baseball-Liga für Kinder und Jugendliche in den USA begonnen hatte, entschied sich Larry, nicht mehr zum Unterricht der hebräischen Schule zu gehen. Eines Tages kam der Rabbi zu ihnen nach Hause und sagte seinen Eltern: »Wenn er damit fortfährt, den Hebräischunterricht zu schwänzen, um Baseball spielen zu gehen, dann wird er ausgeschlossen.« Larry gab dem Sport gegenüber dem Hebräisch den Vorzug und wurde – nicht ohne Stolz – aus der Schule hinausgeworfen. Die Bar Mitzwa empfing er nie, aber er verbesserte die Geschwindigkeit seiner Würfe, wenn auch nicht ihre Kontrolle.
Aus der Sicht des St. Francis Yacht Clubs hatte man es hier mit Larry Ellison zu tun, einem der reichsten Männer der Erde, einem, der anfällig war für schillernde Meinungsäußerungen und Superlative, einem Mann, der seinen eigenen Düsenjäger als Pilot steuerte, seine Yacht als Skipper führte und mindestens zehn Hochleistungswagen besaß, alle im gleichen platinfarbenen Ton. Er war ein Mann, der daran gewöhnt war, zu bekommen, was er wollte. Was immer dazu nötig war. Er verkörperte die Neureichen, viele der Vorstandsmitglieder den alten Geldadel. Er studierte Yacht-Clubs, sie wurden in die Clubs hineingeboren.
Der zukünftige Kommodore Hart hörte den Verhandlungen zu. Er mochte Larry und empfand ihn als überraschend liebenswürdig. Doch zu dem Vorschlag, einen Vorstand innerhalb des Vorstands zu etablieren, sagte er: »Das können wir einfach nicht machen.«
Erkelens erkannte, dass sie in einer Sackgasse steckten. Er versuchte zu erklären, dass sie nicht die Macht im Vorstand übernehmen wollten. Sie wollten drei von fünf Mitgliedern in einem neu formierten America’s-Cup-Vorstand platzieren. Taft schüttelte den Kopf. Er sagte, »es würde aussehen, als hätte Larry sich in den Vorstand eingekauft.«
Taft – buschige Augenbrauen in der Form eines Bumerangs, rasierter Kopf und ein vom lebenslangen Segeln wettergegerbtes Gesicht – erklärte: »Der Aufsichtsrat hat nicht die Befugnisse, den Club umzupolen. Wir haben Statuten, Regeln und Vorschriften. Und wir müssen im Rahmen der Gesetze für gemeinnützige Vereine agieren. Zu allem benötigen wir die Zustimmung der Mitglieder. In der Satzung steht beispielsweise, dass man acht Jahre Vereinsmitglied sein muss, bevor man einen Vorstandsposten übernehmen kann. Und wir können keine Mitglieder im Vorstand haben, die nicht gewählt worden sind.«
In Larrys Kopf ging das Meeting noch lange Zeit nach dem offiziellen Ende weiter. Larry und Erkelens waren verblüfft, dass sich der St. Francis Yacht Club nicht bewegen ließ. Larry sagte, dass er nicht jedes Mal zum Vorstand rennen würde, wenn er etwas brauchte. Er sagte Erkelens, dass er die Leute vom St. Francis Yacht Club nicht ablehne und er ihre Auffassung nicht gänzlich unvernünftig finde. Am Ende jedoch wollte er ihnen nicht die Kontrolle überlassen. Aus dem gleichen Grund hatte er keinen Fahrer. Die gleichen Motive ließen ihn seine eigenen Flugzeuge fliegen, dreimal heiraten und sich dreimal wieder scheiden lassen. Er mochte es einfach nicht, wenn man ihm sagte, was er tun konnte und was nicht.
»Das passt so einfach nicht für mich«, sagte Larry mit leiser Stimme zu Erkelens. »Wenn wir gewinnen, dann will ich eine Garantie, dass wir den Cup auch verteidigen.«
Während Hart immer noch dachte, dass ein Deal ausgehandelt werden konnte – welche anderen Möglichkeiten gab es denn auch in dieser Stadt? –, winkte Vizekommodore Steve Taft Erkelens beim Rausgehen zu sich. Taft kannte Erkelens’ Vater und hatte Billy dabei zugeschaut, wie er das Segeln gelernt hatte. Die beiden fanden eine ruhige Ecke. Taft nahm Erkelens am Arm und sagte: »Das hier wird nicht so hinhauen wie geplant.« Erkelens blinzelte und sagte: »Wie bitte? Was soll das heißen?« Taft antwortete: »Es wird so nicht laufen, das ist ein Nein.«
Eine Woche später sprach Taft beim wöchentlichen Stammmittagessen im eleganten Grillrestaurant des Clubs mit Blick über die Bucht zu den Mitgliedern. Taft und weitere Mitglieder des Vorstands wollten erklären, warum sie gegen eine Partnerschaft mit Larry Ellison stimmten. Und sie hatten ihre Fürsprecher, die stolz und gebetsmühlenartig verkündeten: »Der St. Francis Yacht Club ist nicht käuflich.« Doch es gab auch andere, die der Auffassung waren, dass sie einen gigantischen Fehler machten.
Vorstandsmitglied Peter Stoneberg verfolgte die emotionale Debatte.
»Hier habt ihr einen Mann, der bereit ist, für alle zu zahlen, und als Gegenleistung lediglich ein paar einfache Garantien verlangt«, argumentierte Stoneberg in das Gemisch aus Buhrufen und Applaus hinein. »Der Cup wird immer teurer. Und es kommt nicht jeden Tag ein Milliardär durch die Tür spaziert, der bereit ist, buchstäblich alles zu bezahlen. Stellt euch doch nur einmal vor, dass wir gewinnen!«
Auch Taft war überrascht vom Ausmaß der Meinungsverschiedenheit und fühlte sich von der ganzen Sache überrollt. Die Entscheidung war nicht leicht zu treffen gewesen.
Cayard, loyal gegenüber dem St. Francis Yacht Club, aber gleichzeitig unter Vertrag bei Oracle Racing, wusste über Larry Bescheid. Der würde nicht in einen Deal einwilligen, bis er sichergestellt hatte, dass er den Laden schmeißen würde. Cayard war bestürzt, als er Clubmitglieder geradezu damit prahlen hörte, dass sie Larry Ellison abgelehnt hatten und nicht daran dächten, irgendeinem Milliardär die Tür zu öffnen und ihren geschätzten Club kaufen zu lassen. Einem lokalen Segelmagazin hatte Kommodore Munro gesagt: »Im Kern wollen sie unseren Yacht-Club kaufen. Wir stehen aber nicht zum Verkauf.« Nicht alle Clubmitglieder waren so resolut. Cayard schickte einen Beschwerdebrief an den Vorstand des St. Francis Yacht Clubs.
Ich schreibe, um meiner Enttäuschung über Ihre Verhandlungsführung mit Oracle Racing Ausdruck zu verleihen. Ich bin aus zwei Gründen enttäuscht. Zum einen, weil unser Kommodore es für angemessen hielt, die Verhandlungen in öffentlichen Foren wie »Scuttlebutt« oder »Latitude 38« zu diskutieren. Und zum anderen, weil die Schilderungen des Angebots seitens unseres Kommodores nicht präzise sind. Und das ist noch höflich ausgedrückt.
Ich habe bei »Latitude 38« die folgenden Zitate gelesen: »Doch weil der St. Francis Yacht Club eine kalifornische Körperschaft ist, verlangt das Gesetz, dass sie (die Vorstände) gewählt werden. Deswegen konnte der Club Oracles Bitte aus formalen Gründen nicht entsprechen. Selbst, wenn er es gewollt hätte.« Das ist falsch. Das Angebot von Oracle Racing hat insbesondere hervorgehoben, dass Vorstandsmitglieder gewählt werden müssten und dass Änderungen der Statuten eine Mehrheit der Mitgliederstimmen benötigen. Beides war berücksichtigt.
Weiter hieß es im selben Artikel und in der Mitgliedermitteilung des Kommodores, dass Oracle Racing den Vorstand darum ersucht hätte, die Mitgliedschaft zu garantieren. Aber das steht einfach nirgendwo.
Die Behauptung des Kommodores »Aber nach Rücksprache mit unseren Anwälten erfuhren wir, dass wir keine dieser Maßnahmen durchführen konnten« ist sowohl falsch als auch beleidigend.
Die Tatsache, dass Oracle Racings Angebot für den Vorstand des St. Francis Yacht Clubs inakzeptabel ist, ist keine gute und ausreichende Begründung, um falsche Erklärungen abzugeben und ein Alibi zu zimmern, um eine Entscheidung zu rechtfertigen.
Ich empfinde dieses Verhalten als unprofessionell und als Mitglied beschämend. Um es deutlich zu sagen: Das ist nicht die Art von Führungsqualität, die ich in von unserem Club gewohnt bin.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Cayard
Charles Hart, der den Deal gern perfekt gemacht hätte und Paul Cayards Brief besorgt gelesen hatte, sagte gegenüber dem Vorstand: »Das hier ist eine sehr große Enttäuschung für den Club.« Das Bedauern schwang hörbar in seiner Stimme mit.
* In einer späteren Rückbesinnung sagte Bruce Munro, dass der Name des Bootes und die Einzelheiten einer Verteidigung kein Diskussionsthema dieses Meetings gewesen seien. Meine Berichterstattung inklusive der Interviews mit weiteren Teilnehmern der Meetings hat mich zu der Annahme geführt, dass diese Themen zu der Zeit diskutiert wurden.