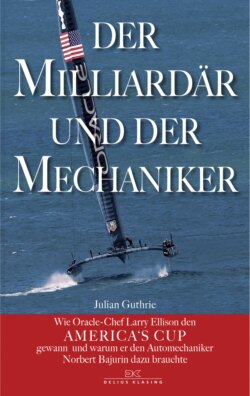Читать книгу Der Milliardär und der Mechaniker - Julian Guthrie - Страница 15
In den Bergen von Santa Barbara
Sommer 2001
ОглавлениеChris Dickson, Chef von Larrys America’s-Cup-Team, stand hinter der geöffneten Bustür und starrte Bill Erkelens’ Sekretärin wütend an. Diese wiederum befand sich auf dem Gehweg und hielt ein Klemmbrett in ihren Händen.
»Steig in den Bus ein. Wir fahren«, sagte Dickson.
»Es fehlen noch zwei Leute, und Bill sagt, dass wir noch nicht losfahren können«, antwortete die Sekretärin.
Die 140 zu Oracle Racing gehörenden Männer und Frauen schwitzten in der Hitze und waren müde. Sie wollten das Pfadfinder-Camp verlassen, das sie in den bewaldeten Hügeln von Santa Barbara für ein Teambuilding-Wochenende gemietet hatten. Erkelens war bemüht, nicht selbst in Rage zu geraten. Er hatte dem Team gesagt, dass sie warten müssten, und war gerade dabei, einem Assistenten bei der Suche nach den Nachzüglern zu helfen, als er plötzlich lauter werdende Stimmen hörte.
»Wir müssen warten«, beharrte die Sekretärin.
Dickson stieg die Stufen herab und baute sich direkt vor der Sekretärin auf, die im sechsten Monat schwanger war.
»Nein«, sagte Dickson. Er pochte ihr mit seinem Zeigefinger auf den Brustkorb und machte seinem Ärger in verändertem Tonfall mit wütenden Worten Luft: »Wir … werden … jetzt … fahren.«
Erkelens stand ganz in der Nähe. Bewegungsunfähig. Ganz im Gegensatz zum Ehemann der Frau. Er war einer der Köche des Teams, stürzte nun vom hinteren Teil des Busses nach vorn und konnte gerade noch aufgehalten werden, bevor er Dickson erreichte. »Nimm sofort deine verdammten Hände von meiner Frau«, schrie der stellvertretende Küchenchef aus dem Inneren des Busses.
Erkelens schüttelte den Kopf. Und das alles nach einem Wochenende, an dem es um Teamgeist gegangen war. Er hatte alles in seiner Macht Stehende für einen besseren Zusammenhalt getan, Barbecues mit dem Team veranstaltet, an Freitagabenden ganze Restaurants für das Team gebucht und nun sogar zum Preis von 50 000 US-Dollar ein ganzes Wochenende für ein besseres Miteinander organisiert. Doch statt der erhofften Einheit hatte die Spannung zwischen den amerikanischen Seglern und Bootsbauern, die mit »AmericaOne« gekommen waren, und den Kiwi-Seglern und Bootsbauern aus dem SAYONARA-Team noch weiter zugenommen.
Dickson sah es so: Der Erwerb des AmericaOne-Pakets beinhaltete eine giftige Pille – die Leute. Die AmericaOne-Crew verhielt sich arrogant gegenüber der von Kiwis beherrschten SAYONARA-Crew und war überzeugt, dass es ihre Kampagne war, in die Larry sein Geld pumpte. Nach Erkelens’ Ansicht waren in Wirklichkeit die Kiwis besser. Sie arbeiteten härter, hatten mehr Talent und stellten weniger Ansprüche. Darin waren sich Erkelens und Dickson sogar einig. »Wenn ein Müllberg beseitigt werden muss«, sagte Dickson, »dann werden die Amerikaner im Team zunächst darüber debattieren, wie das zu geschehen hat und wer es macht. Gleichzeitig werden die Neuseeländer sich die Schaufeln greifen und den Haufen einfach beseitigen.« Auch innerhalb der Organisationsstruktur schien sich jede Gruppe der anderen überlegen zu fühlen: Die Ingenieure hatten den Verstand, die Segler aber die Muckis. Und die Landmannschaft hatte gar beides. So oder ähnlich schienen die sich bekriegenden Gruppierungen zu denken.
An dem Wochenende in Santa Barbara hatten sie alle teilgenommen: die Ingenieure, die Bootsbauer, die Manager, die Sekretärinnen, die Landmannschaft, die Köche, die Trainer und die Segler. Erkelens hatte die bekannte britische Firma Enabling Visions angeheuert. Deren Motto lautete »Die Kunst des Erfolgs«. Die Agentur arbeitete mit Sportmannschaften und größeren Unternehmen und rühmte sich ihrer Mitarbeiter, die aus den Reihen früherer Marinesoldaten rekrutiert wurden. Erkelens arbeitete sich in die Grundlagen einer America’s-Cup-Kampagne ein, in deren Rahmen Teammitglieder entwurzelt werden und ihr Zuhause zurücklassen müssen. Sie müssen sieben Tage die Woche zusammen arbeiten und zusammen leben. Der Wettbewerb läuft über Jahre. Das sich ständig verändernder Umfeld erfordert eine konstant hohe Motivation sowie die Fähigkeit zur Anpassung.
America’s-Cup-Veteran Tom Ehman, Oracle Racings Chef für externe Angelegenheiten, hatte Erkelens gewarnt: »Der America’s Cup besteht aus drei Jahren voller Besprechungen, bevor ein Segelrennen folgt.« Erkelens eigenes Familienleben war dem operativen Geschäft angepasst worden. Erkelens nannte seine Kinder SAYONARA-Kids. Sein Sohn Josh war 1998 geboren worden und fünf Jahre alt, als die Familie ans Mittelmeer umsiedelte, um sich auf den King’s Cup vorzubereiten. Ashley kam im Jahre 2000 in Neuseeland zur Welt. Seine Frau Melinda war die Anwältin des Teams.
Es waren immer noch zwei Jahre bis zum Beginn der Rennen der neun Herausforderer, die um das Recht stritten, Team New Zealand im Kampf um den America’s Cup herausfordern zu dürfen. Doch schon jetzt absolvierten die Teammitglieder zwölf- bis 16-stündige Arbeitstage. Es ging zum einen um Organisation und Management für die alten Boote, zum anderen um Konstruktion, Design und Bau der beiden neuen. Da waren das Marketing, die Betreuung von Firmenkunden, das Sponsoring, der Vertrieb von Teamprodukten, die Markenentwicklung, die Pressearbeit und die Geschäftsführung. Es galt, sich um die Teambekleidung zu kümmern, um die Verpflegung, die Unterkünfte und die Versicherung für mehr als 140 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern. Teile mussten verschifft werden, darunter Segel, Rümpfe, Ausrüstung und Begleitboote. Dazu kam der Papierkram für die Zollbehörden, der schon für sich genommen Kopfschmerzen verursachte. Der ganze Betrieb kostete den Boss erstaunliche 100 000 US-Dollar pro Tag. Sie führten Sponsoring-Gespräche mit mehreren Großunternehmen, doch noch gab es keine unterzeichneten Verträge.
Erkelens, der als Kind davon geträumt hatte, im Winter als Gebirgsjäger auf Skiern und im Sommer als Segelboot-Designer zu arbeiten, hatte seinen Universitätsabschluss als Industriedesigner mit Schwerpunkt Herstellung gemacht. Er hatte damit gerechnet, dass er nach dem Abschluss für ein großes Unternehmen in der Warenproduktion arbeiten würde. Bereits während seiner Collegezeit hatte er an Segelbooten gearbeitet, um sich etwas Geld dazuzuverdienen. Einer seiner Kunden war David Thomson gewesen, jener Nachbar, der Larry Ellison ermutigt hatte, in die Regattaszene der Maxis einzusteigen. Erkelens war sehr versiert im Einmaleins von Bootsbaukunst und -design, ebenso in Betriebswirtschaft. Doch nichts, wirklich gar nichts hatte ihn auf die aufgeblasenen Egos der Segelsuperstars, die Risse im Team, die Anspannung und das Gerangel um die Positionen vorbereitet. An Bord von SAYONARA war alles einfacher gewesen. Da wurden Segler für ein Rennen verpflichtet, trafen in der Vorbereitungsphase ein, leisteten während der Regatta ihren Beitrag und reisten wieder ab. Einige von ihnen wurden für die nächste Regatta verpflichtet, andere nicht. Die Segler – so auch Dickson – waren unabhängige Dienstleister. Auch Dicksons Rolle war genau umrissen: Er war entweder Steuermann oder – wenn Larry steuerte – der Coach. Brad Butterworth, entspannt und professionell im Auftritt, diente SAYONARA als Taktiker, als »Augen auf dem Wasser«. Er hatte Windwechsel und Geschwindigkeit im Abgleich zur Konkurrenz im Blick, wobei er gleichzeitig die nächsten Schritte der Gegner antizipierte. Zu SAYONARAS festangestellten Mitarbeitern zählten Erkelens, seine Frau und noch ein oder zwei andere.
Nach vier Jahren mit Teilnahmen an Veranstaltungen rund um den Globus hatte SAYONARA bei den Maxis vier WM-Titel in Folge gewonnen und nicht eine einzige küstennahe Regatta verloren. Diese Siegesserie war 1999 einmal fast unterbrochen worden, als Larry sich bereit erklärt hatte, CNN-Gründer und Turner-Broadcasting-Vorstand Ted Turner das SAYONARA-Steuer zur Cowes Race Week zu überlassen. Turner, der den America’s Cup 1977 mit COURAGEOUS gewonnen hatte und insgesamt viermal zum Rolex-Segler des Jahres in den USA gewählt worden war, segelte nicht besonders gut und fand sich nach den Vorrennen und der ersten Wettfahrt der Regatta im hinteren Teil der Flotte wieder.
In jener Nacht rief Larry Erkelens an und bat ihn, an Bord seiner Yacht KATANA zu kommen. »Ich habe genug gesehen«, sagte Larry zu Erkelens, »Ted steuert nicht besonders gut. Ich nehme mir mein Boot zurück. SAYONARA hat bislang immer alle Kurzrennen gewonnen. Wir werden jetzt nicht mit dem Verlieren beginnen. Ich werde alle Rennen der Cowes Week steuern.« Er sagte, Turner könne SAYONARA für das Fastnet Race haben. »Da kann er dann steuern, soviel er will«, sagte Larry, »ich werde dem Steuer nicht einmal nahe kommen.«
Am nächsten Morgen musste Erkelens mit dem Begleitboot zu Turners Yacht fahren, um ihm die Botschaft zu überbringen. Erkelens war mit großem Respekt für Turner aufgewachsen. Dessen Frau Jane Fonda hatte einmal auf seine Kinder aufgepasst. Erkelens war von Turner beeindruckt gewesen, der seine Mitsegler stets mit Namen begrüßte, seine Mannschaftstreffen gut führte und sich am Ende eines Regattatages bei jedem persönlich für seine Zeit und seinen Einsatz bedankte.
Gleich nach der Begrüßung an Bord kam Erkelens beim Frühstück von Ted und Jane zur Sache.
»Es tut mir wirklich leid, Ted, aber Larry will sein Boot wiederhaben«, sagte Erkelens. Er war sich der Tatsache bewusst, dass er einem America’s-Cup-Gewinner sagte, er sei nicht gut genug zum Steuern von SAYONARA.
Turner schaute Erkelens an, als verstünde er nicht, was dieser ihm gerade gesagt hatte.
Erkelens entschuldigte sich und sagte: »Es tut mir leid. Ich bin nur der Überbringer der Nachricht.«
Ab dem zweiten Rennen steuerte Larry – und SAYONARA gewann die Cowes Week. Am Tag danach startete das Fastnet Race. Die Langstrecke startet vor Cowes auf der Isle of Wight, führt ihre Teilnehmer durch den Englischen Kanal und die Irische See einmal um den Fastnet-Felsen vor der Südwestküste Irlands herum und zurück in östlicher Richtung zur Ziellinie vor Plymouth an der englischen Südküste. Mit Turner am Steuer erlitt SAYONARA ihre schlimmste Niederlage. Sie erreichte die Ziellinie nach Booten, gegen die sie zuvor nie verloren hatte und gegen die sie nie wieder verlieren würde. Larry verbrachte die gesamten drei Renntage schlafend unter Deck, kam nur zu den Mahlzeiten herauf – und um herauszufinden, wie weit sie hinter den führenden Booten zurücklagen. Er schwor, dass er sein Boot nie wieder einem anderen leihen würde. Später sagte er zu Erkelens: »Das Regattasegeln ist heute ganz anders als noch zu Teds Zeiten. Es wird nicht mehr länger von den Eigengewächsen der Yacht-Clubs bestimmt, sondern von Profis, die diese schöne neue Welt dominieren.«
Als Turner den America’s Cup 1997 gewonnen hatte, hatte ihn das Rennen keine drei Millionen Dollar gekostet. Inzwischen hatten sich die Budgets der 100-Millionen-Dollar-Grenze genähert. Die besten Segler und Taktiker agierten auf den unglaublichsten Booten, die von den klügsten Design-Köpfen erdacht und für Geld zu haben waren. Sie agierten auf einem unberechenbaren flüssigen Rennkurs, auf dem es für Geschwindigkeiten keine Grenzen gab. Erkelens tat sein Bestes, um sein Team vorzubereiten.
Im Lager in den Hügeln von Santa Barbara waren die Nachzügler inzwischen gefunden worden. Alle, sogar Dickson, hatten sich inzwischen wieder beruhigt und saßen auf ihrem Platz. Die Busse konnten nun in das 32 Kilometer entfernt liegende Basiscamp in Ventura zurückkehren.
Während er aus dem Fenster schaute, sinnierte Erkelens über die Höhen und Tiefen des hinter ihnen liegenden Wochenendes. Es hatte fast so qualvoll begonnen, wie es geendet hatte. Sie hatten die erste Nacht vor der Ankunft im Lager noch in einem Hotel verbracht und waren dort von einem inspirierenden Redner namens Alan Chambers begrüßt worden. Dieser hatte einst das erste erfolgreiche britische Team ohne Unterstützung von außen von Kanada zum Nordpol geführt und sprach nun darüber, was es zur Planung und Durchführung einer Spitzenleistung bedürfe. Chambers beschrieb, wie er fünf Jahre in die Planungen und Erkundungen für die Expedition investiert hatte. Er hatte mit Inuit-Familien gelebt und während seiner zehn Wochen im Eis gefahrenvolle Momente überstanden, in denen er einmal sogar allein auf einem Eisberg abgetrieben war.
Tugsy Turner lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hörte zu, sein Kinn hielt er dabei auf die Hände gestützt. Er hatte schon befürchtet, dass sich dieses Wochenende als Pleite entpuppen und nur Zeit für die Arbeit an den Booten stehlen würde. Er hörte zu und bemühte sich um Aufgeschlossenheit, während Chambers vom Umgang mit Widrigkeiten berichtete. Tugsy begann abzuschalten, als Chambers sagte, dass »alle als Team zusammenarbeiten« und »es gemeinsam erreichen« müssten. Als Chambers sagte, dass »die Grenzen nur in der Vorstellungskraft existieren« und eine gefühlte Stunde über »einsam treibende Eisberge« sprach, rollte Tugsy mit den Augen. Erkelens zuckte zusammen.
In der ersten Nacht im Pfadfinder-Camp war das Team in vier Gruppen mit jeweils 35 Leuten aufgeteilt worden: Rot, Blau, Gelb und Grün. Nachdem sie ihre Taschen in den Schlafbaracken zurückgelassen hatten, wurden die Teammitglieder aufgefordert, große Zelte aufzubauen, die am nächsten Tag gebraucht würden. Diese Aufgabe sollte sie vermutlich dazu animieren, von Beginn an als Team zu operieren. Den Teams wurde eine ganze Reihe weiterer Aufgaben gestellt, zu deren Bewältigung die Farbgruppen noch einmal in jeweils vier Teams unterteilt wurden. Als die erste Übung darin bestand, für diesen Tag einen Anführer zu wählen, war Tugsy klar, dass es direkt lustig losgehen würde. Er musste sich bemühen, nicht laut loszulachen, als der amerikanische Star Cayard und der neuseeländische Skipper und Taktiker Dickson um die Position rangen. Die Szene wirkte wie der Kampf zweier Jungs um ein neues Spielzeug. Dickson und Cayard, aber auch einige andere, bewarben sich im Cup-Team um die Skipper-Position. Die Situation erinnerte an die Zeit, in der sowohl Steve Young als auch Joe Montana für die San Francisco 49ers spielten. Doch Dickson und Cayard kamen in etwa so gut miteinander aus wie die Basketball-Stars Shaquille O’Neal und Kobe Bryant oder die Baseball-Legenden Barry Bonds und Jeff Kent. Nämlich gar nicht.
Während der Übungen für mehr Teamgeist lief es schließlich darauf hinaus, dass Cayard sein Team führte. Sie bauten Brücken und arbeiteten daran, ihre Leute über Strickleitern und Felsen auf die andere Seite zu bringen. Erkelens schöpfte ein bisschen Mut, als er die Designer und Segler dabei beobachtete, wie sie gemeinsam am Lagerfeuer saßen oder im Pool Wasserball spielten. Was Erkelens aber nicht gesehen hatte – und erst jetzt im Bus nach und nach hörte –, waren die Grabenkämpfe, die in den Gruppen ausgebrochen waren. Sogar im Pool.
Der Busvorfall bestätigte Erkelens’ Sorge, dass Dickson, den alle nur »Dicko« nannten, offenbar noch eine andere Seite hatte. Als sich der Bus Ventura näherte, hatte Erkelens beschlossen, dass er darüber mit Larry würde sprechen müssen. Larry hatte fünf Maxi-Weltmeisterschaften mit Dickson als Taktiker gewonnen.
Erkelens wusste, dass sein Boss mehr an Leistung als an Persönlichkeit interessiert war. Darüber hinaus würde Larry eine Teambuilding-Veranstaltung wie diese vermutlich als dämlich abtun. Das Problem war, dass Larry Dickson noch nie so aus dem Gleichgewicht geraten erlebt hatte. Außer im Sydney-to-Hobart-Race. In dem Fall aber fiel Dickson nicht weiter auf, weil ohnehin alle seekrank waren.
Larry hatte noch nicht gesehen, was die anderen erlebt hatten: die Beinahe-Faustkämpfe an Bord mit den eigenen Teammitgliedern oder das zänkische Verhalten. Larry hatte nur Siege erlebt, zu denen Dickson als Taktiker beigetragen hatte. Dickson war ein großartiger Segler. Vielleicht der beste von allen. 1987 war er im Alter von erst 26 Jahren Skipper der ersten Cup-Kampagne Team New Zealands gewesen. 1992 hatte Dickson auch das japanische Team als Skipper geführt, das im Louis Vuitton Cup Platz drei belegte. Und er war 1995 Initiator und Skipper einer in Neuseeland beheimateten und von TAG Heuer gesponserten Kampagne, die ebenfalls Platz drei in der Herausfordererserie erreichte. Doch Dickson war ebenso aufbrausend wie talentiert. In Seglerkreisen galt er als harter Knochen.
In den Match Races zwischen den Teammitgliedern ging es vor der Küste von Ventura immer hitziger zu. Dickson überzog seine Crew mit Verbalattacken wie diesen: »Du bis ein verdammter Idiot und solltest gar nicht auf dem Boot sein dürfen« oder »Du bist ein Blender« oder »Wie kannst du damit nur deinen Lebensunterhalt verdienen?«.
Glücklicherweise mangelte es aus Erkelens’ Sicht nicht an Leistungsträgern, falls Dickson das Team würde verlassen müssen. Erkelens hatte Vertrauen in die anderen Segler, die sich um die Position des Steuermanns bewarben: Cayard und Peter Holmberg von den Amerikanischen Jungferninseln, der bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul vor Pusan Silber in der Einhandklasse Finn gewonnen hatte. Dazu der in England geborene John Cutler, der in der gleichen Bootsklasse in Pusan Bronze gewonnen hatte.
Erkelens wusste, dass Larry für Überlegungen anderer Menschen durchaus zugänglich war. Er wusste aber auch, dass Larry in der Geschäftswelt gerade deswegen nahezu einzigartig erfolgreich war, weil er allgemein herrschende Meinungen in der Regel ignorierte. Erkelens hatte miterlebt, wie schnell Larry Entscheidungen treffen und damit alle überraschen konnte.